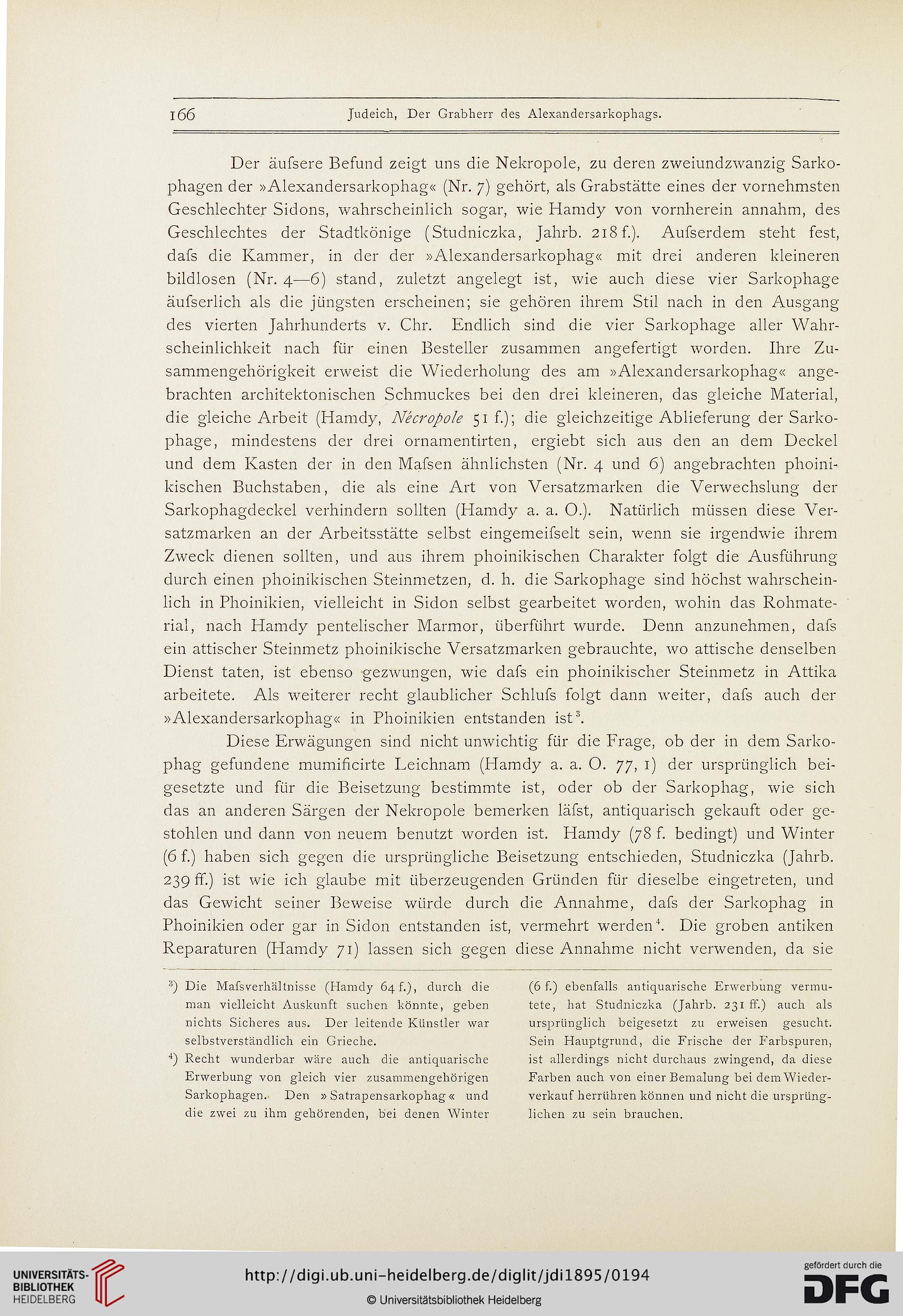ι66
Judeich, Der Grabherr des Alexandersarkophags.
Der äufsere Befund zeigt uns die Nekropole, zu deren zweiundzwanzig Sarko-
phagen der »Alexandersarkophag« (Nr. 7) gehört, als Grabstätte eines der vornehmsten
Geschlechter Sidons, wahrscheinlich sogar, wie Hamdy von vornherein annahm, des
Geschlechtes der Stadtkönige (Studniczka, Jahrb. 218 f.). Aufserdem steht fest,
dafs die Kammer, in der der »Alexandersarkophag« mit drei anderen kleineren
bildlosen (Nr. 4—6) stand, zuletzt angelegt ist, wie auch diese vier Sarkophage
äufserlich als die jüngsten erscheinen; sie gehören ihrem Stil nach in den Ausgang
des vierten Jahrhunderts v. Chr. Endlich sind die vier Sarkophage aller Wahr-
scheinlichkeit nach für einen Besteller zusammen angefertigt worden. Ihre Zu-
sammengehörigkeit erweist die Wiederholung des am »Alexandersarkophag« ange-
brachten architektonischen Schmuckes bei den drei kleineren, das gleiche Material,
die gleiche Arbeit (Hamdy, Necropole 51 f.); die gleichzeitige Ablieferung der Sarko-
phage, mindestens der drei ornamentirten, ergiebt sich aus den an dem Deckel
und dem Kasten der in den Mafsen ähnlichsten (Nr. 4 und 6) angebrachten phoini-
kischen Buchstaben, die als eine Art von Versatzmarken die Verwechslung der
Sarkophagdeckel verhindern sollten (Hamdy a. a. O.). Natürlich müssen diese Ver-
satzmarken an der Arbeitsstätte selbst eingemeifselt sein, wenn sie irgendwie ihrem
Zweck dienen sollten, und aus ihrem phoinikischen Charakter folgt die Ausführung
durch einen phoinikischen Steinmetzen, d. h. die Sarkophage sind höchst wahrschein-
lich in Phoinikien, vielleicht in Sidon selbst gearbeitet worden, wohin das Rohmate-
rial, nach Hamdy pentelischer Marmor, überführt wurde. Denn anzunehmen, dafs
ein attischer Steinmetz phoinikische Versatzmarken gebrauchte, wo attische denselben
Dienst taten, ist ebenso gezwungen, wie dafs ein phoinikischer Steinmetz in Attika
arbeitete. Als weiterer recht glaublicher Schlufs folgt dann weiter, dafs auch der
»Alexandersarkophag« in Phoinikien entstanden ist3.
Diese Erwägungen sind nicht unwichtig für die Frage, ob der in dem Sarko-
phag gefundene mumificirte Leichnam (Hamdy a. a. O. 77, 1) der ursprünglich bei-
gesetzte und für die Beisetzung bestimmte ist, oder ob der Sarkophag, wie sich
das an anderen Särgen der Nekropole bemerken läfst, antiquarisch gekauft oder ge-
stohlen und dann von neuem benutzt worden ist. Hamdy (78 f. bedingt) und Winter
(6 f.) haben sich gegen die ursprüngliche Beisetzung entschieden, Studniczka (Jahrb.
239 ff.) ist wie ich glaube mit überzeugenden Gründen für dieselbe eingetreten, und
das Gewicht seiner Beweise würde durch die Annahme, dafs der Sarkophag in
Phoinikien oder gar in Sidon entstanden ist, vermehrt wTerden4. Die groben antiken
Reparaturen (Hamdy 71) lassen sich gegen diese Annahme nicht verwenden, da sie
3) Die Mafsverhältnisse (Hamdy 64t.), durch die
man vielleicht Auskunft suchen könnte, geben
nichts Sicheres aus. Der leitende Künstler war
selbstverständlich ein Grieche.
4) Recht wunderbar wäre auch die antiquarische
Erwerbung von gleich vier zusammengehörigen
Sarkophagen. Den »Satrapensarkophag« und
die zwei zu ihm gehörenden, bei denen Winter
(6 f.) ebenfalls antiquarische Erwerbung vermu-
tete, hat Studniczka (Jahrb. 231 ff.) auch als
ursprünglich beigesetzt zu erweisen gesucht.
Sein Hauptgrund, die Frische der Farbspuren,
ist allerdings nicht durchaus zwingend, da diese
Farben auch von einer Bemalung bei dem Wieder-
verkauf herrühren können und nicht die ursprüng-
lichen zu sein brauchen.
Judeich, Der Grabherr des Alexandersarkophags.
Der äufsere Befund zeigt uns die Nekropole, zu deren zweiundzwanzig Sarko-
phagen der »Alexandersarkophag« (Nr. 7) gehört, als Grabstätte eines der vornehmsten
Geschlechter Sidons, wahrscheinlich sogar, wie Hamdy von vornherein annahm, des
Geschlechtes der Stadtkönige (Studniczka, Jahrb. 218 f.). Aufserdem steht fest,
dafs die Kammer, in der der »Alexandersarkophag« mit drei anderen kleineren
bildlosen (Nr. 4—6) stand, zuletzt angelegt ist, wie auch diese vier Sarkophage
äufserlich als die jüngsten erscheinen; sie gehören ihrem Stil nach in den Ausgang
des vierten Jahrhunderts v. Chr. Endlich sind die vier Sarkophage aller Wahr-
scheinlichkeit nach für einen Besteller zusammen angefertigt worden. Ihre Zu-
sammengehörigkeit erweist die Wiederholung des am »Alexandersarkophag« ange-
brachten architektonischen Schmuckes bei den drei kleineren, das gleiche Material,
die gleiche Arbeit (Hamdy, Necropole 51 f.); die gleichzeitige Ablieferung der Sarko-
phage, mindestens der drei ornamentirten, ergiebt sich aus den an dem Deckel
und dem Kasten der in den Mafsen ähnlichsten (Nr. 4 und 6) angebrachten phoini-
kischen Buchstaben, die als eine Art von Versatzmarken die Verwechslung der
Sarkophagdeckel verhindern sollten (Hamdy a. a. O.). Natürlich müssen diese Ver-
satzmarken an der Arbeitsstätte selbst eingemeifselt sein, wenn sie irgendwie ihrem
Zweck dienen sollten, und aus ihrem phoinikischen Charakter folgt die Ausführung
durch einen phoinikischen Steinmetzen, d. h. die Sarkophage sind höchst wahrschein-
lich in Phoinikien, vielleicht in Sidon selbst gearbeitet worden, wohin das Rohmate-
rial, nach Hamdy pentelischer Marmor, überführt wurde. Denn anzunehmen, dafs
ein attischer Steinmetz phoinikische Versatzmarken gebrauchte, wo attische denselben
Dienst taten, ist ebenso gezwungen, wie dafs ein phoinikischer Steinmetz in Attika
arbeitete. Als weiterer recht glaublicher Schlufs folgt dann weiter, dafs auch der
»Alexandersarkophag« in Phoinikien entstanden ist3.
Diese Erwägungen sind nicht unwichtig für die Frage, ob der in dem Sarko-
phag gefundene mumificirte Leichnam (Hamdy a. a. O. 77, 1) der ursprünglich bei-
gesetzte und für die Beisetzung bestimmte ist, oder ob der Sarkophag, wie sich
das an anderen Särgen der Nekropole bemerken läfst, antiquarisch gekauft oder ge-
stohlen und dann von neuem benutzt worden ist. Hamdy (78 f. bedingt) und Winter
(6 f.) haben sich gegen die ursprüngliche Beisetzung entschieden, Studniczka (Jahrb.
239 ff.) ist wie ich glaube mit überzeugenden Gründen für dieselbe eingetreten, und
das Gewicht seiner Beweise würde durch die Annahme, dafs der Sarkophag in
Phoinikien oder gar in Sidon entstanden ist, vermehrt wTerden4. Die groben antiken
Reparaturen (Hamdy 71) lassen sich gegen diese Annahme nicht verwenden, da sie
3) Die Mafsverhältnisse (Hamdy 64t.), durch die
man vielleicht Auskunft suchen könnte, geben
nichts Sicheres aus. Der leitende Künstler war
selbstverständlich ein Grieche.
4) Recht wunderbar wäre auch die antiquarische
Erwerbung von gleich vier zusammengehörigen
Sarkophagen. Den »Satrapensarkophag« und
die zwei zu ihm gehörenden, bei denen Winter
(6 f.) ebenfalls antiquarische Erwerbung vermu-
tete, hat Studniczka (Jahrb. 231 ff.) auch als
ursprünglich beigesetzt zu erweisen gesucht.
Sein Hauptgrund, die Frische der Farbspuren,
ist allerdings nicht durchaus zwingend, da diese
Farben auch von einer Bemalung bei dem Wieder-
verkauf herrühren können und nicht die ursprüng-
lichen zu sein brauchen.