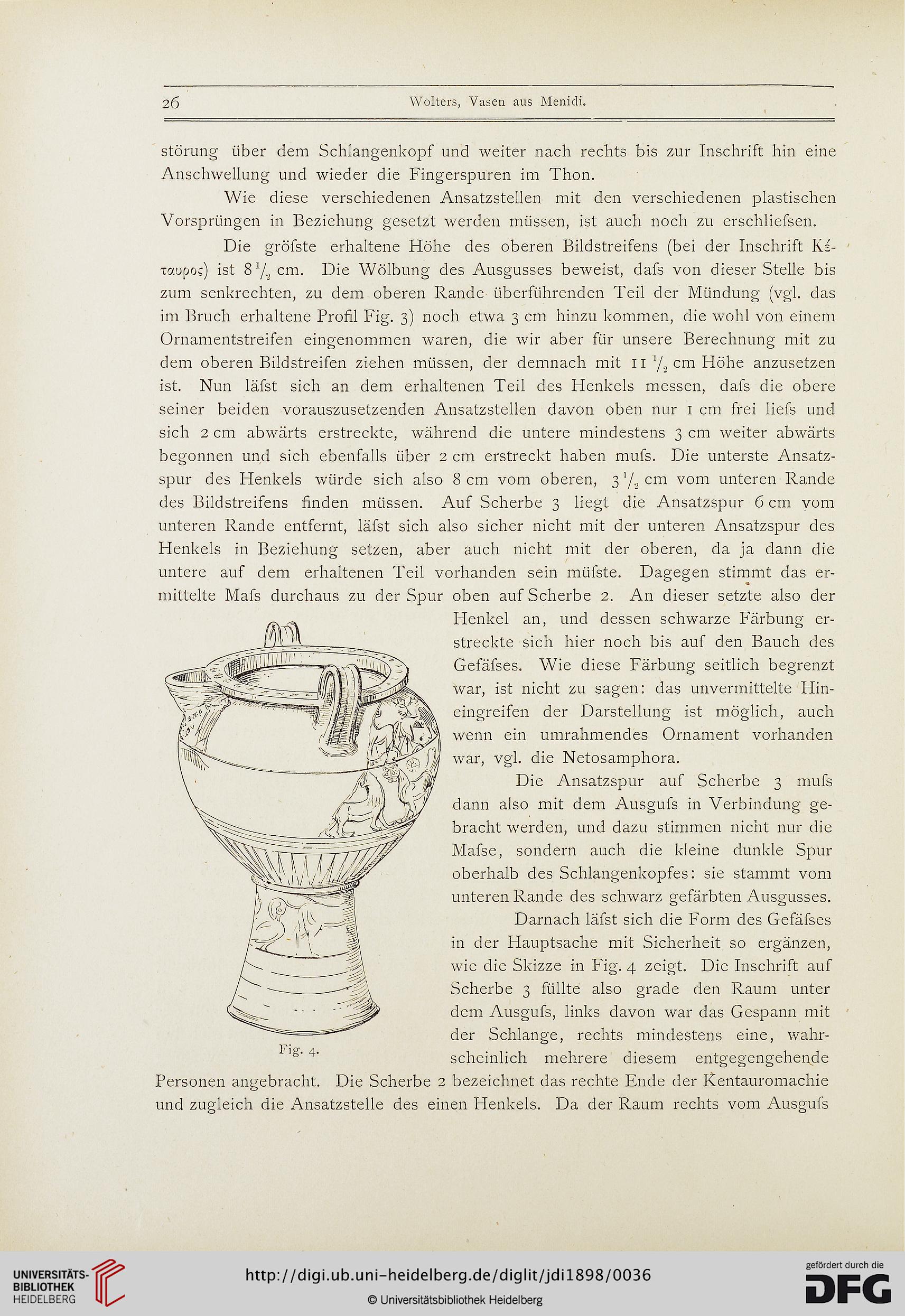26
Wolters, Vasen aus Menidi.
Störung über dem Schlangenkopf und weiter nach rechts bis zur Inschrift hin eine
Anschwellung und wieder die Fingerspuren im Thon.
Wie diese verschiedenen Ansatzstellen mit den verschiedenen plastischen
Vorsprüngen in Beziehung gesetzt werden müssen, ist auch noch zu erschliefsen.
Die gröfste erhaltene Höhe des oberen Bildstreifens (bei der Inschrift Κέ-
xaupoc) ist 8 73 cm. Die Wölbung des Ausgusses beweist, dafs von dieser Stelle bis
zum senkrechten, zu dem oberen Rande überführenden Teil der Mündung (vgl. das
im Bruch erhaltene Brohl Fig. 3) noch etwa 3 cm hinzu kommen, die wohl von einem
Ornamentstreifen eingenommen waren, die wir aber für unsere Berechnung mit zu
dem oberen Bildstreifen ziehen müssen, der demnach mit 11 l/2 cm Höhe anzusetzen
ist. Nun läfst sich an dem erhaltenen Teil des Henkels messen, dafs die obere
seiner beiden vorauszusetzenden Ansatzstellen davon oben nur 1 cm frei liefs und
sich 2 cm abwärts erstreckte, während die untere mindestens 3 cm weiter abwärts
begonnen und sich ebenfalls über 2 cm erstreckt haben mufs. Die unterste Ansatz-
spur des Henkels würde sich also 8 cm vom oberen, 3 '/2 cm vom unteren Rande
des Bildstreifens finden müssen. Auf Scherbe 3 liegt die Ansatzspur 6 cm vom
unteren Rande entfernt, läfst sich also sicher nicht mit der unteren Ansatzspur des
Henkels in Beziehung setzen, aber auch nicht mit der oberen, da ja dann die
untere auf dem erhaltenen Teil vorhanden sein miifste. Dagegen stimmt das er-
mittelte Mafs durchaus zu der Spur oben auf Scherbe 2. An dieser setzte also der
Henkel an, und dessen schwarze Färbung er-
streckte sich hier noch bis auf den Bauch des
Gefäfses. Wie diese Färbung seitlich begrenzt
war, ist nicht zu sagen: das unvermittelte Hin-
eingreifen der Darstellung ist möglich, auch
wenn ein umrahmendes Ornament vorhanden
war, vgl. die Netosamphora.
Die Ansatzspur auf Scherbe 3 mufs
Fig. 4.
dann also mit dem Ausgufs in Verbindung ge-
bracht werden, und dazu stimmen nicht nur die
Mafse, sondern auch die kleine dunkle Spur
oberhalb des Schlangenkopfes: sie stammt vom
unteren Rande des schwarz gefärbten Ausgusses.
Darnach läfst sich die Form des Gefäfses
in der Hauptsache mit Sicherheit so ergänzen,
wie die Skizze in Fig. 4 zeigt. Die Inschrift auf
Scherbe 3 füllte also grade den Raum unter
dem Ausgufs, links davon war das Gespann mit
der Schlange, rechts mindestens eine, wahr-
scheinlich mehrere diesem entgeeengehende
Personen angebracht. Die Scherbe 2 bezeichnet das rechte Ende der Kentauromachie
und zugleich die Ansatzstelle des einen ITenkels. Da der Raum rechts vom Ausgufs
Wolters, Vasen aus Menidi.
Störung über dem Schlangenkopf und weiter nach rechts bis zur Inschrift hin eine
Anschwellung und wieder die Fingerspuren im Thon.
Wie diese verschiedenen Ansatzstellen mit den verschiedenen plastischen
Vorsprüngen in Beziehung gesetzt werden müssen, ist auch noch zu erschliefsen.
Die gröfste erhaltene Höhe des oberen Bildstreifens (bei der Inschrift Κέ-
xaupoc) ist 8 73 cm. Die Wölbung des Ausgusses beweist, dafs von dieser Stelle bis
zum senkrechten, zu dem oberen Rande überführenden Teil der Mündung (vgl. das
im Bruch erhaltene Brohl Fig. 3) noch etwa 3 cm hinzu kommen, die wohl von einem
Ornamentstreifen eingenommen waren, die wir aber für unsere Berechnung mit zu
dem oberen Bildstreifen ziehen müssen, der demnach mit 11 l/2 cm Höhe anzusetzen
ist. Nun läfst sich an dem erhaltenen Teil des Henkels messen, dafs die obere
seiner beiden vorauszusetzenden Ansatzstellen davon oben nur 1 cm frei liefs und
sich 2 cm abwärts erstreckte, während die untere mindestens 3 cm weiter abwärts
begonnen und sich ebenfalls über 2 cm erstreckt haben mufs. Die unterste Ansatz-
spur des Henkels würde sich also 8 cm vom oberen, 3 '/2 cm vom unteren Rande
des Bildstreifens finden müssen. Auf Scherbe 3 liegt die Ansatzspur 6 cm vom
unteren Rande entfernt, läfst sich also sicher nicht mit der unteren Ansatzspur des
Henkels in Beziehung setzen, aber auch nicht mit der oberen, da ja dann die
untere auf dem erhaltenen Teil vorhanden sein miifste. Dagegen stimmt das er-
mittelte Mafs durchaus zu der Spur oben auf Scherbe 2. An dieser setzte also der
Henkel an, und dessen schwarze Färbung er-
streckte sich hier noch bis auf den Bauch des
Gefäfses. Wie diese Färbung seitlich begrenzt
war, ist nicht zu sagen: das unvermittelte Hin-
eingreifen der Darstellung ist möglich, auch
wenn ein umrahmendes Ornament vorhanden
war, vgl. die Netosamphora.
Die Ansatzspur auf Scherbe 3 mufs
Fig. 4.
dann also mit dem Ausgufs in Verbindung ge-
bracht werden, und dazu stimmen nicht nur die
Mafse, sondern auch die kleine dunkle Spur
oberhalb des Schlangenkopfes: sie stammt vom
unteren Rande des schwarz gefärbten Ausgusses.
Darnach läfst sich die Form des Gefäfses
in der Hauptsache mit Sicherheit so ergänzen,
wie die Skizze in Fig. 4 zeigt. Die Inschrift auf
Scherbe 3 füllte also grade den Raum unter
dem Ausgufs, links davon war das Gespann mit
der Schlange, rechts mindestens eine, wahr-
scheinlich mehrere diesem entgeeengehende
Personen angebracht. Die Scherbe 2 bezeichnet das rechte Ende der Kentauromachie
und zugleich die Ansatzstelle des einen ITenkels. Da der Raum rechts vom Ausgufs