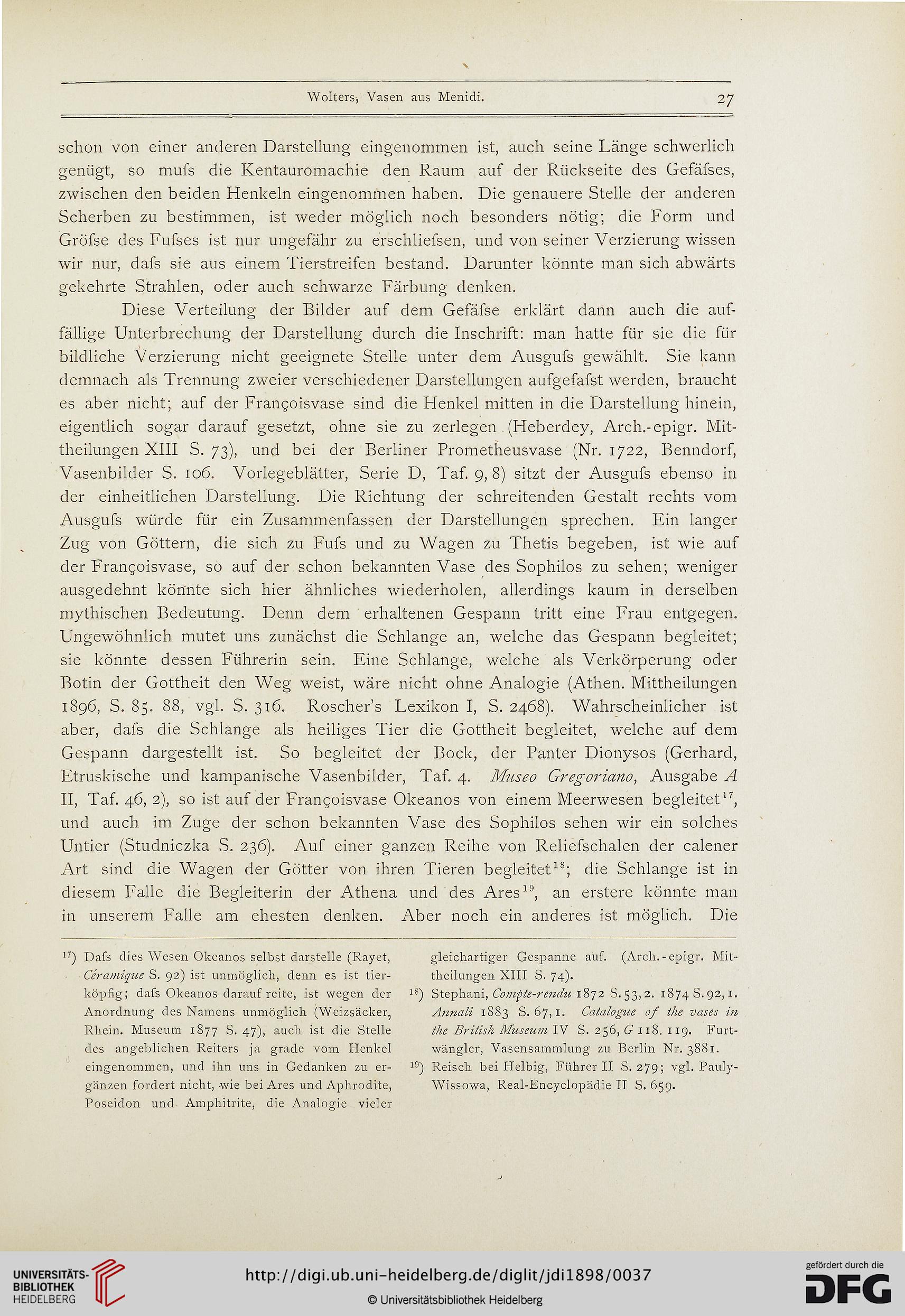Wolters-, Vasen aus Menidi. 27
schon von einer anderen Darstellung eingenommen ist, auch seine Länge schwerlich
genügt, so mufs die Kentauromachie den Raum auf der Rückseite des Gefäfses,
zwischen den beiden Henkeln eingenommen haben. Die genauere Stelle der anderen
Scherben zu bestimmen, ist weder möglich noch besonders nötig; die Form und
Gröfse des Fufses ist nur ungefähr zu erschliefsen, und von seiner Verzierung wissen
wir nur, dafs sie aus einem Tierstreifen bestand. Darunter könnte man sich abwärts
gekehrte Strahlen, oder auch schwarze Färbung denken.
Diese Verteilung der Bilder auf dem Gefäfse erklärt dann auch die auf-
fällige Unterbrechung der Darstellung durch die Inschrift: man hatte für sie die für
bildliche Verzierung nicht geeignete Stelle unter dem Ausgufs gewählt. Sie kann
demnach als Trennung zweier verschiedener Darstellungen aufgefafst werden, braucht
es aber nicht; auf der Frangoisvase sind die Henkel mitten in die Darstellung hinein,
eigentlich sogar darauf gesetzt, ohne sie zu zerlegen . (Heberdey, Arch.-epigr. Mit-
theilungen XIII S. 73), und bei der Berliner Prometheusvase (Nr. 1722, Benndorf,
Vasenbilder S. 106. Vorlegeblätter, Serie D, Taf. 9, 8) sitzt der Ausgufs ebenso in
der einheitlichen Darstellung. Die Richtung der schreitenden Gestalt rechts vom
Ausgufs würde für ein Zusammenfassen der Darstellungen sprechen. Ein langer
Zug von Göttern, die sich zu Fufs und zu Wagen zu Thetis begeben, ist wie auf
der Frangoisvase, so auf der schon bekannten Vase des Sophilos zu sehen; weniger
ausgedehnt könnte sich hier ähnliches wiederholen, allerdings kaum in derselben
mythischen Bedeutung. Denn dem erhaltenen Gespann tritt eine Frau entgegen.
Ungewöhnlich mutet uns zunächst die Schlange an, welche das Gespann begleitet;
sie könnte dessen Führerin sein. Eine Schlange, welche als Verkörperung oder
Botin der Gottheit den Weg weist, wäre nicht ohne Analogie (Athen. Mittheilungen
1896, S. 85. 88, vgl. S. 316. Roscher’s Lexikon I, S. 2468). Wahrscheinlicher ist
aber, dafs die Schlange als heiliges Tier die Gottheit begleitet, welche auf dem
Gespann dargestellt ist. So begleitet der Bock, der Panter Dionysos (Gerhard,
Etruskische und kampanische Vasenbilder, Taf. 4. Museo Gregoriano, Ausgabe A
II, Taf. 46, 2), so ist auf der Frangoisvase Okeanos von einem Meerwesen begleitet17,
und auch im Zuge der schon bekannten Vase des Sophilos sehen wir ein solches
Untier (Studniczka S. 236). Auf einer ganzen Reihe von Reliefschalen der calener
Art sind die Wagen der Götter von ihren Tieren begleitet18; die Schlange ist in
diesem Falle die Begleiterin der Athena und des Ares10, an erstere könnte man
in unserem Falle am ehesten denken. Aber noch ein anderes ist möglich. Die
,r) Dafs dies Wesen Okeanos selbst darstelle (Rayet,
Ceramique S. 92) ist unmöglich, denn es ist tier-
köpfig; dafs Okeanos darauf reite, ist wegen der
Anordnung des Namens unmöglich (Weizsäcker,
Rhein. Museum 1877 S. 47), auch ist die Stelle
des angeblichen Reiters ja grade vom Henkel
eingenommen, und ihn uns in Gedanken zu er-
gänzen fordert nicht, -wie bei Ares und Aphrodite,
Poseidon und Amphitrite, die Analogie vieler
gleichartiger Gespanne auf. (Arch.-epigr. Mit-
theilungen XIII S. 74).
1S) Stephani, Comfte-rendu 1872 S.53,2. 18748.92,1.
Annali 1883 S. 67,1. Catalogue of the vases in
the British Museum IV S. 256, G118. 119. Furt-
wängler, Vasensammlung zu Berlin Nr. 38S1.
19) Reisch bei Helbig, Führer II S. 279; vgl. Pauly-
Wissowa, Real-Encyclopädie II S. 659.
schon von einer anderen Darstellung eingenommen ist, auch seine Länge schwerlich
genügt, so mufs die Kentauromachie den Raum auf der Rückseite des Gefäfses,
zwischen den beiden Henkeln eingenommen haben. Die genauere Stelle der anderen
Scherben zu bestimmen, ist weder möglich noch besonders nötig; die Form und
Gröfse des Fufses ist nur ungefähr zu erschliefsen, und von seiner Verzierung wissen
wir nur, dafs sie aus einem Tierstreifen bestand. Darunter könnte man sich abwärts
gekehrte Strahlen, oder auch schwarze Färbung denken.
Diese Verteilung der Bilder auf dem Gefäfse erklärt dann auch die auf-
fällige Unterbrechung der Darstellung durch die Inschrift: man hatte für sie die für
bildliche Verzierung nicht geeignete Stelle unter dem Ausgufs gewählt. Sie kann
demnach als Trennung zweier verschiedener Darstellungen aufgefafst werden, braucht
es aber nicht; auf der Frangoisvase sind die Henkel mitten in die Darstellung hinein,
eigentlich sogar darauf gesetzt, ohne sie zu zerlegen . (Heberdey, Arch.-epigr. Mit-
theilungen XIII S. 73), und bei der Berliner Prometheusvase (Nr. 1722, Benndorf,
Vasenbilder S. 106. Vorlegeblätter, Serie D, Taf. 9, 8) sitzt der Ausgufs ebenso in
der einheitlichen Darstellung. Die Richtung der schreitenden Gestalt rechts vom
Ausgufs würde für ein Zusammenfassen der Darstellungen sprechen. Ein langer
Zug von Göttern, die sich zu Fufs und zu Wagen zu Thetis begeben, ist wie auf
der Frangoisvase, so auf der schon bekannten Vase des Sophilos zu sehen; weniger
ausgedehnt könnte sich hier ähnliches wiederholen, allerdings kaum in derselben
mythischen Bedeutung. Denn dem erhaltenen Gespann tritt eine Frau entgegen.
Ungewöhnlich mutet uns zunächst die Schlange an, welche das Gespann begleitet;
sie könnte dessen Führerin sein. Eine Schlange, welche als Verkörperung oder
Botin der Gottheit den Weg weist, wäre nicht ohne Analogie (Athen. Mittheilungen
1896, S. 85. 88, vgl. S. 316. Roscher’s Lexikon I, S. 2468). Wahrscheinlicher ist
aber, dafs die Schlange als heiliges Tier die Gottheit begleitet, welche auf dem
Gespann dargestellt ist. So begleitet der Bock, der Panter Dionysos (Gerhard,
Etruskische und kampanische Vasenbilder, Taf. 4. Museo Gregoriano, Ausgabe A
II, Taf. 46, 2), so ist auf der Frangoisvase Okeanos von einem Meerwesen begleitet17,
und auch im Zuge der schon bekannten Vase des Sophilos sehen wir ein solches
Untier (Studniczka S. 236). Auf einer ganzen Reihe von Reliefschalen der calener
Art sind die Wagen der Götter von ihren Tieren begleitet18; die Schlange ist in
diesem Falle die Begleiterin der Athena und des Ares10, an erstere könnte man
in unserem Falle am ehesten denken. Aber noch ein anderes ist möglich. Die
,r) Dafs dies Wesen Okeanos selbst darstelle (Rayet,
Ceramique S. 92) ist unmöglich, denn es ist tier-
köpfig; dafs Okeanos darauf reite, ist wegen der
Anordnung des Namens unmöglich (Weizsäcker,
Rhein. Museum 1877 S. 47), auch ist die Stelle
des angeblichen Reiters ja grade vom Henkel
eingenommen, und ihn uns in Gedanken zu er-
gänzen fordert nicht, -wie bei Ares und Aphrodite,
Poseidon und Amphitrite, die Analogie vieler
gleichartiger Gespanne auf. (Arch.-epigr. Mit-
theilungen XIII S. 74).
1S) Stephani, Comfte-rendu 1872 S.53,2. 18748.92,1.
Annali 1883 S. 67,1. Catalogue of the vases in
the British Museum IV S. 256, G118. 119. Furt-
wängler, Vasensammlung zu Berlin Nr. 38S1.
19) Reisch bei Helbig, Führer II S. 279; vgl. Pauly-
Wissowa, Real-Encyclopädie II S. 659.