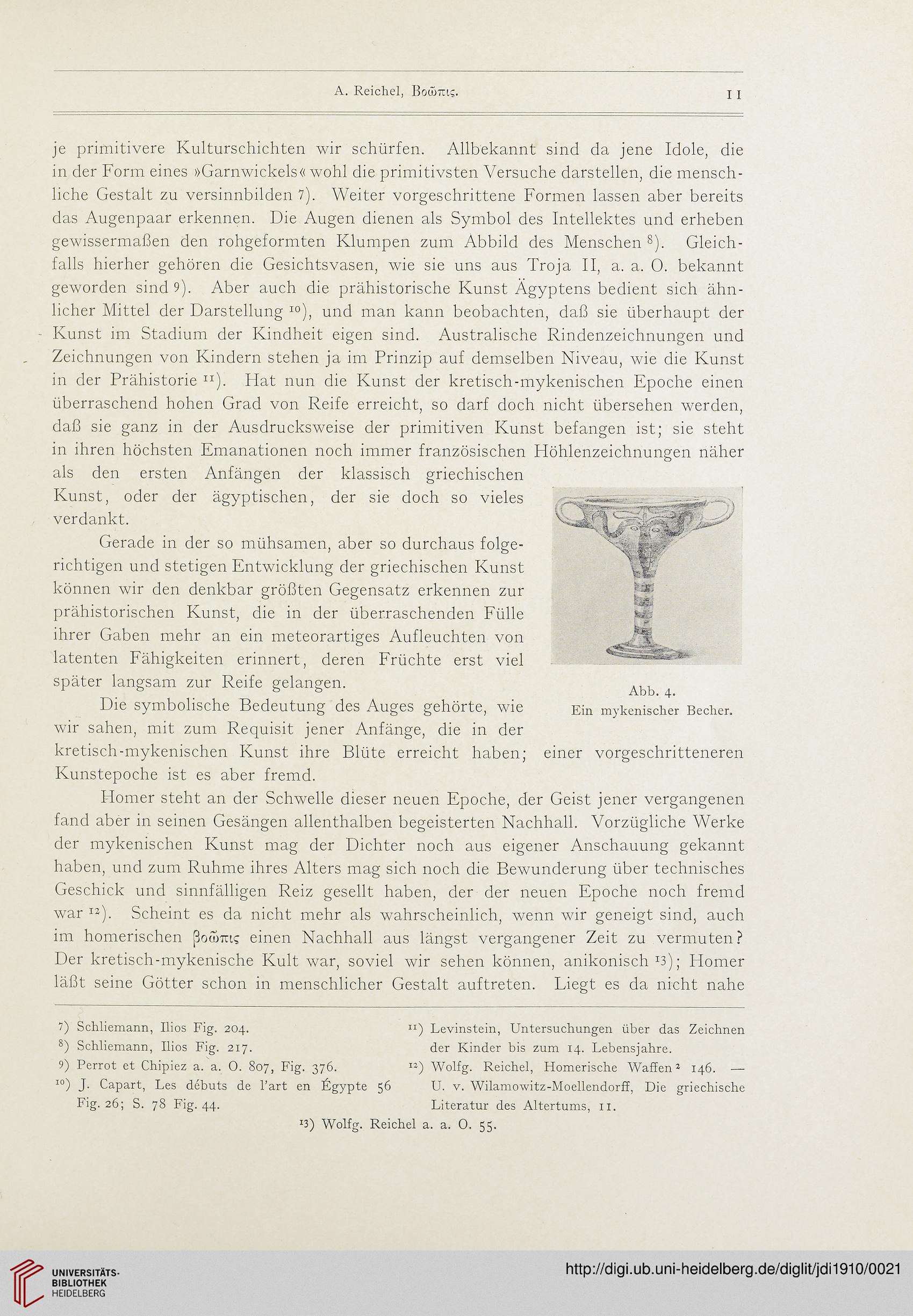A. Reichel, Βοώπις.
I I
je primitivere Kulturschichten wir schürfen. Allbekannt sind da jene Idole, die
in der Form eines »Garnwickels« wohl die primitivsten Versuche darstellen, die mensch-
liche Gestalt zu versinnbilden 7). Weiter vorgeschrittene Formen lassen aber bereits
das Augenpaar erkennen. Die Augen dienen als Symbol des Intellektes und erheben
gewissermaßen den rohgeformten Klumpen zum Abbild des Menschen * 8 *). Gleich-
falls hierher gehören die Gesichtsvasen, wie sie uns aus Troja II, a. a. 0. bekannt
geworden sind 9). Aber auch die prähistorische Kunst Ägyptens bedient sich ähn-
licher Mittel der Darstellung I0 *), und man kann beobachten, daß sie überhaupt der
Kunst im Stadium der Kindheit eigen sind. Australische Rindenzeichnungen und
Zeichnungen von Kindern stehen ja im Prinzip auf demselben Niveau, wie die Kunst
in der Prähistorie IJ). Hat nun die Kunst der kretisch-mykenischen Epoche einen
überraschend hohen Grad von Reife erreicht, so darf doch nicht übersehen werden,
daß sie ganz in der Ausdrucksweise der primitiven Kunst befangen ist; sie steht
in ihren höchsten Emanationen noch immer französischen
als den ersten Anfängen der klassisch griechischen
Kunst, oder der ägyptischen, der sie doch so vieles
verdankt.
Gerade in der so mühsamen, aber so durchaus folge¬
richtigen und stetigen Entwicklung der griechischen Kunst
können wir den denkbar größten Gegensatz erkennen zur
prähistorischen Kunst, die in der überraschenden Fülle
ihrer Gaben mehr an ein meteorartiges Aufleuchten von
latenten Fähigkeiten erinnert, deren Früchte erst viel
später langsam zur Reife gelangen.
Die symbolische Bedeutung des Auges gehörte, wie
wir sahen, mit zum Requisit jener Anfänge, die in der
kretisch-mykenischen Kunst ihre Blüte erreicht haben;
Kunstepoche ist es aber fremd.
Homer steht an der Schwelle dieser neuen Epoche, der Geist jener vergangenen
fand aber in seinen Gesängen allenthalben begeisterten Nachhall. Vorzügliche Werke
der mykenischen Kunst mag der Dichter noch aus eigener Anschauung gekannt
haben, und zum Ruhme ihres Alters mag sich noch die Bewunderung über technisches
Geschick und sinnfälligen Reiz gesellt haben, der der neuen Epoche noch fremd
war I2). Scheint es da nicht mehr als wahrscheinlich, wenn wir geneigt sind, auch
im homerischen βοώπις einen Nachhall aus längst vergangener Zeit zu vermuten?
Der kretisch-mykenische Kult war, soviel wir sehen können, anikonisch *3); Homer
läßt seine Götter schon in menschlicher Gestalt auftreten. Liegt es da nicht nahe
Höhlenzeichnungen näher
Abb. 4.
Ein mykenischer Becher.
einer vorgeschritteneren
7) Schliemann, Ilios Fig. 204. XI) Levinstein, Untersuchungen über das Zeichnen
8) Schliemann, Ilios Fig. 217. der Kinder bis zum 14. Lebensjahre.
9) Perrot et Chipiez a. a. 0. 807, Fig. 376. I2) Wolfg. Reichel, Homerische Waffen2 146. —
10) J. Capart, Les debuts de l’art en figypte 56 U. v. Wilamowitz-Moellendorff, Die griechische
Fig. 26; S. 78 Fig. 44. Literatur des Altertums, 11.
23) Wolfg. Reichel a. a. 0. 55.
I I
je primitivere Kulturschichten wir schürfen. Allbekannt sind da jene Idole, die
in der Form eines »Garnwickels« wohl die primitivsten Versuche darstellen, die mensch-
liche Gestalt zu versinnbilden 7). Weiter vorgeschrittene Formen lassen aber bereits
das Augenpaar erkennen. Die Augen dienen als Symbol des Intellektes und erheben
gewissermaßen den rohgeformten Klumpen zum Abbild des Menschen * 8 *). Gleich-
falls hierher gehören die Gesichtsvasen, wie sie uns aus Troja II, a. a. 0. bekannt
geworden sind 9). Aber auch die prähistorische Kunst Ägyptens bedient sich ähn-
licher Mittel der Darstellung I0 *), und man kann beobachten, daß sie überhaupt der
Kunst im Stadium der Kindheit eigen sind. Australische Rindenzeichnungen und
Zeichnungen von Kindern stehen ja im Prinzip auf demselben Niveau, wie die Kunst
in der Prähistorie IJ). Hat nun die Kunst der kretisch-mykenischen Epoche einen
überraschend hohen Grad von Reife erreicht, so darf doch nicht übersehen werden,
daß sie ganz in der Ausdrucksweise der primitiven Kunst befangen ist; sie steht
in ihren höchsten Emanationen noch immer französischen
als den ersten Anfängen der klassisch griechischen
Kunst, oder der ägyptischen, der sie doch so vieles
verdankt.
Gerade in der so mühsamen, aber so durchaus folge¬
richtigen und stetigen Entwicklung der griechischen Kunst
können wir den denkbar größten Gegensatz erkennen zur
prähistorischen Kunst, die in der überraschenden Fülle
ihrer Gaben mehr an ein meteorartiges Aufleuchten von
latenten Fähigkeiten erinnert, deren Früchte erst viel
später langsam zur Reife gelangen.
Die symbolische Bedeutung des Auges gehörte, wie
wir sahen, mit zum Requisit jener Anfänge, die in der
kretisch-mykenischen Kunst ihre Blüte erreicht haben;
Kunstepoche ist es aber fremd.
Homer steht an der Schwelle dieser neuen Epoche, der Geist jener vergangenen
fand aber in seinen Gesängen allenthalben begeisterten Nachhall. Vorzügliche Werke
der mykenischen Kunst mag der Dichter noch aus eigener Anschauung gekannt
haben, und zum Ruhme ihres Alters mag sich noch die Bewunderung über technisches
Geschick und sinnfälligen Reiz gesellt haben, der der neuen Epoche noch fremd
war I2). Scheint es da nicht mehr als wahrscheinlich, wenn wir geneigt sind, auch
im homerischen βοώπις einen Nachhall aus längst vergangener Zeit zu vermuten?
Der kretisch-mykenische Kult war, soviel wir sehen können, anikonisch *3); Homer
läßt seine Götter schon in menschlicher Gestalt auftreten. Liegt es da nicht nahe
Höhlenzeichnungen näher
Abb. 4.
Ein mykenischer Becher.
einer vorgeschritteneren
7) Schliemann, Ilios Fig. 204. XI) Levinstein, Untersuchungen über das Zeichnen
8) Schliemann, Ilios Fig. 217. der Kinder bis zum 14. Lebensjahre.
9) Perrot et Chipiez a. a. 0. 807, Fig. 376. I2) Wolfg. Reichel, Homerische Waffen2 146. —
10) J. Capart, Les debuts de l’art en figypte 56 U. v. Wilamowitz-Moellendorff, Die griechische
Fig. 26; S. 78 Fig. 44. Literatur des Altertums, 11.
23) Wolfg. Reichel a. a. 0. 55.