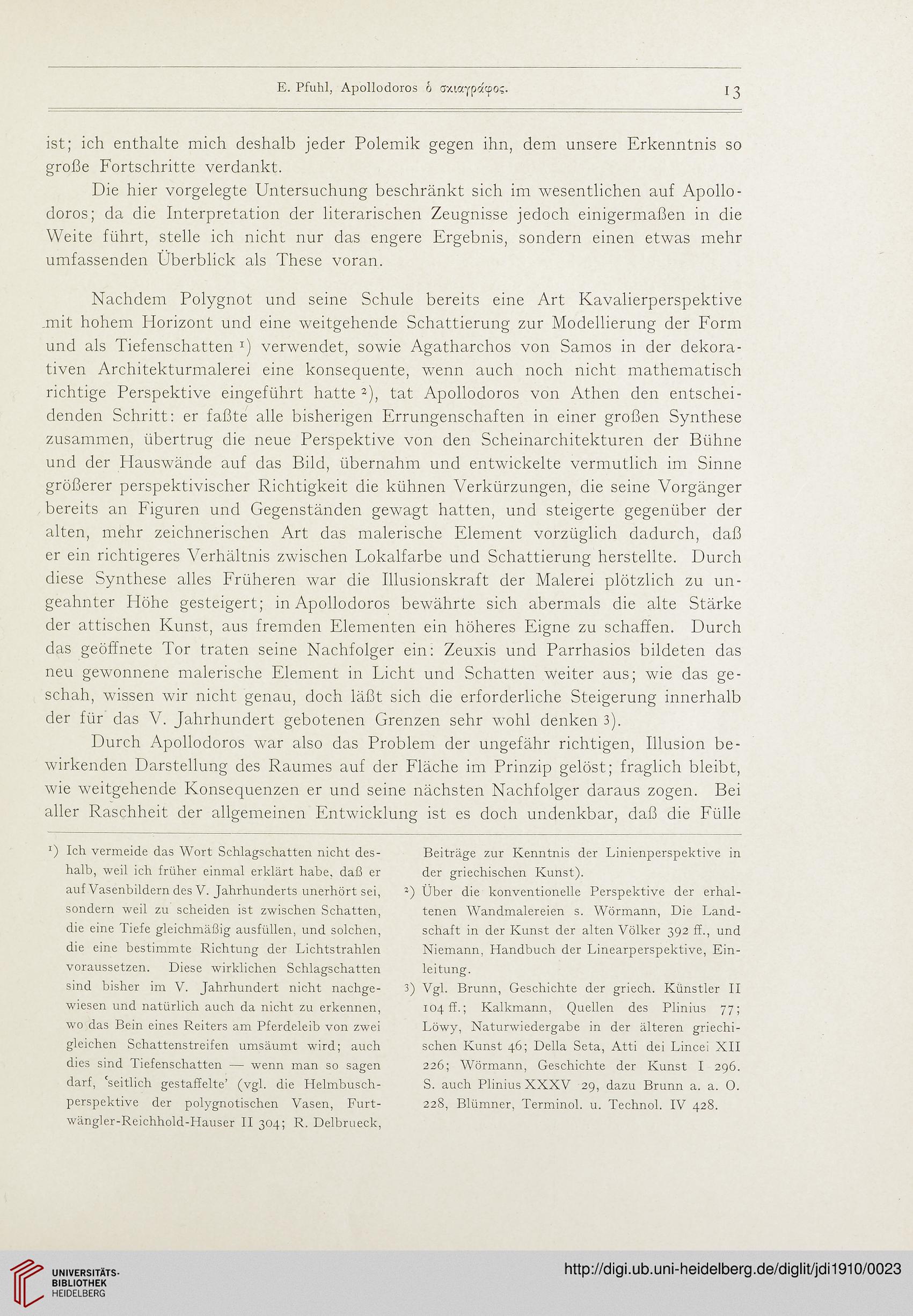E. Pfuhl, Apollodoros ο σκιαγράφος.
ist; ich enthalte mich deshalb jeder Polemik gegen ihn, dem unsere Erkenntnis so
große Fortschritte verdankt.
Die hier vorgelegte Untersuchung beschränkt sich im wesentlichen auf Apollo-
doros; da die Interpretation der literarischen Zeugnisse jedoch einigermaßen in die
Weite führt, stelle ich nicht nur das engere Ergebnis, sondern einen etwas mehr
umfassenden Überblick als These voran.
Nachdem Polygnot und seine Schule bereits eine Art Kavalierperspektive
.mit hohem Horizont und eine weitgehende Schattierung zur Modellierung der Form
und als Tiefenschatten T) verwendet, sowie Agatharchos von Samos in der dekora-
tiven Architekturmalerei eine konsequente, wenn auch noch nicht mathematisch
richtige Perspektive eingeführt hatte 2), tat Apollodoros von Athen den entschei-
denden Schritt: er faßte alle bisherigen Errungenschaften in einer großen Synthese
zusammen, übertrug die neue Perspektive von den Scheinarchitekturen der Bühne
und der Hauswände auf das Bild, übernahm und entwickelte vermutlich im Sinne
größerer perspektivischer Richtigkeit die kühnen Verkürzungen, die seine Vorgänger
bereits an Figuren und Gegenständen gewagt hatten, und steigerte gegenüber der
alten, mehr zeichnerischen Art das malerische Element vorzüglich dadurch, daß
er ein richtigeres Verhältnis zwischen Lokalfarbe und Schattierung herstellte. Durch
diese Synthese alles Früheren war die Illusionskraft der Malerei plötzlich zu un-
geahnter Höhe gesteigert; in Apollodoros bewährte sich abermals die alte Stärke
der attischen Kunst, aus fremden Elementen ein höheres Eigne zu schaffen. Durch
das geöffnete Tor traten seine Nachfolger ein: Zeuxis und Parrhasios bildeten das
neu gewonnene malerische Element in Licht und Schatten weiter aus; wie das ge-
schah, wissen wir nicht genau, doch läßt sich die erforderliche Steigerung innerhalb
der für das V. Jahrhundert gebotenen Grenzen sehr wohl denken 3).
Durch Apollodoros war also das Problem der ungefähr richtigen, Illusion be-
wirkenden Darstellung des Raumes auf der Fläche im Prinzip gelöst; fraglich bleibt,
wie weitgehende Konsequenzen er und seine nächsten Nachfolger daraus zogen. Bei
aller Raschheit der allgemeinen Entwicklung ist es doch undenkbar, daß die Fülle
*) Ich vermeide das Wort Schlagschatten nicht des-
halb, weil ich früher einmal erklärt habe, daß er
auf Vasenbildern des V. Jahrhunderts unerhört sei,
sondern weil zu scheiden ist zwischen Schatten,
die eine Tiefe gleichmäßig ausfüllen, und solchen,
die eine bestimmte Richtung der Lichtstrahlen
voraussetzen. Diese wirklichen Schlagschatten
sind bisher im V. Jahrhundert nicht nachge-
wiesen und natürlich auch da nicht zu erkennen,
wo das Bein eines Reiters am Pferdeleib von zwei
gleichen Schattenstreifen umsäumt wird; auch
dies sind Tiefenschatten — wenn man so sagen
darf, 'seitlich gestaffelte’ (vgl. die Flelmbusch-
perspektive der polygnotischen Vasen, Furt-
wängler-Reichhold-Hauser II 304; R. Delbrueck,
Beiträge zur Kenntnis der Linienperspektive in
der griechischen Kunst).
2) Über die konventionelle Perspektive der erhal-
tenen Wandmalereien s. Wörmann, Die Land-
schaft in der Kunst der alten Völker 392 ff., und
Niemann, Handbuch der Linearperspektive, Ein-
leitung.
3) Vgl. Brunn, Geschichte der griech. Künstler II
104 ff.; Kalkmann, Quellen des Plinius 77;
Löwy, Naturwiedergabe in der älteren griechi-
schen Kunst 46; Della Seta, Atti dei Lincei XII
226; Wörmann, Geschichte der Kunst I 296.
S. auch Plinius XXXV 29, dazu Brunn a. a. 0.
228, Blümner, Terminol. u. Technol. IV 428.
ist; ich enthalte mich deshalb jeder Polemik gegen ihn, dem unsere Erkenntnis so
große Fortschritte verdankt.
Die hier vorgelegte Untersuchung beschränkt sich im wesentlichen auf Apollo-
doros; da die Interpretation der literarischen Zeugnisse jedoch einigermaßen in die
Weite führt, stelle ich nicht nur das engere Ergebnis, sondern einen etwas mehr
umfassenden Überblick als These voran.
Nachdem Polygnot und seine Schule bereits eine Art Kavalierperspektive
.mit hohem Horizont und eine weitgehende Schattierung zur Modellierung der Form
und als Tiefenschatten T) verwendet, sowie Agatharchos von Samos in der dekora-
tiven Architekturmalerei eine konsequente, wenn auch noch nicht mathematisch
richtige Perspektive eingeführt hatte 2), tat Apollodoros von Athen den entschei-
denden Schritt: er faßte alle bisherigen Errungenschaften in einer großen Synthese
zusammen, übertrug die neue Perspektive von den Scheinarchitekturen der Bühne
und der Hauswände auf das Bild, übernahm und entwickelte vermutlich im Sinne
größerer perspektivischer Richtigkeit die kühnen Verkürzungen, die seine Vorgänger
bereits an Figuren und Gegenständen gewagt hatten, und steigerte gegenüber der
alten, mehr zeichnerischen Art das malerische Element vorzüglich dadurch, daß
er ein richtigeres Verhältnis zwischen Lokalfarbe und Schattierung herstellte. Durch
diese Synthese alles Früheren war die Illusionskraft der Malerei plötzlich zu un-
geahnter Höhe gesteigert; in Apollodoros bewährte sich abermals die alte Stärke
der attischen Kunst, aus fremden Elementen ein höheres Eigne zu schaffen. Durch
das geöffnete Tor traten seine Nachfolger ein: Zeuxis und Parrhasios bildeten das
neu gewonnene malerische Element in Licht und Schatten weiter aus; wie das ge-
schah, wissen wir nicht genau, doch läßt sich die erforderliche Steigerung innerhalb
der für das V. Jahrhundert gebotenen Grenzen sehr wohl denken 3).
Durch Apollodoros war also das Problem der ungefähr richtigen, Illusion be-
wirkenden Darstellung des Raumes auf der Fläche im Prinzip gelöst; fraglich bleibt,
wie weitgehende Konsequenzen er und seine nächsten Nachfolger daraus zogen. Bei
aller Raschheit der allgemeinen Entwicklung ist es doch undenkbar, daß die Fülle
*) Ich vermeide das Wort Schlagschatten nicht des-
halb, weil ich früher einmal erklärt habe, daß er
auf Vasenbildern des V. Jahrhunderts unerhört sei,
sondern weil zu scheiden ist zwischen Schatten,
die eine Tiefe gleichmäßig ausfüllen, und solchen,
die eine bestimmte Richtung der Lichtstrahlen
voraussetzen. Diese wirklichen Schlagschatten
sind bisher im V. Jahrhundert nicht nachge-
wiesen und natürlich auch da nicht zu erkennen,
wo das Bein eines Reiters am Pferdeleib von zwei
gleichen Schattenstreifen umsäumt wird; auch
dies sind Tiefenschatten — wenn man so sagen
darf, 'seitlich gestaffelte’ (vgl. die Flelmbusch-
perspektive der polygnotischen Vasen, Furt-
wängler-Reichhold-Hauser II 304; R. Delbrueck,
Beiträge zur Kenntnis der Linienperspektive in
der griechischen Kunst).
2) Über die konventionelle Perspektive der erhal-
tenen Wandmalereien s. Wörmann, Die Land-
schaft in der Kunst der alten Völker 392 ff., und
Niemann, Handbuch der Linearperspektive, Ein-
leitung.
3) Vgl. Brunn, Geschichte der griech. Künstler II
104 ff.; Kalkmann, Quellen des Plinius 77;
Löwy, Naturwiedergabe in der älteren griechi-
schen Kunst 46; Della Seta, Atti dei Lincei XII
226; Wörmann, Geschichte der Kunst I 296.
S. auch Plinius XXXV 29, dazu Brunn a. a. 0.
228, Blümner, Terminol. u. Technol. IV 428.