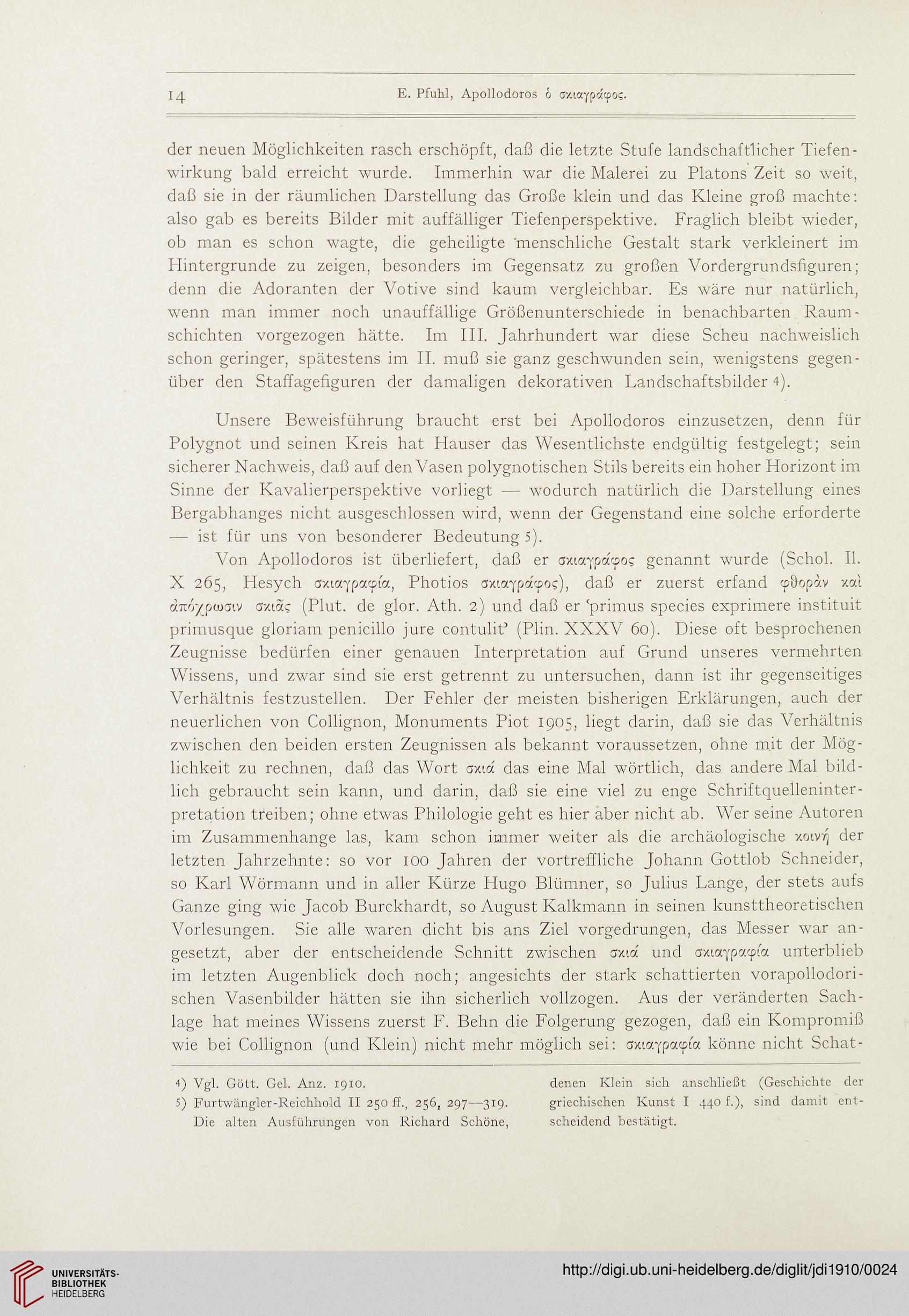14 E. Pfuhl, Apollodoros ό σκιαγράφος.
der neuen Möglichkeiten rasch erschöpft, daß die letzte Stufe landschaftlicher Tiefen-
wirkung bald erreicht wurde. Immerhin war die Malerei zu Platons Zeit so weit,
daß sie in der räumlichen Darstellung das Große klein und das Kleine groß machte:
also gab es bereits Bilder mit auffälliger Tiefenperspektive. Fraglich bleibt wieder,
ob man es schon wagte, die geheiligte 'menschliche Gestalt stark verkleinert im
Hintergründe zu zeigen, besonders im Gegensatz zu großen Vordergrundsfiguren;
denn die Adoranten der Votive sind kaum vergleichbar. Es wäre nur natürlich,
wenn man immer noch unauffällige Größenunterschiede in benachbarten Raum-
schichten vorgezogen hätte. Im III. Jahrhundert war diese Scheu nachweislich
schon geringer, spätestens im II. muß sie ganz geschwunden sein, wenigstens gegen-
über den Staffagefiguren der damaligen dekorativen Landschaftsbilder 4).
Unsere Beweisführung braucht erst bei Apollodoros einzusetzen, denn für
Polygnot und seinen Kreis hat Hauser das Wesentlichste endgültig festgelegt; sein
sicherer Nachweis, daß auf den Vasen polygnotischen Stils bereits ein hoher Horizont im
Sinne der Kavalierperspektive vorliegt — wodurch natürlich die Darstellung eines
Bergabhanges nicht ausgeschlossen wird, wenn der Gegenstand eine solche erforderte
— ist für uns von besonderer Bedeutung 5).
Von Apollodoros ist überliefert, daß er σκιαγράφος genannt wurde (Schol. II.
X 265, Idesych σκιαγραφία, Photios σκιαγράφος), daß er zuerst erfand φθοράν και
άπόχρωσιν σκιάς (Plut. de glor. Ath. 2) und daß er ‘primus species exprimere instituit
primusque gloriam penicillo jure contulit’ (Plin. XXXV 60). Diese oft besprochenen
Zeugnisse bedürfen einer genauen Interpretation auf Grund unseres vermehrten
Wissens, und zwar sind sie erst getrennt zu untersuchen, dann ist ihr gegenseitiges
Verhältnis festzustellen. Der Fehler der meisten bisherigen Erklärungen, auch der
neuerlichen von Collignon, Monuments Piot 1905, liegt darin, daß sie das Verhältnis
zwischen den beiden ersten Zeugnissen als bekannt voraussetzen, ohne m.it der Mög-
lichkeit zu rechnen, daß das Wort σκιά das eine Mal wörtlich, das andere Mal bild-
lich gebraucht sein kann, und darin, daß sie eine viel zu enge Schriftquelleninter-
pretation treiben; ohne etwas Philologie geht es hier aber nicht ab. Wer seine Autoren
im Zusammenhänge las, kam schon immer weiter als die archäologische κοινή der
letzten Jahrzehnte: so vor 100 Jahren der vortreffliche Johann Gottlob Schneider,
so Karl Wörmann und in aller Kürze Hugo Blümner, so Julius Lange, der stets aufs
Ganze ging wie Jacob Burckhardt, so August Kalkmann in seinen kunsttheoretischen
Vorlesungen. Sie alle waren dicht bis ans Ziel vorgedrungen, das Messer war an-
gesetzt, aber der entscheidende Schnitt zwischen σκιά und σκιαγραφία unterblieb
im letzten Augenblick doch noch; angesichts der stark schattierten vorapollodori-
schen Vasenbilder hätten sie ihn sicherlich vollzogen. Aus der veränderten Sach-
lage hat meines Wissens zuerst F. Behn die Folgerung gezogen, daß ein Kompromiß
wie bei Collignon (und Klein) nicht mehr möglich sei: σκιαγραφία könne nicht Schat-
4) Vgt Gött. Gel. Anz. 1910. denen Klein sich anschließt (Geschichte der
5) Furtwängler-Reichhold II 250 ff., 256, 297—319. griechischen Kunst I 440 f.), sind damit ent-
Die alten Ausführungen von Richard Schöne, scheidend bestätigt.
der neuen Möglichkeiten rasch erschöpft, daß die letzte Stufe landschaftlicher Tiefen-
wirkung bald erreicht wurde. Immerhin war die Malerei zu Platons Zeit so weit,
daß sie in der räumlichen Darstellung das Große klein und das Kleine groß machte:
also gab es bereits Bilder mit auffälliger Tiefenperspektive. Fraglich bleibt wieder,
ob man es schon wagte, die geheiligte 'menschliche Gestalt stark verkleinert im
Hintergründe zu zeigen, besonders im Gegensatz zu großen Vordergrundsfiguren;
denn die Adoranten der Votive sind kaum vergleichbar. Es wäre nur natürlich,
wenn man immer noch unauffällige Größenunterschiede in benachbarten Raum-
schichten vorgezogen hätte. Im III. Jahrhundert war diese Scheu nachweislich
schon geringer, spätestens im II. muß sie ganz geschwunden sein, wenigstens gegen-
über den Staffagefiguren der damaligen dekorativen Landschaftsbilder 4).
Unsere Beweisführung braucht erst bei Apollodoros einzusetzen, denn für
Polygnot und seinen Kreis hat Hauser das Wesentlichste endgültig festgelegt; sein
sicherer Nachweis, daß auf den Vasen polygnotischen Stils bereits ein hoher Horizont im
Sinne der Kavalierperspektive vorliegt — wodurch natürlich die Darstellung eines
Bergabhanges nicht ausgeschlossen wird, wenn der Gegenstand eine solche erforderte
— ist für uns von besonderer Bedeutung 5).
Von Apollodoros ist überliefert, daß er σκιαγράφος genannt wurde (Schol. II.
X 265, Idesych σκιαγραφία, Photios σκιαγράφος), daß er zuerst erfand φθοράν και
άπόχρωσιν σκιάς (Plut. de glor. Ath. 2) und daß er ‘primus species exprimere instituit
primusque gloriam penicillo jure contulit’ (Plin. XXXV 60). Diese oft besprochenen
Zeugnisse bedürfen einer genauen Interpretation auf Grund unseres vermehrten
Wissens, und zwar sind sie erst getrennt zu untersuchen, dann ist ihr gegenseitiges
Verhältnis festzustellen. Der Fehler der meisten bisherigen Erklärungen, auch der
neuerlichen von Collignon, Monuments Piot 1905, liegt darin, daß sie das Verhältnis
zwischen den beiden ersten Zeugnissen als bekannt voraussetzen, ohne m.it der Mög-
lichkeit zu rechnen, daß das Wort σκιά das eine Mal wörtlich, das andere Mal bild-
lich gebraucht sein kann, und darin, daß sie eine viel zu enge Schriftquelleninter-
pretation treiben; ohne etwas Philologie geht es hier aber nicht ab. Wer seine Autoren
im Zusammenhänge las, kam schon immer weiter als die archäologische κοινή der
letzten Jahrzehnte: so vor 100 Jahren der vortreffliche Johann Gottlob Schneider,
so Karl Wörmann und in aller Kürze Hugo Blümner, so Julius Lange, der stets aufs
Ganze ging wie Jacob Burckhardt, so August Kalkmann in seinen kunsttheoretischen
Vorlesungen. Sie alle waren dicht bis ans Ziel vorgedrungen, das Messer war an-
gesetzt, aber der entscheidende Schnitt zwischen σκιά und σκιαγραφία unterblieb
im letzten Augenblick doch noch; angesichts der stark schattierten vorapollodori-
schen Vasenbilder hätten sie ihn sicherlich vollzogen. Aus der veränderten Sach-
lage hat meines Wissens zuerst F. Behn die Folgerung gezogen, daß ein Kompromiß
wie bei Collignon (und Klein) nicht mehr möglich sei: σκιαγραφία könne nicht Schat-
4) Vgt Gött. Gel. Anz. 1910. denen Klein sich anschließt (Geschichte der
5) Furtwängler-Reichhold II 250 ff., 256, 297—319. griechischen Kunst I 440 f.), sind damit ent-
Die alten Ausführungen von Richard Schöne, scheidend bestätigt.