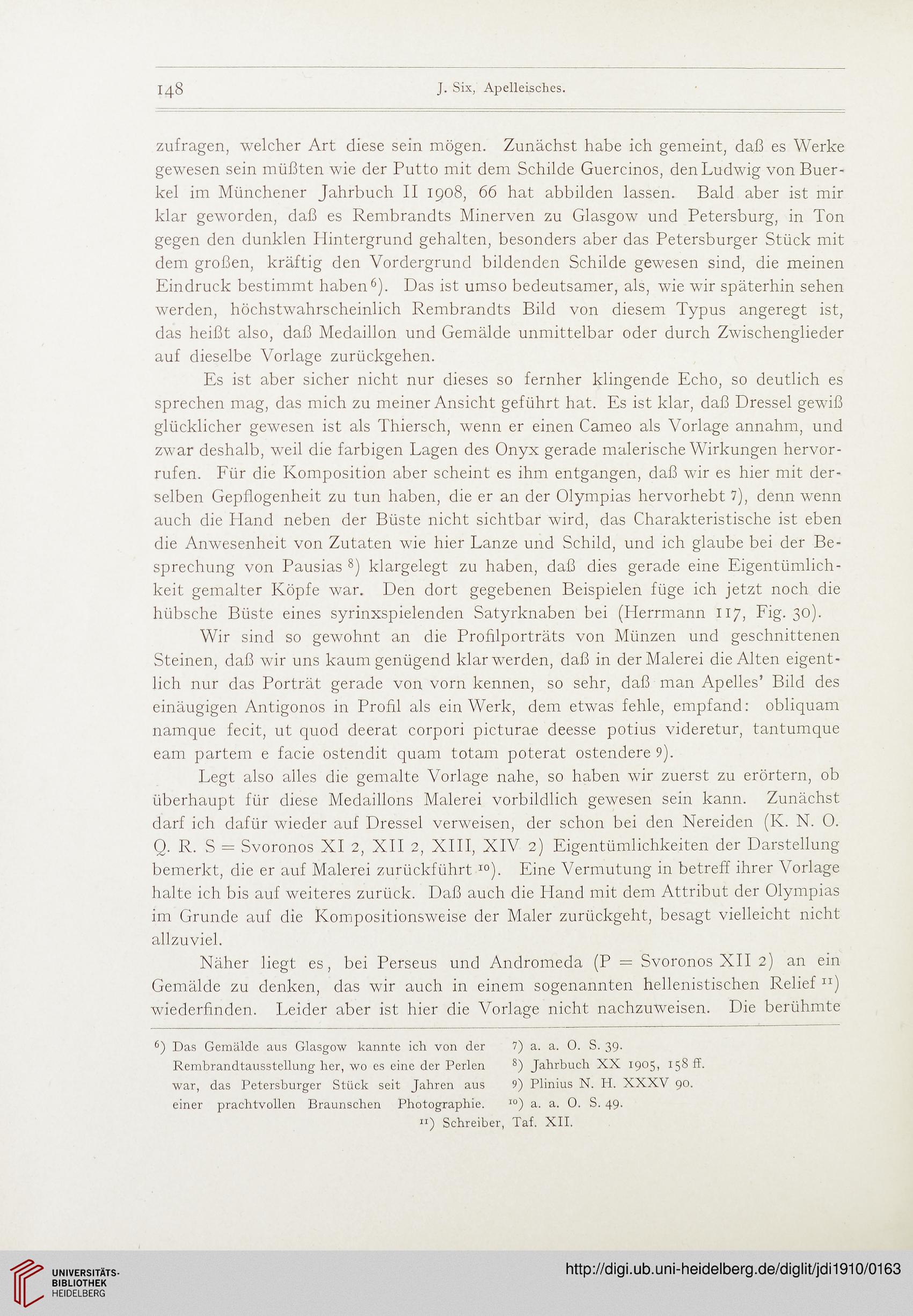148
J. Six, Apelleisches.
zufragen, welcher Art diese sein mögen. Zunächst habe ich gemeint, daß es Werke
gewesen sein müßten wie der Putto mit dem Schilde Guercinos, den Ludwig von Buer-
kel im Münchener Jahrbuch II 1908, 66 hat abbilden lassen. Bald aber ist mir
klar geworden, daß es Rembrandts Minerven zu Glasgow und Petersburg, in Ton
gegen den dunklen Hintergrund gehalten, besonders aber das Petersburger Stück mit
dem großen, kräftig den Vordergrund bildenden Schilde gewesen sind, die meinen
Eindruck bestimmt haben6 *). Das ist umso bedeutsamer, als, wie wir späterhin sehen
werden, höchstwahrscheinlich Rembrandts Bild von diesem Typus angeregt ist,
das heißt also, daß Medaillon und Gemälde unmittelbar oder durch Zwischenglieder
auf dieselbe Vorlage zurückgehen.
Es ist aber sicher nicht nur dieses so fernher klingende Echo, so deutlich es
sprechen mag, das mich zu meiner Ansicht geführt hat. Es ist klar, daß Dressel gewiß
glücklicher gewesen ist als Thiersch, wenn er einen Cameo als Vorlage annahm, und
zwar deshalb, weil die farbigen Lagen des Onyx gerade malerische Wirkungen hervor-
rufen. Für die Komposition aber scheint es ihm entgangen, daß wir es hier mit der-
selben Gepflogenheit zu tun haben, die er an der Olympias hervorhebt 7), denn wenn
auch die Pland neben der Büste nicht sichtbar wird, das Charakteristische ist eben
die Anwesenheit von Zutaten wie hier Lanze und Schild, und ich glaube bei der Be-
sprechung von Pausias 8 *) klargelegt zu haben, daß dies gerade eine Eigentümlich-
keit gemalter Köpfe war. Den dort gegebenen Beispielen füge ich jetzt noch die
hübsche Büste eines syrinxspielenden Satyrknaben bei (Herrmann 117, Fig. 30).
Wir sind so gewohnt an die Profilporträts von Münzen und geschnittenen
Steinen, daß wir uns kaum genügend klar werden, daß in der Malerei die Alten eigent-
lich nur das Porträt gerade von vorn kennen, so sehr, daß man Apelles’ Bild des
einäugigen Antigonos in Profil als ein Werk, dem etwas fehle, empfand: obliquam
namque fecit, ut quod cleerat corpori picturae deesse potius videretur, tantumque
eam partem e facie ostendit quam totam poterat ostendere 9).
Legt also alles die gemalte Vorlage nahe, so haben wir zuerst zu erörtern, ob
überhaupt für diese Medaillons Malerei vorbildlich gewesen sein kann. Zunächst
darf ich dafür wieder auf Dressel verweisen, der schon bei den Nereiden (K. N. 0.
Q. R. S = Svoronos XI 2, XII 2, XIII, XIV 2) Eigentümlichkeiten der Darstellung
bemerkt, die er auf Malerei zurückführt I0). Eine Vermutung in betreff ihrer ÄMrlage
halte ich bis auf weiteres zurück. Daß auch die Idand mit dem Attribut der Olympias
im Grunde auf die Kompositionsweise der Maler zurückgeht, besagt vielleicht nicht
allzuviel.
Näher liegt es, bei Perseus und Andromeda (P — Svoronos XII 2) an ein
Gemälde zu denken, das wir auch in einem sogenannten hellenistischen Relief n)
wiederfinden. Leider aber ist hier die Vorlage nicht nachzuweisen. Die berühmte
6) Das Gemälde aus Glasgow kannte ich von der
Rembrandtausstellung her, wo es eine der Perlen
war, das Petersburger Stück seit Jahren aus
einer prachtvollen Braunschen Photographie.
7) a. a. 0. S. 39.
8) Jahrbuch XX 1905, 158 ff.
9) Plinius N. Η. XXXV 90.
10) a. a. 0. S. 49.
Ir) Schreiber, Taf. XII.
J. Six, Apelleisches.
zufragen, welcher Art diese sein mögen. Zunächst habe ich gemeint, daß es Werke
gewesen sein müßten wie der Putto mit dem Schilde Guercinos, den Ludwig von Buer-
kel im Münchener Jahrbuch II 1908, 66 hat abbilden lassen. Bald aber ist mir
klar geworden, daß es Rembrandts Minerven zu Glasgow und Petersburg, in Ton
gegen den dunklen Hintergrund gehalten, besonders aber das Petersburger Stück mit
dem großen, kräftig den Vordergrund bildenden Schilde gewesen sind, die meinen
Eindruck bestimmt haben6 *). Das ist umso bedeutsamer, als, wie wir späterhin sehen
werden, höchstwahrscheinlich Rembrandts Bild von diesem Typus angeregt ist,
das heißt also, daß Medaillon und Gemälde unmittelbar oder durch Zwischenglieder
auf dieselbe Vorlage zurückgehen.
Es ist aber sicher nicht nur dieses so fernher klingende Echo, so deutlich es
sprechen mag, das mich zu meiner Ansicht geführt hat. Es ist klar, daß Dressel gewiß
glücklicher gewesen ist als Thiersch, wenn er einen Cameo als Vorlage annahm, und
zwar deshalb, weil die farbigen Lagen des Onyx gerade malerische Wirkungen hervor-
rufen. Für die Komposition aber scheint es ihm entgangen, daß wir es hier mit der-
selben Gepflogenheit zu tun haben, die er an der Olympias hervorhebt 7), denn wenn
auch die Pland neben der Büste nicht sichtbar wird, das Charakteristische ist eben
die Anwesenheit von Zutaten wie hier Lanze und Schild, und ich glaube bei der Be-
sprechung von Pausias 8 *) klargelegt zu haben, daß dies gerade eine Eigentümlich-
keit gemalter Köpfe war. Den dort gegebenen Beispielen füge ich jetzt noch die
hübsche Büste eines syrinxspielenden Satyrknaben bei (Herrmann 117, Fig. 30).
Wir sind so gewohnt an die Profilporträts von Münzen und geschnittenen
Steinen, daß wir uns kaum genügend klar werden, daß in der Malerei die Alten eigent-
lich nur das Porträt gerade von vorn kennen, so sehr, daß man Apelles’ Bild des
einäugigen Antigonos in Profil als ein Werk, dem etwas fehle, empfand: obliquam
namque fecit, ut quod cleerat corpori picturae deesse potius videretur, tantumque
eam partem e facie ostendit quam totam poterat ostendere 9).
Legt also alles die gemalte Vorlage nahe, so haben wir zuerst zu erörtern, ob
überhaupt für diese Medaillons Malerei vorbildlich gewesen sein kann. Zunächst
darf ich dafür wieder auf Dressel verweisen, der schon bei den Nereiden (K. N. 0.
Q. R. S = Svoronos XI 2, XII 2, XIII, XIV 2) Eigentümlichkeiten der Darstellung
bemerkt, die er auf Malerei zurückführt I0). Eine Vermutung in betreff ihrer ÄMrlage
halte ich bis auf weiteres zurück. Daß auch die Idand mit dem Attribut der Olympias
im Grunde auf die Kompositionsweise der Maler zurückgeht, besagt vielleicht nicht
allzuviel.
Näher liegt es, bei Perseus und Andromeda (P — Svoronos XII 2) an ein
Gemälde zu denken, das wir auch in einem sogenannten hellenistischen Relief n)
wiederfinden. Leider aber ist hier die Vorlage nicht nachzuweisen. Die berühmte
6) Das Gemälde aus Glasgow kannte ich von der
Rembrandtausstellung her, wo es eine der Perlen
war, das Petersburger Stück seit Jahren aus
einer prachtvollen Braunschen Photographie.
7) a. a. 0. S. 39.
8) Jahrbuch XX 1905, 158 ff.
9) Plinius N. Η. XXXV 90.
10) a. a. 0. S. 49.
Ir) Schreiber, Taf. XII.