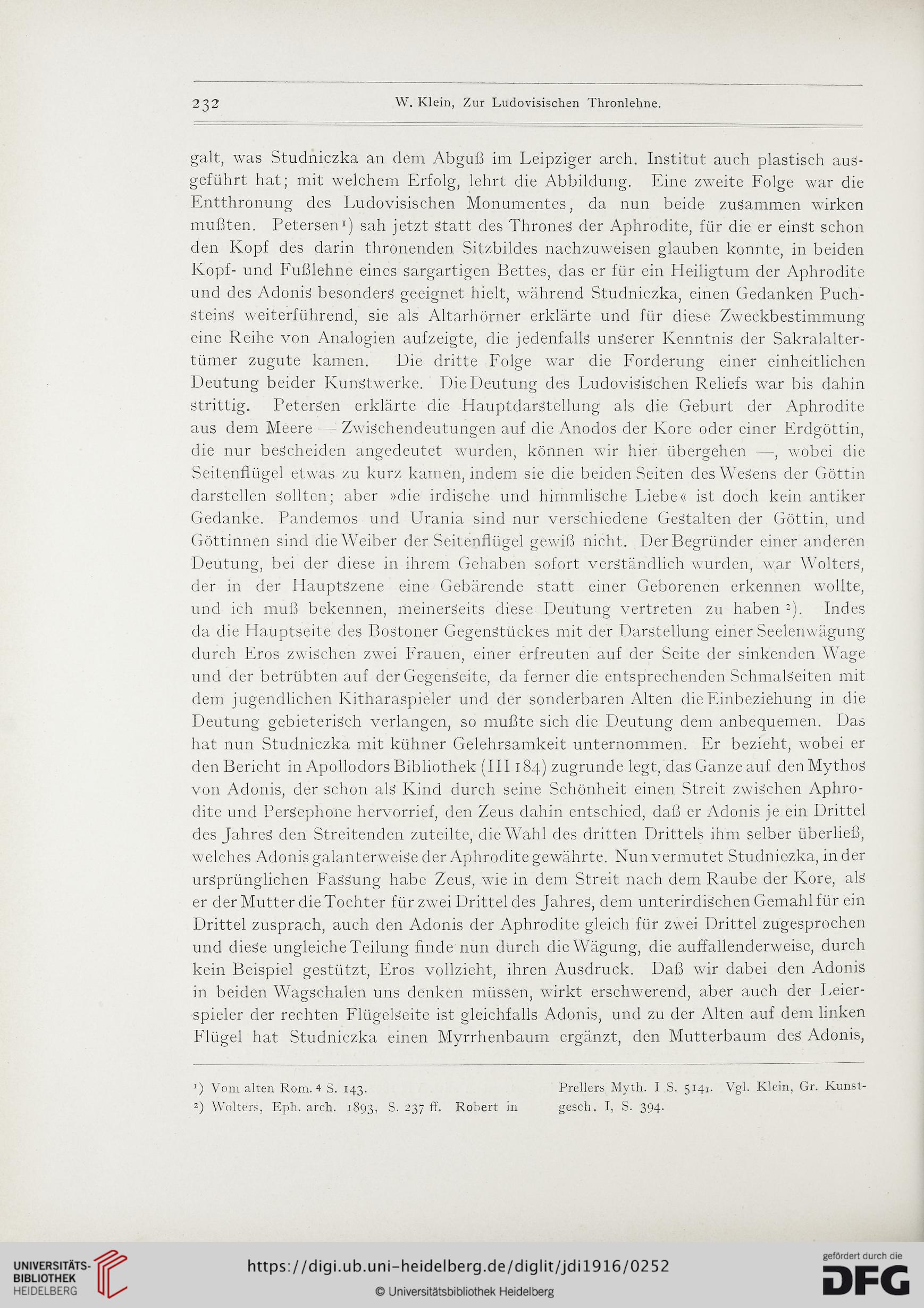232
W. Klein, Zur Ludovisischen Thronlehne.
galt, was Studniczka an dem. Abguß im Leipziger arch. Institut auch plastisch auf-
geführt hat; mit welchem Erfolg, lehrt die Abbildung. Eine zweite Folge war die
Entthronung des Ludovisischen Monumentes, da nun beide zusammen wirken
mußten. Petersen1) sah jetzt Statt des Thrones der Aphrodite, für die er einst schon
den Kopf des darin thronenden Sitzbildes nachzuweisen glauben konnte, in beiden
Kopf- und Fußlehne eines sargartigen Bettes, das er für ein Heiligtum der Aphrodite
und des Adonis besonders geeignet hielt, während Studniczka, einen Gedanken Puch-
Steins' weiterführend, sie als Altarhörner erklärte und für diese Zweckbestimmung
eine Reihe von Analogien aufzeigte, die jedenfalls unserer Kenntnis der Sakralalter-
tümer zugute kamen. Die dritte Folge war die Forderung einer einheitlichen
Deutung beider Kunstwerke. Die Deutung des Ludovisischen Reliefs war bis dahin
Strittig. PeterSen erklärte die Hauptdarstellung als die Geburt der Aphrodite
aus dem Meere — Zwischendeutungen auf die Anodos der Kore oder einer Erdgöttin,
die nur bescheiden angedeutet wurden, können wir hier übergehen —, wobei die
Seitenflügel etwas zu kurz kamen, indem sie die beiden Seiten des Wes'ens der Göttin
darstellen Sollten; aber »die irdische und himmlische Liebe« ist doch kein antiker
Gedanke. Pandemos und Urania sind nur verschiedene Gestalten der Göttin, und
Göttinnen sind die Weiber der Seitenflügel gewiß nicht. Der Begründer einer anderen
Deutung, bei der diese in ihrem Gehaben sofort verständlich wurden, war Wolters,
der in der HauptSzene eine Gebärende statt einer Geborenen erkennen wollte,
und ich muß bekennen, meinerseits diese Deutung vertreten zu haben -). Indes
da die Hauptseite des Bostoner Gegenstückes mit der Darstellung einer Seelenwägung
durch Eros zwischen zwei Frauen, einer erfreuten auf der Seite der sinkenden Wage
und der betrübten auf der Gegenseite, da ferner die entsprechenden Schmalseiten mit
dem jugendlichen Kitharaspieler und der sonderbaren Alten die Einbeziehung in die
Deutung gebieterisch verlangen, so mußte sich die Deutung dem anbequemen. Das
hat nun Studniczka mit kühner Gelehrsamkeit unternommen. Er bezieht, wobei er
den Bericht in Apollodors Bibliothek (III184) zugrunde legt, das Ganze auf denMythoS
von Adonis, der schon als Kind durch seine Schönheit einen Streit zwischen Aphro-
dite und Persephone hervorrief, den Zeus dahin entschied, daß er Adonis je ein Drittel
des Jahres den Streitenden zuteilte, die Wahl des dritten Drittels ihm selber überließ,
welches Adonis galanterweise der Aphrodite gewährte. Nun vermutet Studniczka, in der
ursprünglichen Fassung habe ZeuS, wie in dem Streit nach dem Raube der Kore, als
er der Mutter die Tochter für zwei Drittel des Jahres, dem unterirdischen Gemahl für ein
Drittel zusprach, auch den Adonis der Aphrodite gleich für zwei Drittel zugesprochen
und diese ungleiche Teilung finde nun durch die Wägung, die auffallenderweise, durch
kein Beispiel gestützt, Eros vollzieht, ihren Ausdruck. Daß wir dabei den Adonis
in beiden Wagschalen uns denken müssen, wirkt erschwerend, aber auch der Leier-
spieler der rechten Flügelseite ist gleichfalls Adonis, und zu der Alten auf dem linken
Flügel hat Studniczka einen Myrrhenbaum ergänzt, den Mutterbaum deS Adonis,
Vom alten Rom. 4 S. 143.
2) Wolters, Eph. arch. 1893, S. 237 ff. Robert in
Prellers Myth. I S. 5141· Vgl. Klein, Gr. Kunst-
gesch. I, S. 394.
W. Klein, Zur Ludovisischen Thronlehne.
galt, was Studniczka an dem. Abguß im Leipziger arch. Institut auch plastisch auf-
geführt hat; mit welchem Erfolg, lehrt die Abbildung. Eine zweite Folge war die
Entthronung des Ludovisischen Monumentes, da nun beide zusammen wirken
mußten. Petersen1) sah jetzt Statt des Thrones der Aphrodite, für die er einst schon
den Kopf des darin thronenden Sitzbildes nachzuweisen glauben konnte, in beiden
Kopf- und Fußlehne eines sargartigen Bettes, das er für ein Heiligtum der Aphrodite
und des Adonis besonders geeignet hielt, während Studniczka, einen Gedanken Puch-
Steins' weiterführend, sie als Altarhörner erklärte und für diese Zweckbestimmung
eine Reihe von Analogien aufzeigte, die jedenfalls unserer Kenntnis der Sakralalter-
tümer zugute kamen. Die dritte Folge war die Forderung einer einheitlichen
Deutung beider Kunstwerke. Die Deutung des Ludovisischen Reliefs war bis dahin
Strittig. PeterSen erklärte die Hauptdarstellung als die Geburt der Aphrodite
aus dem Meere — Zwischendeutungen auf die Anodos der Kore oder einer Erdgöttin,
die nur bescheiden angedeutet wurden, können wir hier übergehen —, wobei die
Seitenflügel etwas zu kurz kamen, indem sie die beiden Seiten des Wes'ens der Göttin
darstellen Sollten; aber »die irdische und himmlische Liebe« ist doch kein antiker
Gedanke. Pandemos und Urania sind nur verschiedene Gestalten der Göttin, und
Göttinnen sind die Weiber der Seitenflügel gewiß nicht. Der Begründer einer anderen
Deutung, bei der diese in ihrem Gehaben sofort verständlich wurden, war Wolters,
der in der HauptSzene eine Gebärende statt einer Geborenen erkennen wollte,
und ich muß bekennen, meinerseits diese Deutung vertreten zu haben -). Indes
da die Hauptseite des Bostoner Gegenstückes mit der Darstellung einer Seelenwägung
durch Eros zwischen zwei Frauen, einer erfreuten auf der Seite der sinkenden Wage
und der betrübten auf der Gegenseite, da ferner die entsprechenden Schmalseiten mit
dem jugendlichen Kitharaspieler und der sonderbaren Alten die Einbeziehung in die
Deutung gebieterisch verlangen, so mußte sich die Deutung dem anbequemen. Das
hat nun Studniczka mit kühner Gelehrsamkeit unternommen. Er bezieht, wobei er
den Bericht in Apollodors Bibliothek (III184) zugrunde legt, das Ganze auf denMythoS
von Adonis, der schon als Kind durch seine Schönheit einen Streit zwischen Aphro-
dite und Persephone hervorrief, den Zeus dahin entschied, daß er Adonis je ein Drittel
des Jahres den Streitenden zuteilte, die Wahl des dritten Drittels ihm selber überließ,
welches Adonis galanterweise der Aphrodite gewährte. Nun vermutet Studniczka, in der
ursprünglichen Fassung habe ZeuS, wie in dem Streit nach dem Raube der Kore, als
er der Mutter die Tochter für zwei Drittel des Jahres, dem unterirdischen Gemahl für ein
Drittel zusprach, auch den Adonis der Aphrodite gleich für zwei Drittel zugesprochen
und diese ungleiche Teilung finde nun durch die Wägung, die auffallenderweise, durch
kein Beispiel gestützt, Eros vollzieht, ihren Ausdruck. Daß wir dabei den Adonis
in beiden Wagschalen uns denken müssen, wirkt erschwerend, aber auch der Leier-
spieler der rechten Flügelseite ist gleichfalls Adonis, und zu der Alten auf dem linken
Flügel hat Studniczka einen Myrrhenbaum ergänzt, den Mutterbaum deS Adonis,
Vom alten Rom. 4 S. 143.
2) Wolters, Eph. arch. 1893, S. 237 ff. Robert in
Prellers Myth. I S. 5141· Vgl. Klein, Gr. Kunst-
gesch. I, S. 394.