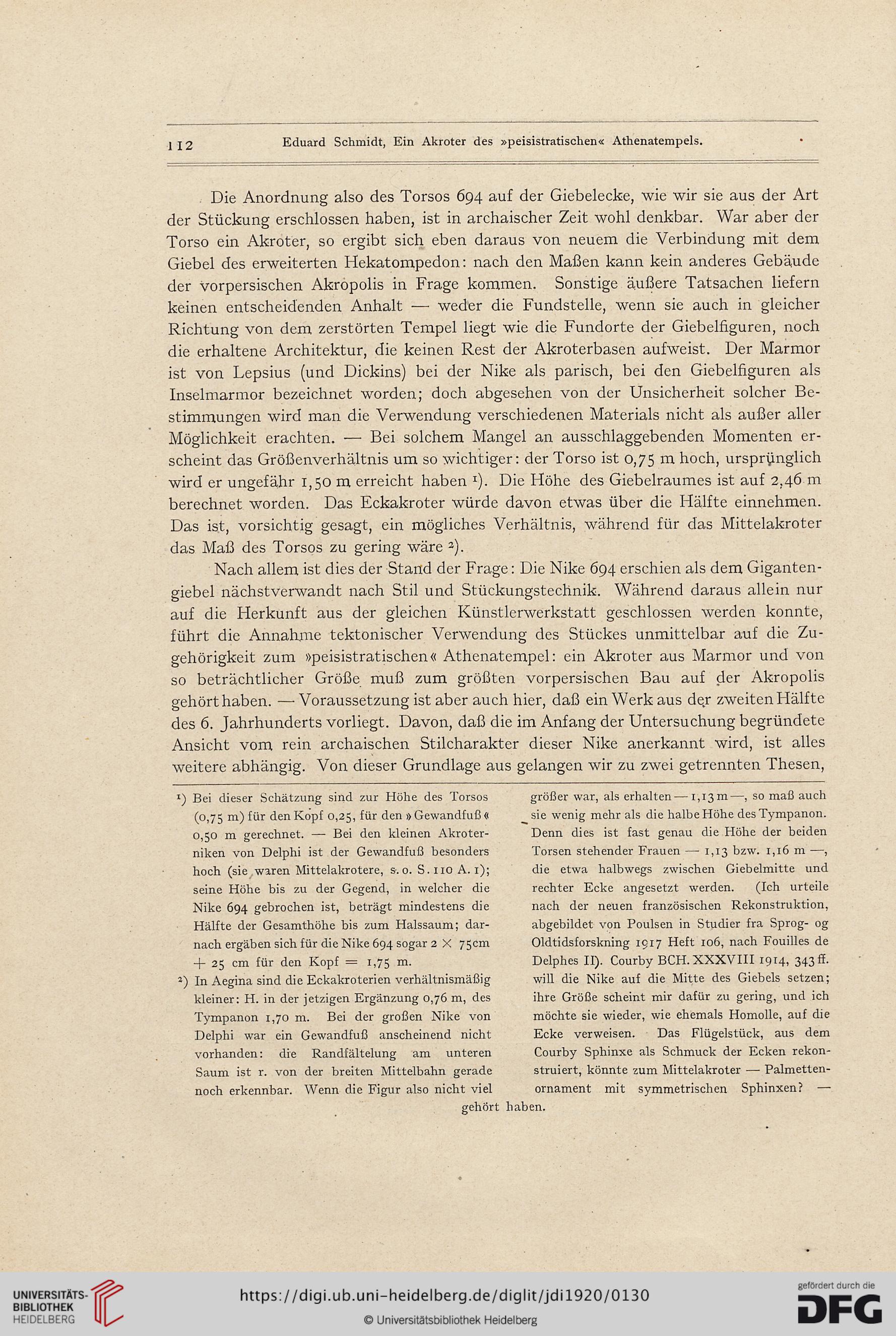1 12
Eduard Schmidt, Ein Akroter des »peisistratischen« Athenatempels.
Die Anordnung also des Torsos 694 auf der Giebelecke, wie wir sie aus der Art
der Stückung erschlossen haben, ist in archaischer Zeit wohl denkbar. War aber der
Torso ein Akroter, so ergibt sich eben daraus von neuem die Verbindung mit dem
Giebel des erweiterten Hekatompedon: nach den Maßen kann kein anderes Gebäude
der vorpersischen Akropolis in Frage kommen. Sonstige äußere Tatsachen liefern
keinen entscheidenden Anhalt — weder die Fundstelle, wenn sie auch in gleicher
Richtung von dem zerstörten Tempel liegt wie die Fundorte der Giebelfiguren, noch
die erhaltene Architektur, die keinen Rest der Akroterbasen aufweist. Der Marmor
ist von Lepsius (und Dickins) bei der Nike als parisch, bei den Giebelfiguren als
Inselmarmor bezeichnet worden; doch abgesehen von der Unsicherheit solcher Be-
stimmungen wird man die Verwendung verschiedenen Materials nicht als außer aller
Möglichkeit erachten. — Bei solchem Mangel an ausschlaggebenden Momenten er-
scheint das Größenverhältnis um so wichtiger: der Torso ist 0,75 m hoch, ursprünglich
wird er ungefähr 1,50 m erreicht haben I). Die Höhe des Giebclraumes ist auf 2,46 m
berechnet worden. Das Eckakroter würde davon etwas über die Hälfte einnehmen.
Das ist, vorsichtig gesagt, ein mögliches Verhältnis, während für das Mittelakroter
das Maß des Torsos zu gering wäre 3).
Nach allem ist dies der Stand der Frage: Die Nike 694 erschien als dem Giganten-
giebel nächstverwandt nach Stil und Stückungstechnik. Während daraus allein nur
auf die Herkunft aus der gleichen Künstlerwerkstatt geschlossen werden konnte,
führt die Annahme tektonischer Verwendung des Stückes unmittelbar auf die Zu-
gehörigkeit zum »peisistratischen« Athenatempel: ein Akroter aus Marmor und von
so beträchtlicher Größe muß zum größten vorpersischen Bau auf der Akropolis
gehört haben. —- Voraussetzung ist aber auch hier, daß ein Werk aus der zweiten Hälfte
des 6. Jahrhunderts vorliegt. Davon, daß die im Anfang der Untersuchung begründete
Ansicht vom rein archaischen Stilcharakter dieser Nike anerkannt wird, ist alles
weitere abhängig. Von dieser Grundlage aus gelangen wir zu zwei getrennten Thesen,
*) Bei dieser Schätzung sind zur Höhe des Torsos
(0,75 m) für den Kopf 0,25, für den » Gewandfuß «
0,50 m gerechnet. — Bei den kleinen Akroter-
niken von Delphi ist der Gewandfuß besonders
hoch (sie waren Mittelakrotere, s.0. S. 110 A. 1);
seine Höhe bis zu der Gegend, in welcher die
Nike 694 gebrochen ist, beträgt mindestens die
Hälfte der Gesamthöhe bis zum Halssaum; dar-
nach ergäben sich für die Nike 694 sogar 2 X 75cm
+ 25 cm für den Kopf = 1,75 m.
2") In Aegina sind die Eckakroterien verhältnismäßig
kleiner: H. in der jetzigen Ergänzung 0,76 m, des
Tympanon 1,70 m. Bei der großen Nike von
Delphi war ein Gewandfuß anscheinend nicht
vorhanden: die Randfältelung am unteren
Saum ist r. von der breiten Mittelbahn gerade
noch erkennbar. Wenn die Figur also nicht viel
gehört
größer war, als erhalten — 1,13 m—, so maß auch
sie wenig mehr als die halbe Höhe des Tympanon.
Denn dies ist fast genau die Höhe der beiden
Torsen stehender Frauen — 1,13 bzw. 1,16 m —,
die etwa halbwegs zwischen Giebelmitte und
rechter Ecke angesetzt werden. (Ich urteile
nach der neuen französischen Rekonstruktion,
abgebildet von Poulsen in Studier fra Sprog- og
Oldtidsforskning 1917 Heft 106, nach Fouilles de
Delphes II). Courby BCH. XXXVIII 1914, 343 ff.
will die Nike auf die Mitte des Giebels setzen;
ihre Größe scheint mir dafür zu gering, und ich
möchte sie wieder, wie ehemals Homolle, auf die
Ecke verweisen. Das Flügelstück, aus dem
Courby Sphinxe als Schmuck der Ecken rekon-
struiert, könnte zum Mittelakroter — Palmetten-
ornament mit symmetrischen Sphinxen? —■
Eduard Schmidt, Ein Akroter des »peisistratischen« Athenatempels.
Die Anordnung also des Torsos 694 auf der Giebelecke, wie wir sie aus der Art
der Stückung erschlossen haben, ist in archaischer Zeit wohl denkbar. War aber der
Torso ein Akroter, so ergibt sich eben daraus von neuem die Verbindung mit dem
Giebel des erweiterten Hekatompedon: nach den Maßen kann kein anderes Gebäude
der vorpersischen Akropolis in Frage kommen. Sonstige äußere Tatsachen liefern
keinen entscheidenden Anhalt — weder die Fundstelle, wenn sie auch in gleicher
Richtung von dem zerstörten Tempel liegt wie die Fundorte der Giebelfiguren, noch
die erhaltene Architektur, die keinen Rest der Akroterbasen aufweist. Der Marmor
ist von Lepsius (und Dickins) bei der Nike als parisch, bei den Giebelfiguren als
Inselmarmor bezeichnet worden; doch abgesehen von der Unsicherheit solcher Be-
stimmungen wird man die Verwendung verschiedenen Materials nicht als außer aller
Möglichkeit erachten. — Bei solchem Mangel an ausschlaggebenden Momenten er-
scheint das Größenverhältnis um so wichtiger: der Torso ist 0,75 m hoch, ursprünglich
wird er ungefähr 1,50 m erreicht haben I). Die Höhe des Giebclraumes ist auf 2,46 m
berechnet worden. Das Eckakroter würde davon etwas über die Hälfte einnehmen.
Das ist, vorsichtig gesagt, ein mögliches Verhältnis, während für das Mittelakroter
das Maß des Torsos zu gering wäre 3).
Nach allem ist dies der Stand der Frage: Die Nike 694 erschien als dem Giganten-
giebel nächstverwandt nach Stil und Stückungstechnik. Während daraus allein nur
auf die Herkunft aus der gleichen Künstlerwerkstatt geschlossen werden konnte,
führt die Annahme tektonischer Verwendung des Stückes unmittelbar auf die Zu-
gehörigkeit zum »peisistratischen« Athenatempel: ein Akroter aus Marmor und von
so beträchtlicher Größe muß zum größten vorpersischen Bau auf der Akropolis
gehört haben. —- Voraussetzung ist aber auch hier, daß ein Werk aus der zweiten Hälfte
des 6. Jahrhunderts vorliegt. Davon, daß die im Anfang der Untersuchung begründete
Ansicht vom rein archaischen Stilcharakter dieser Nike anerkannt wird, ist alles
weitere abhängig. Von dieser Grundlage aus gelangen wir zu zwei getrennten Thesen,
*) Bei dieser Schätzung sind zur Höhe des Torsos
(0,75 m) für den Kopf 0,25, für den » Gewandfuß «
0,50 m gerechnet. — Bei den kleinen Akroter-
niken von Delphi ist der Gewandfuß besonders
hoch (sie waren Mittelakrotere, s.0. S. 110 A. 1);
seine Höhe bis zu der Gegend, in welcher die
Nike 694 gebrochen ist, beträgt mindestens die
Hälfte der Gesamthöhe bis zum Halssaum; dar-
nach ergäben sich für die Nike 694 sogar 2 X 75cm
+ 25 cm für den Kopf = 1,75 m.
2") In Aegina sind die Eckakroterien verhältnismäßig
kleiner: H. in der jetzigen Ergänzung 0,76 m, des
Tympanon 1,70 m. Bei der großen Nike von
Delphi war ein Gewandfuß anscheinend nicht
vorhanden: die Randfältelung am unteren
Saum ist r. von der breiten Mittelbahn gerade
noch erkennbar. Wenn die Figur also nicht viel
gehört
größer war, als erhalten — 1,13 m—, so maß auch
sie wenig mehr als die halbe Höhe des Tympanon.
Denn dies ist fast genau die Höhe der beiden
Torsen stehender Frauen — 1,13 bzw. 1,16 m —,
die etwa halbwegs zwischen Giebelmitte und
rechter Ecke angesetzt werden. (Ich urteile
nach der neuen französischen Rekonstruktion,
abgebildet von Poulsen in Studier fra Sprog- og
Oldtidsforskning 1917 Heft 106, nach Fouilles de
Delphes II). Courby BCH. XXXVIII 1914, 343 ff.
will die Nike auf die Mitte des Giebels setzen;
ihre Größe scheint mir dafür zu gering, und ich
möchte sie wieder, wie ehemals Homolle, auf die
Ecke verweisen. Das Flügelstück, aus dem
Courby Sphinxe als Schmuck der Ecken rekon-
struiert, könnte zum Mittelakroter — Palmetten-
ornament mit symmetrischen Sphinxen? —■