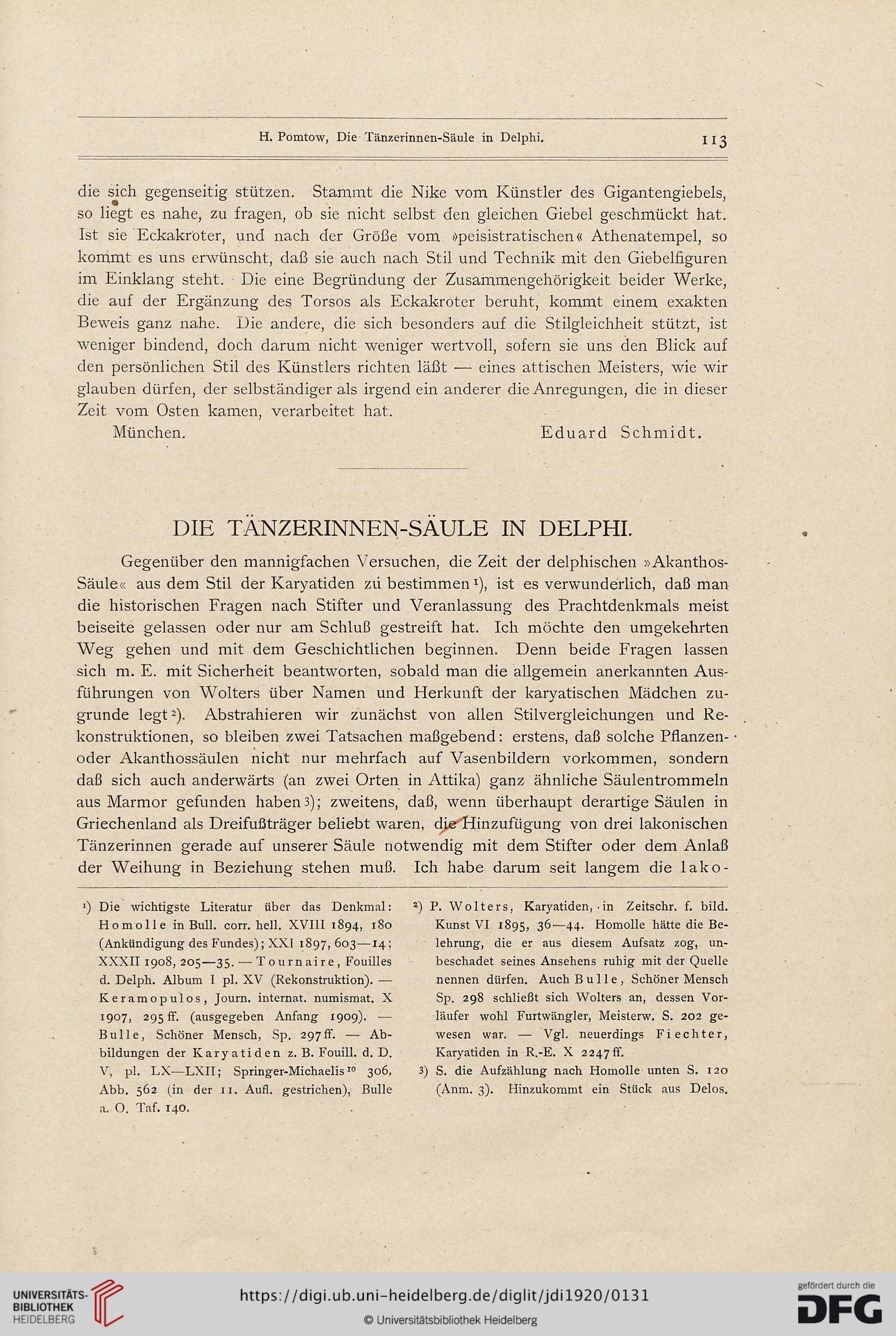H. Pomtow, Die Tänzerinnen-Säule in Delphi. ij
die sich gegenseitig stützen. Stammt die Nike vom Künstler des Gigantengiebels,
so liegt es nahe, zu fragen, ob sie nicht selbst den gleichen Giebel geschmückt hat.
Ist sie Eckakröter, und nach der Größe vom »peisistratischen« Athenatempel, so
kommt es uns erwünscht, daß sie auch nach Stil und Technik mit den Giebelfiguren
im Einklang steht. Die eine Begründung der Zusammengehörigkeit beider Werke,
die auf der Ergänzung des Torsos als Eckakroter beruht, kommt einem exakten
Beweis ganz nahe. Die andere, die sich besonders auf die Stilgleichheit stützt, ist
weniger bindend, doch darum nicht weniger wertvoll, sofern sie uns den Blick auf
den persönlichen Stil des Künstlers richten läßt ■— eines attischen Meisters, wie wir
glauben dürfen, der selbständiger als irgend ein anderer die Anregungen, die in dieser
Zeit vom Osten kamen, verarbeitet hat.
München. Eduard Schmidt.
DIE TÄNZERINNEN-SÄULE IN DELPHI.
Gegenüber den mannigfachen Versuchen, die Zeit der delphischen »Akanthos-
Säule« aus dem Stil der Karyatiden zü bestimmen *), ist es verwunderlich, daß man
die historischen Fragen nach Stifter und Veranlassung des Prachtdenkmals meist
beiseite gelassen oder nur am Schluß gestreift hat. Ich möchte den umgekehrten
Weg gehen und mit dem Geschichtlichen beginnen. Denn beide Fragen lassen
sich m. E. mit Sicherheit beantworten, sobald man die allgemein anerkannten Aus-
führungen von Wolters über Namen und Herkunft der karyatischen Mädchen zu-
grunde legt2). Abstrahieren wir zunächst von allen Stilvergleichungen und Re-
konstruktionen, so bleiben zwei Tatsachen maßgebend: erstens, daß solche Pflanzen-
oder Akanthossäulen nicht nur mehrfach auf Vasenbildern vorkommen, sondern
daß sich auch anderwärts (an zwei Orten in Attika) ganz ähnliche Säulentrommeln
aus Marmor gefunden habens); zweitens, daß, wenn überhaupt derartige Säulen in
Griechenland als Dreifußträger beliebt waren, dle'Hinzufügung von drei lakonischen
Tänzerinnen gerade auf unserer Säule notwendig mit dem Stifter oder dem Anlaß
der Weihung in Beziehung stehen muß. Ich habe darum seit langem die lako-
*) Die wichtigste Literatur über das Denkmal:
Homolle in Bull. corr. hell. XVIII 1894, 180
(Ankündigung des Fundes); XXI 1897, 603—14;
XXXII 1908, 205—35. — T o u rn ai r e , Fouilles
d. Delph. Album I pl. XV (Rekonstruktion). —
Keramopulos, Journ. internat. numismat. X
1907, 295 ff. (ausgegeben Anfang 1909). —
Bulle, Schöner Mensch, Sp. 297ff. — Ab-
bildungen der Karyatiden z. B. Fouill. d. D.
V, pl. LX—LXII; Springer-Michaelis10 306,
Abb. 562 (in der 11. Aufl. gestrichen), Bulle
a. O. Taf. 140.
2) P. Wolters, Karyatiden, ·in Zeitschr. f. bild.
Kunst VI 1895, 36·—44. Homolle hätte die Be-
lehrung, die er aus diesem Aufsatz zog, un-
beschadet seines Ansehens ruhig mit der Quelle
nennen dürfen. Auch Bulle, Schöner Mensch
Sp. 298 schließt sich Wolters an, dessen Vor-
läufer wohl Furtwängler, Meisterw. S. 202 ge-
wesen war. — Vgl. neuerdings Fi echter,
Karyatiden in R.-E. X 2247 ff.
3) S. die Aufzählung nach Homolle unten S. 120
(Anm. 3). Hinzukommt ein Stück aus Delos.
die sich gegenseitig stützen. Stammt die Nike vom Künstler des Gigantengiebels,
so liegt es nahe, zu fragen, ob sie nicht selbst den gleichen Giebel geschmückt hat.
Ist sie Eckakröter, und nach der Größe vom »peisistratischen« Athenatempel, so
kommt es uns erwünscht, daß sie auch nach Stil und Technik mit den Giebelfiguren
im Einklang steht. Die eine Begründung der Zusammengehörigkeit beider Werke,
die auf der Ergänzung des Torsos als Eckakroter beruht, kommt einem exakten
Beweis ganz nahe. Die andere, die sich besonders auf die Stilgleichheit stützt, ist
weniger bindend, doch darum nicht weniger wertvoll, sofern sie uns den Blick auf
den persönlichen Stil des Künstlers richten läßt ■— eines attischen Meisters, wie wir
glauben dürfen, der selbständiger als irgend ein anderer die Anregungen, die in dieser
Zeit vom Osten kamen, verarbeitet hat.
München. Eduard Schmidt.
DIE TÄNZERINNEN-SÄULE IN DELPHI.
Gegenüber den mannigfachen Versuchen, die Zeit der delphischen »Akanthos-
Säule« aus dem Stil der Karyatiden zü bestimmen *), ist es verwunderlich, daß man
die historischen Fragen nach Stifter und Veranlassung des Prachtdenkmals meist
beiseite gelassen oder nur am Schluß gestreift hat. Ich möchte den umgekehrten
Weg gehen und mit dem Geschichtlichen beginnen. Denn beide Fragen lassen
sich m. E. mit Sicherheit beantworten, sobald man die allgemein anerkannten Aus-
führungen von Wolters über Namen und Herkunft der karyatischen Mädchen zu-
grunde legt2). Abstrahieren wir zunächst von allen Stilvergleichungen und Re-
konstruktionen, so bleiben zwei Tatsachen maßgebend: erstens, daß solche Pflanzen-
oder Akanthossäulen nicht nur mehrfach auf Vasenbildern vorkommen, sondern
daß sich auch anderwärts (an zwei Orten in Attika) ganz ähnliche Säulentrommeln
aus Marmor gefunden habens); zweitens, daß, wenn überhaupt derartige Säulen in
Griechenland als Dreifußträger beliebt waren, dle'Hinzufügung von drei lakonischen
Tänzerinnen gerade auf unserer Säule notwendig mit dem Stifter oder dem Anlaß
der Weihung in Beziehung stehen muß. Ich habe darum seit langem die lako-
*) Die wichtigste Literatur über das Denkmal:
Homolle in Bull. corr. hell. XVIII 1894, 180
(Ankündigung des Fundes); XXI 1897, 603—14;
XXXII 1908, 205—35. — T o u rn ai r e , Fouilles
d. Delph. Album I pl. XV (Rekonstruktion). —
Keramopulos, Journ. internat. numismat. X
1907, 295 ff. (ausgegeben Anfang 1909). —
Bulle, Schöner Mensch, Sp. 297ff. — Ab-
bildungen der Karyatiden z. B. Fouill. d. D.
V, pl. LX—LXII; Springer-Michaelis10 306,
Abb. 562 (in der 11. Aufl. gestrichen), Bulle
a. O. Taf. 140.
2) P. Wolters, Karyatiden, ·in Zeitschr. f. bild.
Kunst VI 1895, 36·—44. Homolle hätte die Be-
lehrung, die er aus diesem Aufsatz zog, un-
beschadet seines Ansehens ruhig mit der Quelle
nennen dürfen. Auch Bulle, Schöner Mensch
Sp. 298 schließt sich Wolters an, dessen Vor-
läufer wohl Furtwängler, Meisterw. S. 202 ge-
wesen war. — Vgl. neuerdings Fi echter,
Karyatiden in R.-E. X 2247 ff.
3) S. die Aufzählung nach Homolle unten S. 120
(Anm. 3). Hinzukommt ein Stück aus Delos.