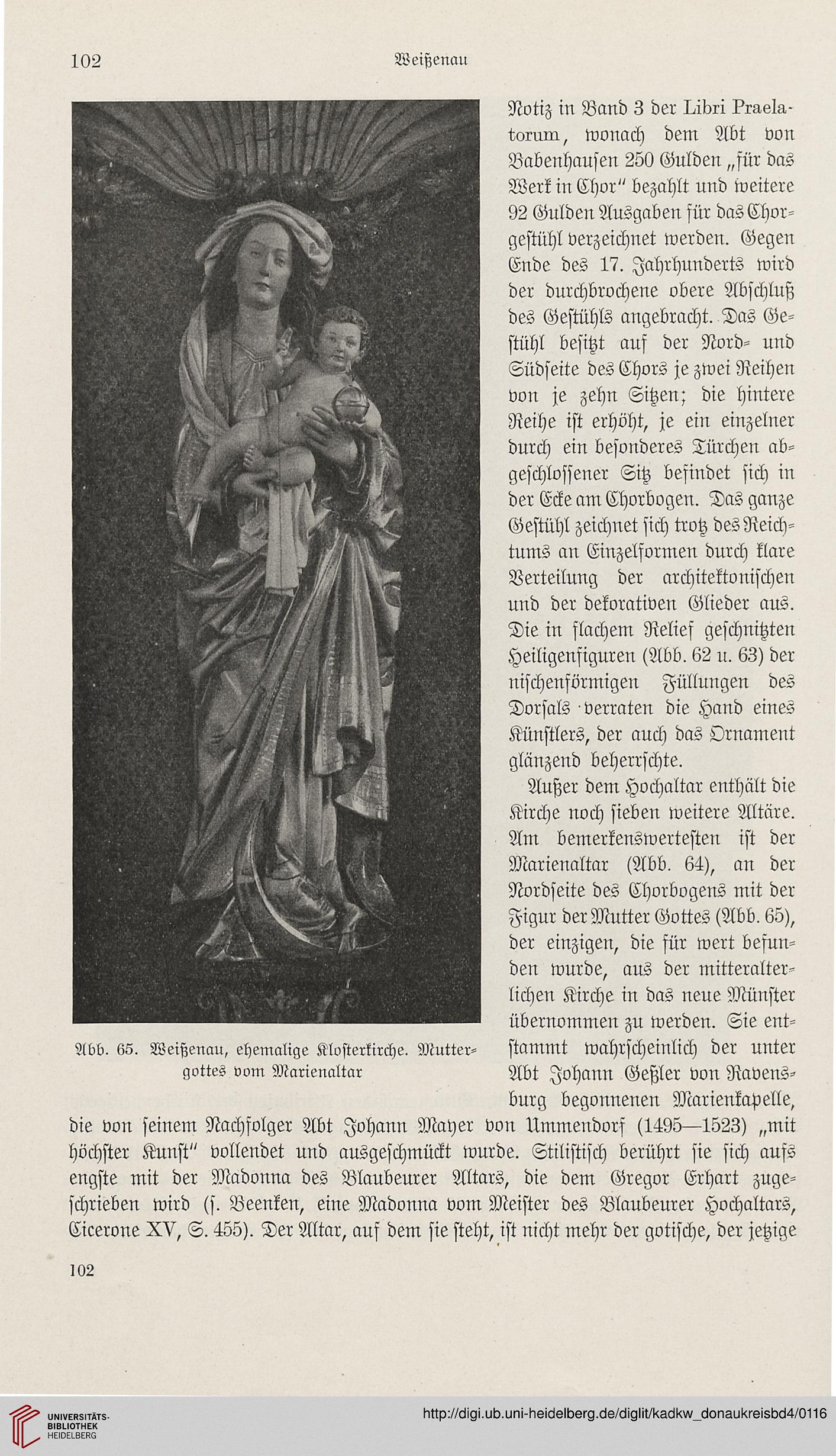102
Weißenau
Notiz in Band 3 der lübri kruelu-
lormn, wonach dem Abt von
Babenhausen 250 Gulden „für das
Werk in Chor" bezahlt und weitere
92 Gülden Ausgaben für das Chor-
gestühl verzeichnet werden. Gegen
Ende des 17. Jahrhunderts wird
der durchbrochene obere Abschluß
des Gestühls angebracht. Das Ge-
stühl besitzt auf der Nord- und
Südseite des Chors je zwei Reihen
von je zehn Sitzen; die Hintere
Reihe ist erhöht, je ein einzelner
durch ein besonderes Türchen ab-
geschlossener Sitz befindet sich in
der Ecke am Chorbogen. Das ganze
Gestühl zeichnet sich trotz des Reich-
tums an Einzelformen durch klare
Verteilung der architektonischen
und der dekorativen Glieder aus.
Die in flachem Relief geschnitzten
Heiligenfiguren (Abb. 62 u. 63) der
nischenförmigen Füllungen des
Dorsals verraten die Hand eines
Künstlers, der auch das Ornament
glänzend beherrschte.
Außer dem Hochaltar enthält die
Kirche noch sieben weitere Altäre.
Am bemerkenswertesten ist der
Marienaltar (Abb. 64), an der
Nordseite des Chorbogens mit der
Figur der Mutter Gottes (Abb. 65),
der einzigen, die für wert befun-
den wurde, aus der mitteralter-
lichen Kirche in das neue Münster
übernommen zu werden. Sie ent-
Abb. 65. Weißenau, ehemalige Klosterkirche. Mutter- stammt wahrscheinlich der unter
gottes vom Marienaltar Abt Johann Geßler von Ravens-
burg begonnenen Marienkapelle,
die von seinem Nachfolger Abt Johann Mayer von Ilmmendorf (1495—1523) „mit
höchster Kunst" vollendet und ausgeschmückt wurde. Stilistisch berührt sie sich aufs
engste mit der Madonna des Blaubenrer Altars, die dem Gregor Erhärt zuge-
schrieben wird (s. Beenken, eine Madonna vom Meister des Blaubeurer Hochaltars,
Cicerone XV, S. 455). Der Altar, auf dem sie steht, ist nicht mehr der gotische, der jetzige
102
Weißenau
Notiz in Band 3 der lübri kruelu-
lormn, wonach dem Abt von
Babenhausen 250 Gulden „für das
Werk in Chor" bezahlt und weitere
92 Gülden Ausgaben für das Chor-
gestühl verzeichnet werden. Gegen
Ende des 17. Jahrhunderts wird
der durchbrochene obere Abschluß
des Gestühls angebracht. Das Ge-
stühl besitzt auf der Nord- und
Südseite des Chors je zwei Reihen
von je zehn Sitzen; die Hintere
Reihe ist erhöht, je ein einzelner
durch ein besonderes Türchen ab-
geschlossener Sitz befindet sich in
der Ecke am Chorbogen. Das ganze
Gestühl zeichnet sich trotz des Reich-
tums an Einzelformen durch klare
Verteilung der architektonischen
und der dekorativen Glieder aus.
Die in flachem Relief geschnitzten
Heiligenfiguren (Abb. 62 u. 63) der
nischenförmigen Füllungen des
Dorsals verraten die Hand eines
Künstlers, der auch das Ornament
glänzend beherrschte.
Außer dem Hochaltar enthält die
Kirche noch sieben weitere Altäre.
Am bemerkenswertesten ist der
Marienaltar (Abb. 64), an der
Nordseite des Chorbogens mit der
Figur der Mutter Gottes (Abb. 65),
der einzigen, die für wert befun-
den wurde, aus der mitteralter-
lichen Kirche in das neue Münster
übernommen zu werden. Sie ent-
Abb. 65. Weißenau, ehemalige Klosterkirche. Mutter- stammt wahrscheinlich der unter
gottes vom Marienaltar Abt Johann Geßler von Ravens-
burg begonnenen Marienkapelle,
die von seinem Nachfolger Abt Johann Mayer von Ilmmendorf (1495—1523) „mit
höchster Kunst" vollendet und ausgeschmückt wurde. Stilistisch berührt sie sich aufs
engste mit der Madonna des Blaubenrer Altars, die dem Gregor Erhärt zuge-
schrieben wird (s. Beenken, eine Madonna vom Meister des Blaubeurer Hochaltars,
Cicerone XV, S. 455). Der Altar, auf dem sie steht, ist nicht mehr der gotische, der jetzige
102