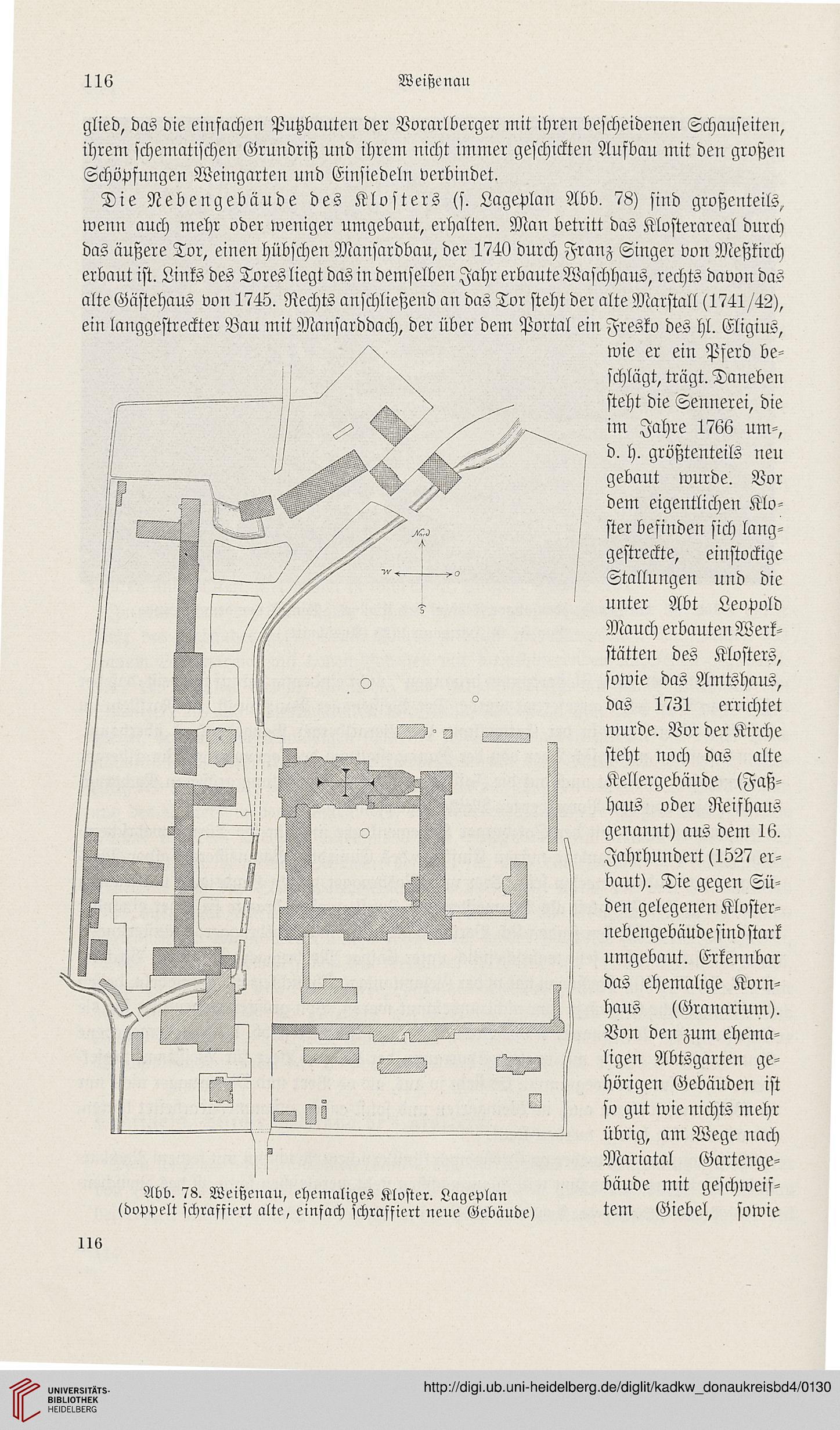116
Weißenau
glied, das die einfachen Putzbauten der Vorarlberger mit ihren bescheidenen Schauseiten,
ihrem schematischen Grundriß und ihrem nicht immer geschickten Aufbau mit den großen
Schöpfungen Weingarten und Einsiedeln verbindet.
Die Nebengebäude des Klosters (s. Lageplan Abb. 78) sind großenteils,
wenn auch mehr oder weniger umgebaut, erhalten. Man betritt das Klosterareal durch
das äußere Tor, einen hübschen Mansardbau, der 1740 durch Franz Singer von Meßkirch
erbaut ist. Links des Tores liegt das in demselben Jahr erbaute Waschhaus, rechts davon das
alte Gästehaus von 1745. Rechts anschließend an das Tor steht der alte Marstall (1741/42),
ein langgestreckter Bau mit Mansarddach, der über dem Portal ein Fresko des hl. Eligius,
wie er ein Pferd be-
schlägt, trägt. Daneben
steht die Sennerei, die
im Jahre 1766 um-,
d. h. größtenteils neu
gebaut wurde. Bor
dem eigentlichen Klo-
ster befinden sich lang-
gestreckte, einstöckige
Stallungen und die
unter Abt Leopold
Mauch erbauten Werk-
stätten des Klosters,
sowie das Amtshaus,
das 1731 errichtet
wurde. Vor der Kirche
steht noch das alte
Kellergebäude (Faß-
haus oder Reifhaus
genannt) aus dem 16.
Jahrhundert (1527 er-
baut). Die gegen Sü-
den gelegenen Kloster-
nebengebäudesind stark
umgebaut. Erkennbar
das ehemalige Korn-
haus (Granarium).
Von den zum ehema-
ligen Abtsgarten ge-
hörigen Gebäuden ist
so gut wie nichts mehr
übrig, am Wege nach
Mariatal Gartenge-
Abb. 78. Weißenau, ehemaliges Kloster. Lageplan bäude mit geschweif-
(doppelt schraffiert alte, einfach schraffiert neue Gebäude) tem Giebel, sowie
116
Weißenau
glied, das die einfachen Putzbauten der Vorarlberger mit ihren bescheidenen Schauseiten,
ihrem schematischen Grundriß und ihrem nicht immer geschickten Aufbau mit den großen
Schöpfungen Weingarten und Einsiedeln verbindet.
Die Nebengebäude des Klosters (s. Lageplan Abb. 78) sind großenteils,
wenn auch mehr oder weniger umgebaut, erhalten. Man betritt das Klosterareal durch
das äußere Tor, einen hübschen Mansardbau, der 1740 durch Franz Singer von Meßkirch
erbaut ist. Links des Tores liegt das in demselben Jahr erbaute Waschhaus, rechts davon das
alte Gästehaus von 1745. Rechts anschließend an das Tor steht der alte Marstall (1741/42),
ein langgestreckter Bau mit Mansarddach, der über dem Portal ein Fresko des hl. Eligius,
wie er ein Pferd be-
schlägt, trägt. Daneben
steht die Sennerei, die
im Jahre 1766 um-,
d. h. größtenteils neu
gebaut wurde. Bor
dem eigentlichen Klo-
ster befinden sich lang-
gestreckte, einstöckige
Stallungen und die
unter Abt Leopold
Mauch erbauten Werk-
stätten des Klosters,
sowie das Amtshaus,
das 1731 errichtet
wurde. Vor der Kirche
steht noch das alte
Kellergebäude (Faß-
haus oder Reifhaus
genannt) aus dem 16.
Jahrhundert (1527 er-
baut). Die gegen Sü-
den gelegenen Kloster-
nebengebäudesind stark
umgebaut. Erkennbar
das ehemalige Korn-
haus (Granarium).
Von den zum ehema-
ligen Abtsgarten ge-
hörigen Gebäuden ist
so gut wie nichts mehr
übrig, am Wege nach
Mariatal Gartenge-
Abb. 78. Weißenau, ehemaliges Kloster. Lageplan bäude mit geschweif-
(doppelt schraffiert alte, einfach schraffiert neue Gebäude) tem Giebel, sowie
116