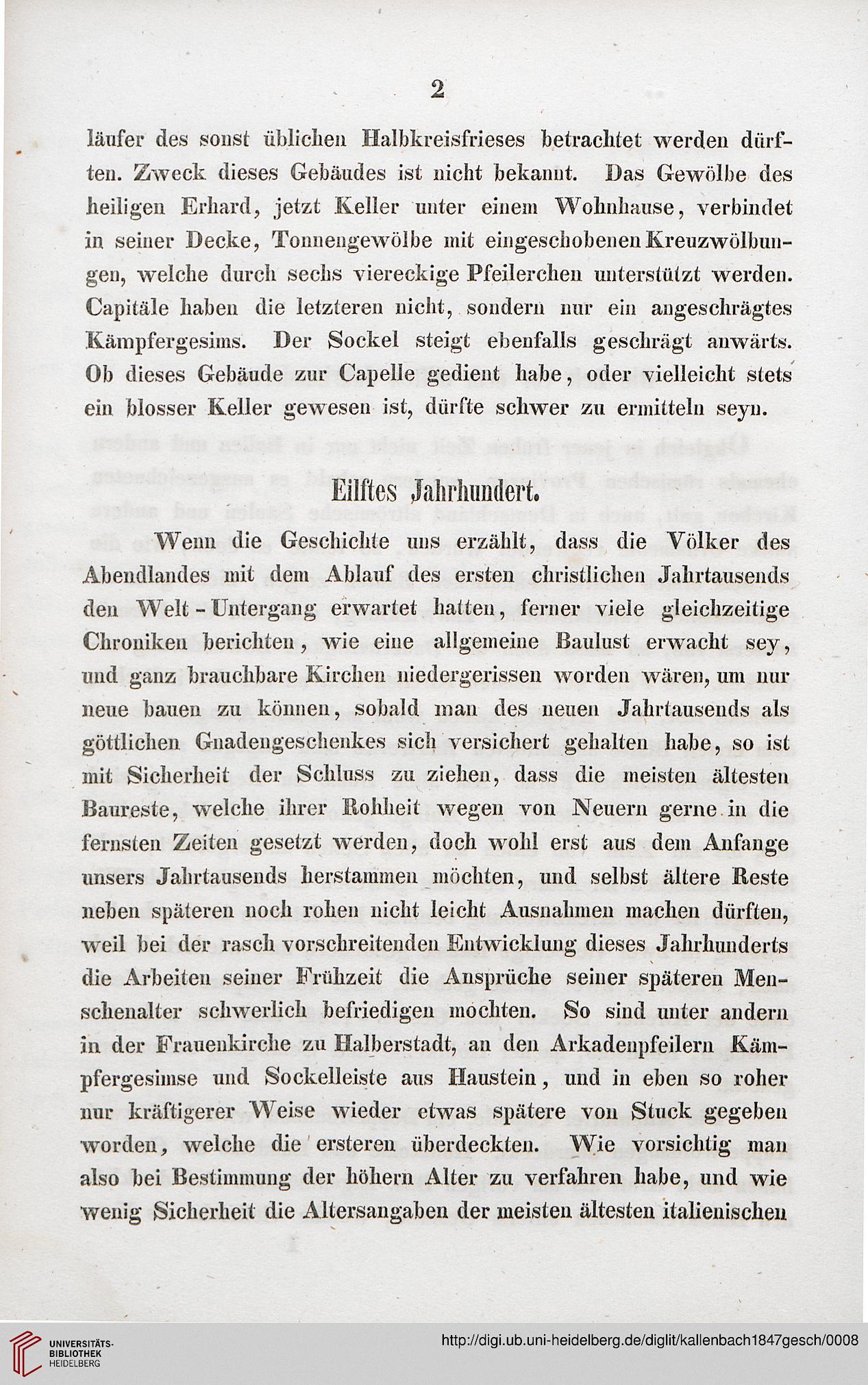2
läufer des sonst üblichen Halbkreisfrieses betrachtet werden dürf-
ten. Zweck dieses Gebäudes ist nicht bekannt. Das Gewölbe des
heiligen Erhard, jetzt Keller unter einem Wohnhause, verbindet
in seiner Decke, Tonnengewölbe mit eingeschobenenKreuzwölbun-
gen, welche durch sechs viereckige Pfeilerchen unterstützt werden.
Capitäle haben die letzteren nicht, sondern nur ein angeschrägtes
Kämpfergesims. Der Sockel steigt ebenfalls geschrägt anwärts.
Ob dieses Gebäude zur Capelle gedient habe, oder vielleicht stets
ein blosser Keller gewesen ist, dürfte schwer zu ermitteln seyu.
Eilftes Jahrhundert.
Wenn die Geschichte uns erzählt, dass die Völker des
Abendlandes mit dem Ablauf des ersten christlichen Jahrtausends
den Welt - Untergang erwartet hatten, ferner viele gleichzeitige
Chroniken berichten, wie eine allgemeine Baulust erwacht sey,
und ganz brauchbare Kirchen niedergerissen worden wären, um nur
neue bauen zu können, sobald man des neuen Jahrtausends als
göttlichen Gnadengeschenkes sich versichert gehalten habe, so ist
mit Sicherheit der Schluss zu ziehen, dass die meisten ältesten
Baureste, welche ihrer Rohheit wegen von Neuern gerne in die
fernsten Zeiten gesetzt werden, doch wohl erst aus dem Anfange
unsers Jahrtausends herstammen möchten, und selbst ältere Reste
neben späteren noch rohen nicht leicht Ausnahmen machen dürften,
weil bei der rasch vorschreitenden Entwicklung dieses Jahrhunderts
die Arbeiten seiner Frühzeit die Ansprüche seiner späteren Men-
schenalter schwerlich befriedigen mochten. So sind unter andern
in der Frauenkirche zu Halberstadt, an den Arkadenpfeilern Käm-
pfergesimse und Sockelleiste aus Haustein, und in eben so roher
nur kräftigerer Weise wieder etwas spätere von Stuck gegeben
worden, welche die ersteren überdeckten. Wie vorsichtig man
also bei Bestimmung der höhern Alter zu verfahren habe, und wie
wenig Sicherheit die Altersangaben der meisten ältesten italienischen
läufer des sonst üblichen Halbkreisfrieses betrachtet werden dürf-
ten. Zweck dieses Gebäudes ist nicht bekannt. Das Gewölbe des
heiligen Erhard, jetzt Keller unter einem Wohnhause, verbindet
in seiner Decke, Tonnengewölbe mit eingeschobenenKreuzwölbun-
gen, welche durch sechs viereckige Pfeilerchen unterstützt werden.
Capitäle haben die letzteren nicht, sondern nur ein angeschrägtes
Kämpfergesims. Der Sockel steigt ebenfalls geschrägt anwärts.
Ob dieses Gebäude zur Capelle gedient habe, oder vielleicht stets
ein blosser Keller gewesen ist, dürfte schwer zu ermitteln seyu.
Eilftes Jahrhundert.
Wenn die Geschichte uns erzählt, dass die Völker des
Abendlandes mit dem Ablauf des ersten christlichen Jahrtausends
den Welt - Untergang erwartet hatten, ferner viele gleichzeitige
Chroniken berichten, wie eine allgemeine Baulust erwacht sey,
und ganz brauchbare Kirchen niedergerissen worden wären, um nur
neue bauen zu können, sobald man des neuen Jahrtausends als
göttlichen Gnadengeschenkes sich versichert gehalten habe, so ist
mit Sicherheit der Schluss zu ziehen, dass die meisten ältesten
Baureste, welche ihrer Rohheit wegen von Neuern gerne in die
fernsten Zeiten gesetzt werden, doch wohl erst aus dem Anfange
unsers Jahrtausends herstammen möchten, und selbst ältere Reste
neben späteren noch rohen nicht leicht Ausnahmen machen dürften,
weil bei der rasch vorschreitenden Entwicklung dieses Jahrhunderts
die Arbeiten seiner Frühzeit die Ansprüche seiner späteren Men-
schenalter schwerlich befriedigen mochten. So sind unter andern
in der Frauenkirche zu Halberstadt, an den Arkadenpfeilern Käm-
pfergesimse und Sockelleiste aus Haustein, und in eben so roher
nur kräftigerer Weise wieder etwas spätere von Stuck gegeben
worden, welche die ersteren überdeckten. Wie vorsichtig man
also bei Bestimmung der höhern Alter zu verfahren habe, und wie
wenig Sicherheit die Altersangaben der meisten ältesten italienischen