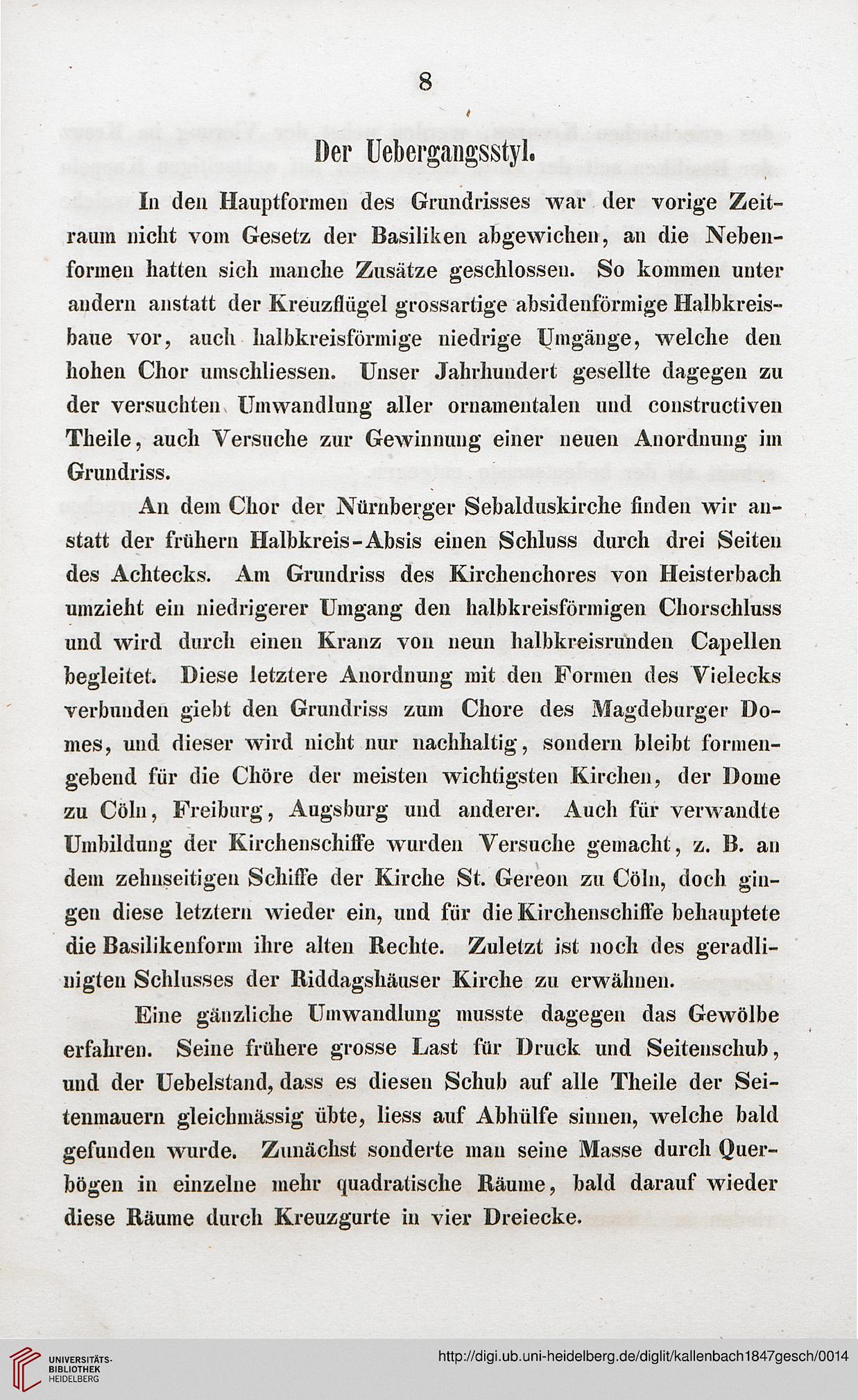8
Der Uebergangsstyl.
In den Hauptformen des Grandrisses war der vorige Zeit-
raum nicht vom Gesetz der Basiliken abgewichen, an die Neben-
formen hatten sich manche Zusätze geschlossen. So kommen unter
andern anstatt der Kreuzflügel grossartige absideuförmige Halbkreis-
baue vor, auch halbkreisförmige niedrige Umgänge, welche den
hohen Chor umschliessen. Unser Jahrhundert gesellte dagegen zu
der versuchten Umwandlung aller ornamentalen und constructiven
Theile, auch Versuche zur Gewinnung einer neuen Anordnung im
Grundriss.
An dem Chor der Nürnberger Sebalduskirche finden wir an-
statt der frühern Halbkreis-Absis einen Schluss durch drei Seiten
des Achtecks. Am Grundriss des Kirchenchores von Heisterbach
umzieht ein niedrigerer Umgang den halbkreisförmigen Chorschluss
und wird durch einen Kranz von neun halbkreisrunden Capellen
begleitet. Diese letztere Anordnung mit den Formen des Vielecks
verbunden giebt den Grundriss zum Chore des Magdeburger Do-
mes, und dieser wird nicht nur nachhaltig, sondern bleibt formen-
gebend für die Chöre der meisten wichtigsten Kirchen, der Dome
zu Cöln, Freiburg, Augsburg und anderer. Auch für verwandte
Umbildung der Kirchenschiffe wurden Versuche gemacht, z. B. au
dem zehnseitigen Schiffe der Kirche St. Gereon zu Cöln, doch gin-
gen diese letztern wieder ein, und für die Kirchenschiffe behauptete
die Basilikenform ihre alten Rechte. Zuletzt ist noch des geradli-
nigten Schlusses der Riddagshäuser Kirche zu erwähnen.
Eine gänzliche Umwandlung musste dagegen das Gewölbe
erfahren. Seine frühere grosse Last für Druck und Seitenschub,
und der Uebelstand, dass es diesen Schub auf alle Theile der Sei-
tenmauern gleichmässig übte, Hess auf Abhülfe sinnen, welche bald
gefunden wurde. Zunächst sonderte mau seine Masse durch Quer-
bögen in einzelne mehr quadratische Räume, bald darauf wieder
diese Räume durch Kreuzgurte in vier Dreiecke.
Der Uebergangsstyl.
In den Hauptformen des Grandrisses war der vorige Zeit-
raum nicht vom Gesetz der Basiliken abgewichen, an die Neben-
formen hatten sich manche Zusätze geschlossen. So kommen unter
andern anstatt der Kreuzflügel grossartige absideuförmige Halbkreis-
baue vor, auch halbkreisförmige niedrige Umgänge, welche den
hohen Chor umschliessen. Unser Jahrhundert gesellte dagegen zu
der versuchten Umwandlung aller ornamentalen und constructiven
Theile, auch Versuche zur Gewinnung einer neuen Anordnung im
Grundriss.
An dem Chor der Nürnberger Sebalduskirche finden wir an-
statt der frühern Halbkreis-Absis einen Schluss durch drei Seiten
des Achtecks. Am Grundriss des Kirchenchores von Heisterbach
umzieht ein niedrigerer Umgang den halbkreisförmigen Chorschluss
und wird durch einen Kranz von neun halbkreisrunden Capellen
begleitet. Diese letztere Anordnung mit den Formen des Vielecks
verbunden giebt den Grundriss zum Chore des Magdeburger Do-
mes, und dieser wird nicht nur nachhaltig, sondern bleibt formen-
gebend für die Chöre der meisten wichtigsten Kirchen, der Dome
zu Cöln, Freiburg, Augsburg und anderer. Auch für verwandte
Umbildung der Kirchenschiffe wurden Versuche gemacht, z. B. au
dem zehnseitigen Schiffe der Kirche St. Gereon zu Cöln, doch gin-
gen diese letztern wieder ein, und für die Kirchenschiffe behauptete
die Basilikenform ihre alten Rechte. Zuletzt ist noch des geradli-
nigten Schlusses der Riddagshäuser Kirche zu erwähnen.
Eine gänzliche Umwandlung musste dagegen das Gewölbe
erfahren. Seine frühere grosse Last für Druck und Seitenschub,
und der Uebelstand, dass es diesen Schub auf alle Theile der Sei-
tenmauern gleichmässig übte, Hess auf Abhülfe sinnen, welche bald
gefunden wurde. Zunächst sonderte mau seine Masse durch Quer-
bögen in einzelne mehr quadratische Räume, bald darauf wieder
diese Räume durch Kreuzgurte in vier Dreiecke.