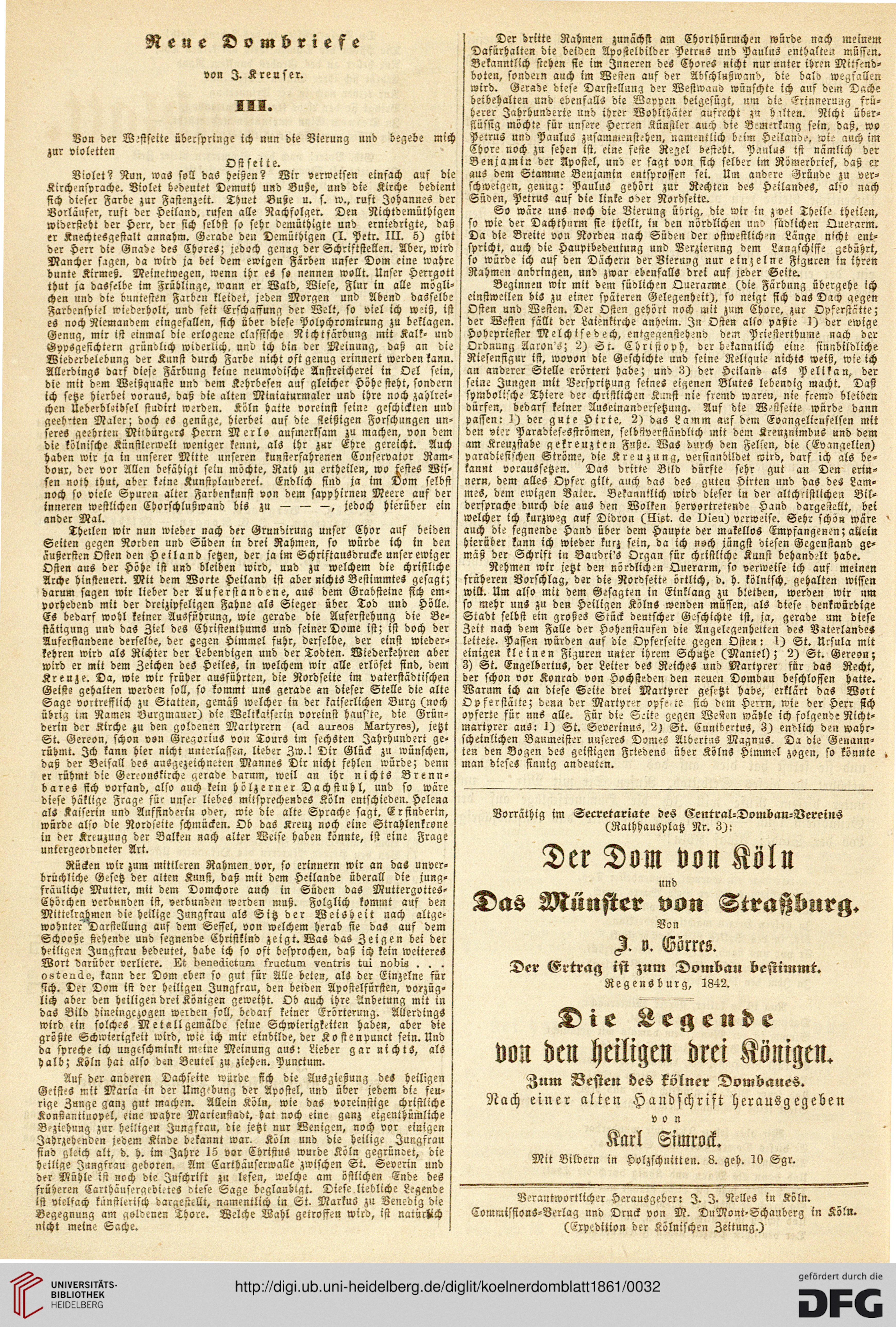Neue Dombrrefe
von I. Kreuser.
LZS.
Von der WHseite übersprings ich nun die Vierung und bsgebs mich
znr violetten
OKseite.
Violet? Run, was soll das h-ißen? Wir serwsissn einfach auf die
Kirchensprache. Biolst bsdeutet Dsmuth und BuKs, und die Kirche bedient
fich dieser Farbe zur Fastsnzeit. Thuet LuKe u. s. w., ruft Zohannes der
Lorläufsr, ruft der Heiland, rusen alle Rachfolger. Den Nichtdemüthigen
widerstebt der Herr, dcr fich selbst so sehr demüthigte und erniedrigte, daß
er Knechtesgestalt annahm. Gcrads den Demüthigen (I. Petr. III. 5) gibt
der Herr die Gnade des Chsrss; jedoch genug der Schriftstellsn. Aber, wird
Mancher sagen, da wird ja bei dem ewigen FLrben unser Dom eine wahre
bunte Kirmeß. Meinetwegen, wenn ihr es ss nennen wollt. Unser Herrgott
thut ja dasselbe im Zrüblinge, wann er Wald, Wiese, Flur in alle mögli-
chen und sie buntesten Farben kleidet, jsden Morgen und Abend dasselbe
Farbsnsxiel wiedsrholt, und seit Erschaffung der Welt, so viel ich wsiß, tst
eS noch Riemandem eingefallen, fich über diess Polpchromirung zu beklagen.
Gsnng, mir ist einmal die erlogene classische Nichtfärbung mit Kalk- und
Hppsgefichtern gründlrch widerlich, und ich bin der Meinung, daß an die
Wiedsrbslebung der Ännst durch Farbs nicht oft genug erinnert werden kann.
AllerdingS darf diess Färbung keins nsumodische Lnstreichers! in Oel sein,
die mit d-m Weißquaste und kem Aehrbesen auf gleicher Höhe steht, sondern
ich setze hisrbei voraus, daß die alten Miniaturmaler und ihrs noch zahlrsi-
chsn Usberbleibsel stndirt wrrdsn. Köln haite voreinst sein: geschickten und
geeh'ten Maler; doch eS genügs, hierbsi auf die sieißigen Forschungen un-
seres geehrten MitbürgerS Herrn Merls aufmsrksam zu machen, von dem
die kölnische Künstlerwslt weniger kennt, als ihr zur Ehre gereicht. Auch
haben wir ja in unserer Mitte unseren kunsterfahrenen Conservator Ram-
bour, der vor Allsn befähigt se!u möchte, Rath zu erthsilen, wo ssstes Wis-
sen noth ihut, absr keins Kunstplauderei. Endlich find ja im Dom selbst
noch so viele Spuren alter Farbenkunst von dem sapphirnen Meere auf dsr
inneren westlichsn Chorschlußwand bis zu — — —, jedoch hierüber sin
ander Mal.
Therlen wir nun wiedsr nach der Grundirung unser Lhor auf beiden
Seiten gegen Rorden und Süden in drei Rahmsn, so würde ich in den
äußerstsn Ostsn den Heiland setzen, der ja im Schriftausdrucke unssr ewiger
Osten aus der Höhe ist und bleiben wird, und zu welchem die christltche
Arche hinstsuert. Mit dem Worte Heiland ist aber nichts Bestimmtes gesagt;
darum sagen wir lieber dsr Auferstandene, aus dem Grabsteine fich em-
porhedend mit der dreizipfeligsn Fahns als Sieger über Tod und Holle.
Es bedarf wobl keiner Ausführung, wie gerade die Asferstehung die Be-
stätigung und das Zisl des Christenthums und ssinerDome ist; ist doch der
Aufsrstandene dsrselbe, der gsgsn Himmel fuhr, dersslbe, der einst wteder-
kehrea wird als Richter der Lsbendigen und der Todten. Wiederkehrsn aber
wird er mit dem Zeichen deS Heiles, in welchsm wir alle erloset find, dem
Areuze. Da, wie wir früber ausführten, die Nordseite im vaterstädtischen
Gsißs gehalten werden soll, so kommt uns gerade sn dieser Stelle die alte
Sage vortrefflich zu Stattsn, gsmäß wslcher in der kaiserlichen Burg (uoch
übrig im Ramen Burgmausr) dis Weltkaisrrin voreinst haus'te, die Grün-
dertn der Kirche zu den golsensn Martyrsrn (Ȋ awrsos Llsrhwss), jetzt
St. Gereon, schon vsn Gregorius von Tours im sechsten Zahrhundert ge«
rübmt. Jch kann hier nicht unisrlaffsn, lieber Zw.! Dir Glück zu wünschen,
daß der Bstfall des aasgezeichnsten Mannes Dir nicht fthlen würde; denn
er rühmt die Gsrronskirche gerade darum, weil an ihr nichts Brenn-
bares stch vorfand, also auch kein hölzerner Dachstuhl, und so wäre
dieft häklige Frage für unft: liebes mitsprechendcs Köln entschieden. Helsna
als Kaiftrin und Aufstndsriu oder, wie dis alte Sprache sagt, Erfinderin,
wärde also die Nordseite schmücken. Ob das Kreuz noch etne Strahlenkcone
in der Kreuzung der Balken nach alter Wsift haben könnte, ist eins Frags
untergeordneter Art.
Rücken wir zum mittlcren Rahmen vor, so erinnern wir an das unoer-
brüchliche Gesctz der altsn Kunst, dsß mit dsm Heilande überall die jung-
fräuliche Muiter, mit dem Domchore auch in Süden das Muttergottes-
Chöichen verbundsn ist, serbundsn wsrden muß. Folglich kommt auf den
Mtttelrabmen dis hetlige Zungfrau als Sitz der Weisheit nach altge-
wohntsr'Darüellung auf dsm 'seffel, von welchem herab sie das aus dem
Schooße Kehende und segnende Christkind zeigt. Was das Zeigen bei der
hsiltgen Jungfrau bedeutet, babe ich so oft besprochen, daß ich kein weiterss
Wort darüber vcrliere. Lt losnsäiütuiu kruotum vsutiüs tul nobis . . .
ostenäe, kann der Dom eben so gut fär Alle beten, als der Einzslns für
fich. Der Dom ist dsr hsiligen Jungfrau, den betden Apostelfürsten, voezüg-
lich aber dsn hsiligen drsi Königen geweiht. Ob auch ihre Anbetung mit in
das Bild hineingejogen wsiden soll, bcdarf keiner Erörterung. Allerdings
wird ktn solchcs Mstsllgemälde seine Schwierigketten haden, aber die
grsßte Schwiertgkeit wird, wie ich mir eknbilde, der Ko steupunct ssin. Und
da spreche tch ungeschminkt mstNS Neinung aus: Lieber gar nichtS, als
halb; Ksln hat also den Beuiel zu ziehen. Punctum.
Auf der andsren Dachftite würde fich die Ausgießung deS hetligen
Geistss mit Maria in der Umg'dung dsr Apostel, und über jedem die feu-
rige Zunge ganz gut machrn. Allein Ksln, wie das voreinstige christliche
Konstantinopel, eine wahre Marisnüadt, Hat noch eine ganz eigenthümliche
B zichung zur hsiligen Iunzfrau, die jetzt nur Wenigen, noch vor etnigen
Jahrzebenden jedem Kinde bekannt war. Koln und die hetlige Jungfrau
stnd glsich alt, d. h. im Jahre ÜS vor Cdrtßus wurde Köln gegrünset, die
heiligs Jungfrau geboren. Am Cartbäuserwalle zwischsn St. Severin und
der Mühle ist nech die Znschrift zu lesen, welche am östlichen Ende des
früßeren Tarlhäusergedi.tes kieft Sage beglaubtgt. Diese liebliche Legende
ist vielfach künstlsrisch dargestellt, namentlich in St- MarkuS zu Benedig die
Begegnung am gsldenes Thore. Welche Wah! geiroffen wird, ist natürhich
nicht meine Sciche.
Der driits Rahmsn zunächst am Chorthürmchsn wnrds nach msinsm
Dafürhalten dis beiSen Apostelbilder Petrus und Paulus enthalkeu müssen.
Bekanntlich stehen fis im Jnneren des ThsreS nicht nur nnter ihren Mitftnd-
boten, sondein auch im Westen auf der Abschlußwand, die bals wegfallen
wird. Gerade diess Darstrllnng der Westwans wünschte ich auf dem/DaSe
beibehalren und ebenfalls die Wsppen deigesügt, «m dkr rrinnerung frü-
herer Jahrhunderts und ihrer Wohlthäter aufrecht zu h ilten. Nicht über-
flüsffg möchre für unftre Herrsn Äünfiler auch dis B-merkung setn, daß, ws
PerruS und Paukus zusammensteheu, »am-atlich b.-im Heilande, wie auch im
Chore noch zu fthen ist, eine seste Rezel besteht. Paulns ist nämlich der
Benjamin dsr Apostel, und er sagt von fich selbsr im Römerbrief, daß er
aus dem Stamme Benjamin enisproffsn sei. Um andere Ärände zu vsr-
schweigsn, geuuz: PauluS gehört zur Rechten deS Heilsndes, also nach
Süsen, Pstrus auf die linke ooer Nordftite.
So wäre uns noch die Visrung übrig, dis wir in zwei Theile theilsn,
so wie dsr Dachthurm fis theilt, in den nördlichsn uno südlichsn Querarm.
Da dis Breite von Norden nach Süden der ostwestlichm Läage nlchi ent-
spricht, auch die Hauptbedeutung und Vsrzierung dem Langschiffe gebührt,
so würde ich auf den Dächern der Bterung nur einzelne Figucen in ihren
Rahmen anbringen, und zwar ebenfalls drei auf jsder Sette.
Beginnen wir mit dem südlichen Querarme (die Färbung übergehs ich
einstweilen bis zu einer späteren Gelsgenheit), so nstgt sich das Dach aegen
Osten und Wssten. Dsr Osten gehört noch mit zum Thore, zur Opferstätte;
der Westen fällt der Latenktrche anheim. Jn Osten also paßts I) der ewige
Hohexriester Mslchksedech, entgsgenftehend dem Pckeftert-ume nach der
Ordnung Aaron's; 2) Sr. Cüristoph, der bekanntlich eine sinnbildliche
Riesenfigur ist, wovon die Gsschichte und seine Reliquie nichtS wetß, wie ich
an andsrcr Stelle erörtert habs; und 3) der Hciland als Pelikan, der
seine Zungen mit Vsrspritzung seine» sigenen BluteS lebenoig macht. Daß
spmbolische Thisre dsc chriftlichen Kunst nis fremd wrre», nie ftems blsiben
dürfen, dedarf keinsr Anseinandsrfttzung. Auf die Westseite wörde dann
paffsn: l) der gute Hirte, 2) dus Lamm aaf dem Eoangeltenfelsen mtt
dsn siec Paradisftsströmsn, selbstverständltch mit dem Kceuzntmbus und dem
am Kreuzftabe gekreuzten Fnße. Was durch den Felsen, die (Evangelten)
paradiefischen Ströms, vis Areuznng, veistnnbildet wird, darf ich äls be-
kannt vocaussetzen. Das dritte Bild dürfte fthr gut an Den enn-
nern, dem alles Opfer gilt, auch das dss guten Htrten und das des Lam-
mes, dsm ewigen Bater. Bekanntlich wird dieser in der altchcistltchen Bil-
dersprache dnrch die aus den Wolken hsrsortretende Hand dargesteüt, bei
rvelcher ich kurzwsg auf Didron (3ist, äs I)isu) verweise. Sehr schö« wäre
auch 'oie fegnende Hand über dcm Haupte der makellos Tmpfangenen; allein
hieräber kann ich wieder kurz ftin, da ich nsch jüngst diesen Gegenstand ge-
mäß der Schrift in Baudri's Organ sür chrtstliche Kunst behandelt habe.
Nshmsn wir jetzt dsn nördlichen Querarm, so verweift ich auf meinen
früheren Borschlag, dsr dft Rordseite örtlich, d. h. kölnisch, gehalten wisscn
will. Um also mit dem Gesagten in Einklang zu bletben, werden wir nm
so mehr uns zu den Hsiligen Kölns senden müffen, als dteft denkwärdigs
Siadt ftlbst ein großss Stück deutscher Gsschichte tst, ja, gerads um diess
Zrit nach dem Falls der Hohsnstauftn dte Angelegsnhetten des Vaterlandes
leitste. Paffen würden auf dte Opferseite gegen Osten: l) St. Ursula mit
einigen kleinen Figuren untsr ihrem Schutzs (Mantel); 2) St. Geresn;
Z) St. Engelbsrtus, der Leiter des Rsiches uns Martprer fär das Recht,
der schon vor Konrad von Hochsteden den neuen Dombau bsschloffen hatte.
Warum ich an dtese Seite drei Martprer gefttzt habe, erklärt das Wsrt
Oo frrstärte; deun der Martprer opfe te fich dcm Hrrro, wte der Herr ßch
ovferte für uns alle. Für dft Scits gegrn Weftc-n wähle ich folgendr Nicht-
martprer ans; 1) St. Seoerinus, 2) St. CanibertuS, 3) endlich de« wahr-
scheinlichen Baumeister «aseres DomeS AlbertsS MagnsS. Da dke Genann-
ten den Bogen des geistigcn Friedens über Kölns Himmel zogcn, so könnte
man diefts finnig andeutin.
Vorräthig im Secretariate des Central-Dombau-Vereins
(Rathhausplatz Nr. 3):
Dcr Dom von Kölu
und
Das Müttstex vSN StesH-tteg.
Von
Z. v. Görrcs.
Der Ertr«rg ist zurn Dombau bestinrmt.
Regensburg, 1842.
DLe Aegeude
vüll dcll heiligell drci Kölligen.
Znm Besten des kölner Dombaues.
Nach einer alten Handschrift herausgegeben
von
Karl Simrock.
Mit Bildern in Holzschnitten. 8. geh. 10 Sgr.
Berantwortlicher Hsrausgeber: I. I. NelleS in Köln.
Sommissions-Berlag und Druck von M. DuMont.Schanbsrg tn Koln.
(Erpedition der Kölnischen Zeitung.)
von I. Kreuser.
LZS.
Von der WHseite übersprings ich nun die Vierung und bsgebs mich
znr violetten
OKseite.
Violet? Run, was soll das h-ißen? Wir serwsissn einfach auf die
Kirchensprache. Biolst bsdeutet Dsmuth und BuKs, und die Kirche bedient
fich dieser Farbe zur Fastsnzeit. Thuet LuKe u. s. w., ruft Zohannes der
Lorläufsr, ruft der Heiland, rusen alle Rachfolger. Den Nichtdemüthigen
widerstebt der Herr, dcr fich selbst so sehr demüthigte und erniedrigte, daß
er Knechtesgestalt annahm. Gcrads den Demüthigen (I. Petr. III. 5) gibt
der Herr die Gnade des Chsrss; jedoch genug der Schriftstellsn. Aber, wird
Mancher sagen, da wird ja bei dem ewigen FLrben unser Dom eine wahre
bunte Kirmeß. Meinetwegen, wenn ihr es ss nennen wollt. Unser Herrgott
thut ja dasselbe im Zrüblinge, wann er Wald, Wiese, Flur in alle mögli-
chen und sie buntesten Farben kleidet, jsden Morgen und Abend dasselbe
Farbsnsxiel wiedsrholt, und seit Erschaffung der Welt, so viel ich wsiß, tst
eS noch Riemandem eingefallen, fich über diess Polpchromirung zu beklagen.
Gsnng, mir ist einmal die erlogene classische Nichtfärbung mit Kalk- und
Hppsgefichtern gründlrch widerlich, und ich bin der Meinung, daß an die
Wiedsrbslebung der Ännst durch Farbs nicht oft genug erinnert werden kann.
AllerdingS darf diess Färbung keins nsumodische Lnstreichers! in Oel sein,
die mit d-m Weißquaste und kem Aehrbesen auf gleicher Höhe steht, sondern
ich setze hisrbei voraus, daß die alten Miniaturmaler und ihrs noch zahlrsi-
chsn Usberbleibsel stndirt wrrdsn. Köln haite voreinst sein: geschickten und
geeh'ten Maler; doch eS genügs, hierbsi auf die sieißigen Forschungen un-
seres geehrten MitbürgerS Herrn Merls aufmsrksam zu machen, von dem
die kölnische Künstlerwslt weniger kennt, als ihr zur Ehre gereicht. Auch
haben wir ja in unserer Mitte unseren kunsterfahrenen Conservator Ram-
bour, der vor Allsn befähigt se!u möchte, Rath zu erthsilen, wo ssstes Wis-
sen noth ihut, absr keins Kunstplauderei. Endlich find ja im Dom selbst
noch so viele Spuren alter Farbenkunst von dem sapphirnen Meere auf dsr
inneren westlichsn Chorschlußwand bis zu — — —, jedoch hierüber sin
ander Mal.
Therlen wir nun wiedsr nach der Grundirung unser Lhor auf beiden
Seiten gegen Rorden und Süden in drei Rahmsn, so würde ich in den
äußerstsn Ostsn den Heiland setzen, der ja im Schriftausdrucke unssr ewiger
Osten aus der Höhe ist und bleiben wird, und zu welchem die christltche
Arche hinstsuert. Mit dem Worte Heiland ist aber nichts Bestimmtes gesagt;
darum sagen wir lieber dsr Auferstandene, aus dem Grabsteine fich em-
porhedend mit der dreizipfeligsn Fahns als Sieger über Tod und Holle.
Es bedarf wobl keiner Ausführung, wie gerade die Asferstehung die Be-
stätigung und das Zisl des Christenthums und ssinerDome ist; ist doch der
Aufsrstandene dsrselbe, der gsgsn Himmel fuhr, dersslbe, der einst wteder-
kehrea wird als Richter der Lsbendigen und der Todten. Wiederkehrsn aber
wird er mit dem Zeichen deS Heiles, in welchsm wir alle erloset find, dem
Areuze. Da, wie wir früber ausführten, die Nordseite im vaterstädtischen
Gsißs gehalten werden soll, so kommt uns gerade sn dieser Stelle die alte
Sage vortrefflich zu Stattsn, gsmäß wslcher in der kaiserlichen Burg (uoch
übrig im Ramen Burgmausr) dis Weltkaisrrin voreinst haus'te, die Grün-
dertn der Kirche zu den golsensn Martyrsrn (Ȋ awrsos Llsrhwss), jetzt
St. Gereon, schon vsn Gregorius von Tours im sechsten Zahrhundert ge«
rübmt. Jch kann hier nicht unisrlaffsn, lieber Zw.! Dir Glück zu wünschen,
daß der Bstfall des aasgezeichnsten Mannes Dir nicht fthlen würde; denn
er rühmt die Gsrronskirche gerade darum, weil an ihr nichts Brenn-
bares stch vorfand, also auch kein hölzerner Dachstuhl, und so wäre
dieft häklige Frage für unft: liebes mitsprechendcs Köln entschieden. Helsna
als Kaiftrin und Aufstndsriu oder, wie dis alte Sprache sagt, Erfinderin,
wärde also die Nordseite schmücken. Ob das Kreuz noch etne Strahlenkcone
in der Kreuzung der Balken nach alter Wsift haben könnte, ist eins Frags
untergeordneter Art.
Rücken wir zum mittlcren Rahmen vor, so erinnern wir an das unoer-
brüchliche Gesctz der altsn Kunst, dsß mit dsm Heilande überall die jung-
fräuliche Muiter, mit dem Domchore auch in Süden das Muttergottes-
Chöichen verbundsn ist, serbundsn wsrden muß. Folglich kommt auf den
Mtttelrabmen dis hetlige Zungfrau als Sitz der Weisheit nach altge-
wohntsr'Darüellung auf dsm 'seffel, von welchem herab sie das aus dem
Schooße Kehende und segnende Christkind zeigt. Was das Zeigen bei der
hsiltgen Jungfrau bedeutet, babe ich so oft besprochen, daß ich kein weiterss
Wort darüber vcrliere. Lt losnsäiütuiu kruotum vsutiüs tul nobis . . .
ostenäe, kann der Dom eben so gut fär Alle beten, als der Einzslns für
fich. Der Dom ist dsr hsiligen Jungfrau, den betden Apostelfürsten, voezüg-
lich aber dsn hsiligen drsi Königen geweiht. Ob auch ihre Anbetung mit in
das Bild hineingejogen wsiden soll, bcdarf keiner Erörterung. Allerdings
wird ktn solchcs Mstsllgemälde seine Schwierigketten haden, aber die
grsßte Schwiertgkeit wird, wie ich mir eknbilde, der Ko steupunct ssin. Und
da spreche tch ungeschminkt mstNS Neinung aus: Lieber gar nichtS, als
halb; Ksln hat also den Beuiel zu ziehen. Punctum.
Auf der andsren Dachftite würde fich die Ausgießung deS hetligen
Geistss mit Maria in der Umg'dung dsr Apostel, und über jedem die feu-
rige Zunge ganz gut machrn. Allein Ksln, wie das voreinstige christliche
Konstantinopel, eine wahre Marisnüadt, Hat noch eine ganz eigenthümliche
B zichung zur hsiligen Iunzfrau, die jetzt nur Wenigen, noch vor etnigen
Jahrzebenden jedem Kinde bekannt war. Koln und die hetlige Jungfrau
stnd glsich alt, d. h. im Jahre ÜS vor Cdrtßus wurde Köln gegrünset, die
heiligs Jungfrau geboren. Am Cartbäuserwalle zwischsn St. Severin und
der Mühle ist nech die Znschrift zu lesen, welche am östlichen Ende des
früßeren Tarlhäusergedi.tes kieft Sage beglaubtgt. Diese liebliche Legende
ist vielfach künstlsrisch dargestellt, namentlich in St- MarkuS zu Benedig die
Begegnung am gsldenes Thore. Welche Wah! geiroffen wird, ist natürhich
nicht meine Sciche.
Der driits Rahmsn zunächst am Chorthürmchsn wnrds nach msinsm
Dafürhalten dis beiSen Apostelbilder Petrus und Paulus enthalkeu müssen.
Bekanntlich stehen fis im Jnneren des ThsreS nicht nur nnter ihren Mitftnd-
boten, sondein auch im Westen auf der Abschlußwand, die bals wegfallen
wird. Gerade diess Darstrllnng der Westwans wünschte ich auf dem/DaSe
beibehalren und ebenfalls die Wsppen deigesügt, «m dkr rrinnerung frü-
herer Jahrhunderts und ihrer Wohlthäter aufrecht zu h ilten. Nicht über-
flüsffg möchre für unftre Herrsn Äünfiler auch dis B-merkung setn, daß, ws
PerruS und Paukus zusammensteheu, »am-atlich b.-im Heilande, wie auch im
Chore noch zu fthen ist, eine seste Rezel besteht. Paulns ist nämlich der
Benjamin dsr Apostel, und er sagt von fich selbsr im Römerbrief, daß er
aus dem Stamme Benjamin enisproffsn sei. Um andere Ärände zu vsr-
schweigsn, geuuz: PauluS gehört zur Rechten deS Heilsndes, also nach
Süsen, Pstrus auf die linke ooer Nordftite.
So wäre uns noch die Visrung übrig, dis wir in zwei Theile theilsn,
so wie dsr Dachthurm fis theilt, in den nördlichsn uno südlichsn Querarm.
Da dis Breite von Norden nach Süden der ostwestlichm Läage nlchi ent-
spricht, auch die Hauptbedeutung und Vsrzierung dem Langschiffe gebührt,
so würde ich auf den Dächern der Bterung nur einzelne Figucen in ihren
Rahmen anbringen, und zwar ebenfalls drei auf jsder Sette.
Beginnen wir mit dem südlichen Querarme (die Färbung übergehs ich
einstweilen bis zu einer späteren Gelsgenheit), so nstgt sich das Dach aegen
Osten und Wssten. Dsr Osten gehört noch mit zum Thore, zur Opferstätte;
der Westen fällt der Latenktrche anheim. Jn Osten also paßts I) der ewige
Hohexriester Mslchksedech, entgsgenftehend dem Pckeftert-ume nach der
Ordnung Aaron's; 2) Sr. Cüristoph, der bekanntlich eine sinnbildliche
Riesenfigur ist, wovon die Gsschichte und seine Reliquie nichtS wetß, wie ich
an andsrcr Stelle erörtert habs; und 3) der Hciland als Pelikan, der
seine Zungen mit Vsrspritzung seine» sigenen BluteS lebenoig macht. Daß
spmbolische Thisre dsc chriftlichen Kunst nis fremd wrre», nie ftems blsiben
dürfen, dedarf keinsr Anseinandsrfttzung. Auf die Westseite wörde dann
paffsn: l) der gute Hirte, 2) dus Lamm aaf dem Eoangeltenfelsen mtt
dsn siec Paradisftsströmsn, selbstverständltch mit dem Kceuzntmbus und dem
am Kreuzftabe gekreuzten Fnße. Was durch den Felsen, die (Evangelten)
paradiefischen Ströms, vis Areuznng, veistnnbildet wird, darf ich äls be-
kannt vocaussetzen. Das dritte Bild dürfte fthr gut an Den enn-
nern, dem alles Opfer gilt, auch das dss guten Htrten und das des Lam-
mes, dsm ewigen Bater. Bekanntlich wird dieser in der altchcistltchen Bil-
dersprache dnrch die aus den Wolken hsrsortretende Hand dargesteüt, bei
rvelcher ich kurzwsg auf Didron (3ist, äs I)isu) verweise. Sehr schö« wäre
auch 'oie fegnende Hand über dcm Haupte der makellos Tmpfangenen; allein
hieräber kann ich wieder kurz ftin, da ich nsch jüngst diesen Gegenstand ge-
mäß der Schrift in Baudri's Organ sür chrtstliche Kunst behandelt habe.
Nshmsn wir jetzt dsn nördlichen Querarm, so verweift ich auf meinen
früheren Borschlag, dsr dft Rordseite örtlich, d. h. kölnisch, gehalten wisscn
will. Um also mit dem Gesagten in Einklang zu bletben, werden wir nm
so mehr uns zu den Hsiligen Kölns senden müffen, als dteft denkwärdigs
Siadt ftlbst ein großss Stück deutscher Gsschichte tst, ja, gerads um diess
Zrit nach dem Falls der Hohsnstauftn dte Angelegsnhetten des Vaterlandes
leitste. Paffen würden auf dte Opferseite gegen Osten: l) St. Ursula mit
einigen kleinen Figuren untsr ihrem Schutzs (Mantel); 2) St. Geresn;
Z) St. Engelbsrtus, der Leiter des Rsiches uns Martprer fär das Recht,
der schon vor Konrad von Hochsteden den neuen Dombau bsschloffen hatte.
Warum ich an dtese Seite drei Martprer gefttzt habe, erklärt das Wsrt
Oo frrstärte; deun der Martprer opfe te fich dcm Hrrro, wte der Herr ßch
ovferte für uns alle. Für dft Scits gegrn Weftc-n wähle ich folgendr Nicht-
martprer ans; 1) St. Seoerinus, 2) St. CanibertuS, 3) endlich de« wahr-
scheinlichen Baumeister «aseres DomeS AlbertsS MagnsS. Da dke Genann-
ten den Bogen des geistigcn Friedens über Kölns Himmel zogcn, so könnte
man diefts finnig andeutin.
Vorräthig im Secretariate des Central-Dombau-Vereins
(Rathhausplatz Nr. 3):
Dcr Dom von Kölu
und
Das Müttstex vSN StesH-tteg.
Von
Z. v. Görrcs.
Der Ertr«rg ist zurn Dombau bestinrmt.
Regensburg, 1842.
DLe Aegeude
vüll dcll heiligell drci Kölligen.
Znm Besten des kölner Dombaues.
Nach einer alten Handschrift herausgegeben
von
Karl Simrock.
Mit Bildern in Holzschnitten. 8. geh. 10 Sgr.
Berantwortlicher Hsrausgeber: I. I. NelleS in Köln.
Sommissions-Berlag und Druck von M. DuMont.Schanbsrg tn Koln.
(Erpedition der Kölnischen Zeitung.)