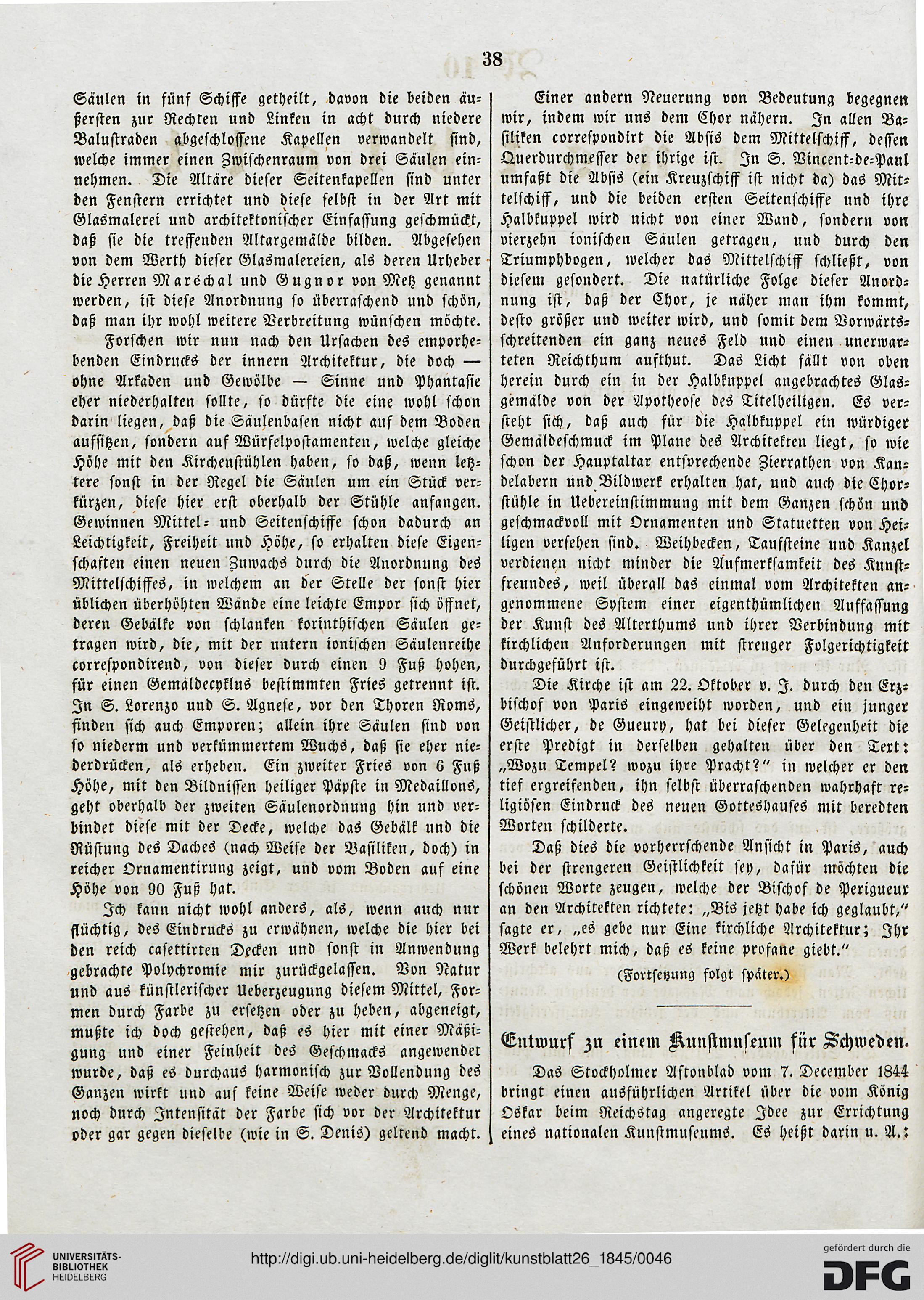38
Säulen in fünf Schiffe gelheilt, davon die beiden äu-
ßersten zur Rechten und Linken in acht durch niedere
Balustraden abgeschlossene Kapellen verwandelt sind,
welche immer einen Zwischenraum von drei Säulen ein-
nehmen. Die Altäre dieser Seitenkapellen sind unter
den Fenstern errichtet und diese selbst in der Art mit
Glasmalerei und architektonischer Einfassung geschmückt,
baß sie die treffenden Altargemälde bilden. Abgesehen
von dem Werth dieser Glasmalereien, als deren Urheber
die Herren M aröcbal und Gugn or von Metz genannt
werden, ist diese Anordnung so überraschend und schön,
daß man ihr wohl weitere Verbreitung wünschen möchte.
Forschen wir nun nach den Ursachen des emporhe-
benden Eindrucks der inuern Architektur, die doch —
ohne Arkaden und Gewölbe — Sinne und Phantasie
eher niederhalten sollte, so dürfte die eine wohl schon
darin liegen, daß die Säulenbasen nicht auf dem Boden
aufsitzen, sondern auf Würfelpostamenten, welche gleiche
Höhe mit den Kircheustühlen haben, so daß, wenn letz-
tere sonst in der Regel die Säulen um ein Stück ver-
kürzen, diese hier erst oberhalb der Stühle anfaugen.
Gewinnen Mittel- und Seitenschiffe schon dadurch an
Leichtigkeit, Freiheit und Höhe, so erhalten diese Eigen-
schaften einen neuen Zuwachs durch die Anordnung des
Mittelschiffes, in welchem an der Stelle der sonst hier
üblichen überhöhten Wände eine leichte Empor sich öffnet,
deren Gebälke von schlanken korinthischen Säulen ge-
tragen wird, die, mit der untern ionischen Säulenreihe
cvrrespondirend, von dieser durch einen 9 Fuß hohen,
für einen Gemäldccyklus bestimmten Fries getrennt ist.
In S. Lorenzo und S. Agnese, vor den Thoren Roms,
finden sich auch Emporen; allein ihre Säulen sind von
so niederm und verkümmertem Wuchs, daß sie eher Nie-
derdrücken, als erheben. Ein zweiter Fries von 6 Fuß
Höhe, mit den Bildnissen heiliger Päpste in Medaillons,
geht oberhalb der zweiten Säulenordnung hin und ver-
bindet diese mit der Decke, welche das Gebälk und die
Rüstung des Daches (nach Weise der Basiliken, doch) in
reicher Ornamentirung zeigt, und vom Boden auf eine
Höhe von 9V Fuß hat.
Ich kann nicht wohl anders, als, wenn auch nur
flüchtig, des Eindrucks zu erwähnen, welche die hier bei
den reich casettirten Decken und sonst in Anwendung
gebrachte Polychromie mir zurückgelassen. Von Natur
und aus künstlerischer Ueberzcugung diesem Mittel, For-
men durch Farbe zu ersetzen oder zu heben, abgeneigt,
mußte ich doch gestehen, daß es hier mit einer Mäßi-
gung und einer Feinheit des Geschmacks angeweuder
wurde, daß es durchaus harmonisch zur Vollendung des
Ganzen wirkt und auf keine Weise weder durch Menge,
noch durch Intensität der Farbe sich vor der Architektur
oder gar gegen dieselbe (wie in S. Denis) geltend macht.
Einer andern Neuerung von Bedeutung begegnen
wir, indem wir uns dem Chor nähern. 2" allen Ba-
siliken correspondirt die Absis dem Mittelschiff, dessen
Querdnrchmesser der ihrige ist. In S. Vinceut-de-Paul
umfaßt die Absis (ein Kreuzschiff ist nicht da) das Mit-
telschiff, und die beiden ersten Seitenschiffe und ihre
Halbkuppel wird nicht von einer Wand, sondern von
vierzehn ionischen Säulen getragen, und durch den
Triumphbogen, welcher das Mittelschiff schließt, von
diesem gesondert. Die natürliche Folge dieser Anord-
nung ist, daß der Chor, je näher man ihm kommt,
desto größer und weiter wird, und somit dem Vorwärts-
schreitenden ein ganz neues Feld und einen unerwar-
teten Reichthum aufthut. Das Licht fällt von oben
herein durch ein in der Halbkuppel angebrachtes Glas-
gemälde von der Apotheose des Titelheiligen. Es ver-
steht sich, daß auch für die Halbkuppel ein würdiger
Gemäldeschmuck im Plane des Architekten liegt, so wie
schon der Hauptaltar entsprechende Zierrathen von Kan-
delabern und Bildwerk erhalten hat, und auch die Chor-
stühle in Uebereinstimmung mit dem Ganzen schön und
geschmackvoll mit Ornamenten und Statuetten von Hei-
ligen versehen sind. Weihbecken, Taufsteine und Kanzel
verdienen nicht minder die Aufmerksamkeit des Kunst-
freundes, weil überall das einmal vom Architekten an-
genommene System einer eigeuthümlichen Auffassung
der Kunst des Alterthums und ihrer Verbindung mit
kirchlichen Anforderungen mit strenger Folgerichtigkeit
durchgeführt ist.
Die Kirche ist am 22. Oktober v. I. durch den Erz-
bischof von Paris eingeweiht worden, und ein junger
Geistlicher, de Gueury, hat bei dieser Gelegenheit die
erste Predigt in derselben gehalten über den Tert:
„Wozu Tempel? wozu ihre Pracht?" in welcher er den
tief ergreifenden, ihn selbst überraschenden wahrhaft re-
ligiösen Eindruck des neuen Gotteshauses mit beredten
Worten schilderte.
Daß dies die vorherrschende Ansicht in Paris, auch
bei der strengeren Geistlichkeit sey, dafür möchten die
schönen Worte zeugen, welche der Bischof de Perigueur
an den Architekten richtete: „Biö jetzt habe ich geglaubt,"
sagte er, „es gebe nur Eine kirchliche Architektur; Ihr
Werk belehrt mich, daß eS keine profane giebt."
(Fortsetzung folgt später.)
Entwurf zu einem Kunstmuseum für Schweden.
Das Stockholmer Aftonblad vom 7. Deceniber 1844
bringt einen ausführlichen Artikel über die vom König
Oskar beim Reichstag angeregte Idee zur Errichtung
eines nationalen Kunstmuseums. Es heißt darin u. A.:
Säulen in fünf Schiffe gelheilt, davon die beiden äu-
ßersten zur Rechten und Linken in acht durch niedere
Balustraden abgeschlossene Kapellen verwandelt sind,
welche immer einen Zwischenraum von drei Säulen ein-
nehmen. Die Altäre dieser Seitenkapellen sind unter
den Fenstern errichtet und diese selbst in der Art mit
Glasmalerei und architektonischer Einfassung geschmückt,
baß sie die treffenden Altargemälde bilden. Abgesehen
von dem Werth dieser Glasmalereien, als deren Urheber
die Herren M aröcbal und Gugn or von Metz genannt
werden, ist diese Anordnung so überraschend und schön,
daß man ihr wohl weitere Verbreitung wünschen möchte.
Forschen wir nun nach den Ursachen des emporhe-
benden Eindrucks der inuern Architektur, die doch —
ohne Arkaden und Gewölbe — Sinne und Phantasie
eher niederhalten sollte, so dürfte die eine wohl schon
darin liegen, daß die Säulenbasen nicht auf dem Boden
aufsitzen, sondern auf Würfelpostamenten, welche gleiche
Höhe mit den Kircheustühlen haben, so daß, wenn letz-
tere sonst in der Regel die Säulen um ein Stück ver-
kürzen, diese hier erst oberhalb der Stühle anfaugen.
Gewinnen Mittel- und Seitenschiffe schon dadurch an
Leichtigkeit, Freiheit und Höhe, so erhalten diese Eigen-
schaften einen neuen Zuwachs durch die Anordnung des
Mittelschiffes, in welchem an der Stelle der sonst hier
üblichen überhöhten Wände eine leichte Empor sich öffnet,
deren Gebälke von schlanken korinthischen Säulen ge-
tragen wird, die, mit der untern ionischen Säulenreihe
cvrrespondirend, von dieser durch einen 9 Fuß hohen,
für einen Gemäldccyklus bestimmten Fries getrennt ist.
In S. Lorenzo und S. Agnese, vor den Thoren Roms,
finden sich auch Emporen; allein ihre Säulen sind von
so niederm und verkümmertem Wuchs, daß sie eher Nie-
derdrücken, als erheben. Ein zweiter Fries von 6 Fuß
Höhe, mit den Bildnissen heiliger Päpste in Medaillons,
geht oberhalb der zweiten Säulenordnung hin und ver-
bindet diese mit der Decke, welche das Gebälk und die
Rüstung des Daches (nach Weise der Basiliken, doch) in
reicher Ornamentirung zeigt, und vom Boden auf eine
Höhe von 9V Fuß hat.
Ich kann nicht wohl anders, als, wenn auch nur
flüchtig, des Eindrucks zu erwähnen, welche die hier bei
den reich casettirten Decken und sonst in Anwendung
gebrachte Polychromie mir zurückgelassen. Von Natur
und aus künstlerischer Ueberzcugung diesem Mittel, For-
men durch Farbe zu ersetzen oder zu heben, abgeneigt,
mußte ich doch gestehen, daß es hier mit einer Mäßi-
gung und einer Feinheit des Geschmacks angeweuder
wurde, daß es durchaus harmonisch zur Vollendung des
Ganzen wirkt und auf keine Weise weder durch Menge,
noch durch Intensität der Farbe sich vor der Architektur
oder gar gegen dieselbe (wie in S. Denis) geltend macht.
Einer andern Neuerung von Bedeutung begegnen
wir, indem wir uns dem Chor nähern. 2" allen Ba-
siliken correspondirt die Absis dem Mittelschiff, dessen
Querdnrchmesser der ihrige ist. In S. Vinceut-de-Paul
umfaßt die Absis (ein Kreuzschiff ist nicht da) das Mit-
telschiff, und die beiden ersten Seitenschiffe und ihre
Halbkuppel wird nicht von einer Wand, sondern von
vierzehn ionischen Säulen getragen, und durch den
Triumphbogen, welcher das Mittelschiff schließt, von
diesem gesondert. Die natürliche Folge dieser Anord-
nung ist, daß der Chor, je näher man ihm kommt,
desto größer und weiter wird, und somit dem Vorwärts-
schreitenden ein ganz neues Feld und einen unerwar-
teten Reichthum aufthut. Das Licht fällt von oben
herein durch ein in der Halbkuppel angebrachtes Glas-
gemälde von der Apotheose des Titelheiligen. Es ver-
steht sich, daß auch für die Halbkuppel ein würdiger
Gemäldeschmuck im Plane des Architekten liegt, so wie
schon der Hauptaltar entsprechende Zierrathen von Kan-
delabern und Bildwerk erhalten hat, und auch die Chor-
stühle in Uebereinstimmung mit dem Ganzen schön und
geschmackvoll mit Ornamenten und Statuetten von Hei-
ligen versehen sind. Weihbecken, Taufsteine und Kanzel
verdienen nicht minder die Aufmerksamkeit des Kunst-
freundes, weil überall das einmal vom Architekten an-
genommene System einer eigeuthümlichen Auffassung
der Kunst des Alterthums und ihrer Verbindung mit
kirchlichen Anforderungen mit strenger Folgerichtigkeit
durchgeführt ist.
Die Kirche ist am 22. Oktober v. I. durch den Erz-
bischof von Paris eingeweiht worden, und ein junger
Geistlicher, de Gueury, hat bei dieser Gelegenheit die
erste Predigt in derselben gehalten über den Tert:
„Wozu Tempel? wozu ihre Pracht?" in welcher er den
tief ergreifenden, ihn selbst überraschenden wahrhaft re-
ligiösen Eindruck des neuen Gotteshauses mit beredten
Worten schilderte.
Daß dies die vorherrschende Ansicht in Paris, auch
bei der strengeren Geistlichkeit sey, dafür möchten die
schönen Worte zeugen, welche der Bischof de Perigueur
an den Architekten richtete: „Biö jetzt habe ich geglaubt,"
sagte er, „es gebe nur Eine kirchliche Architektur; Ihr
Werk belehrt mich, daß eS keine profane giebt."
(Fortsetzung folgt später.)
Entwurf zu einem Kunstmuseum für Schweden.
Das Stockholmer Aftonblad vom 7. Deceniber 1844
bringt einen ausführlichen Artikel über die vom König
Oskar beim Reichstag angeregte Idee zur Errichtung
eines nationalen Kunstmuseums. Es heißt darin u. A.: