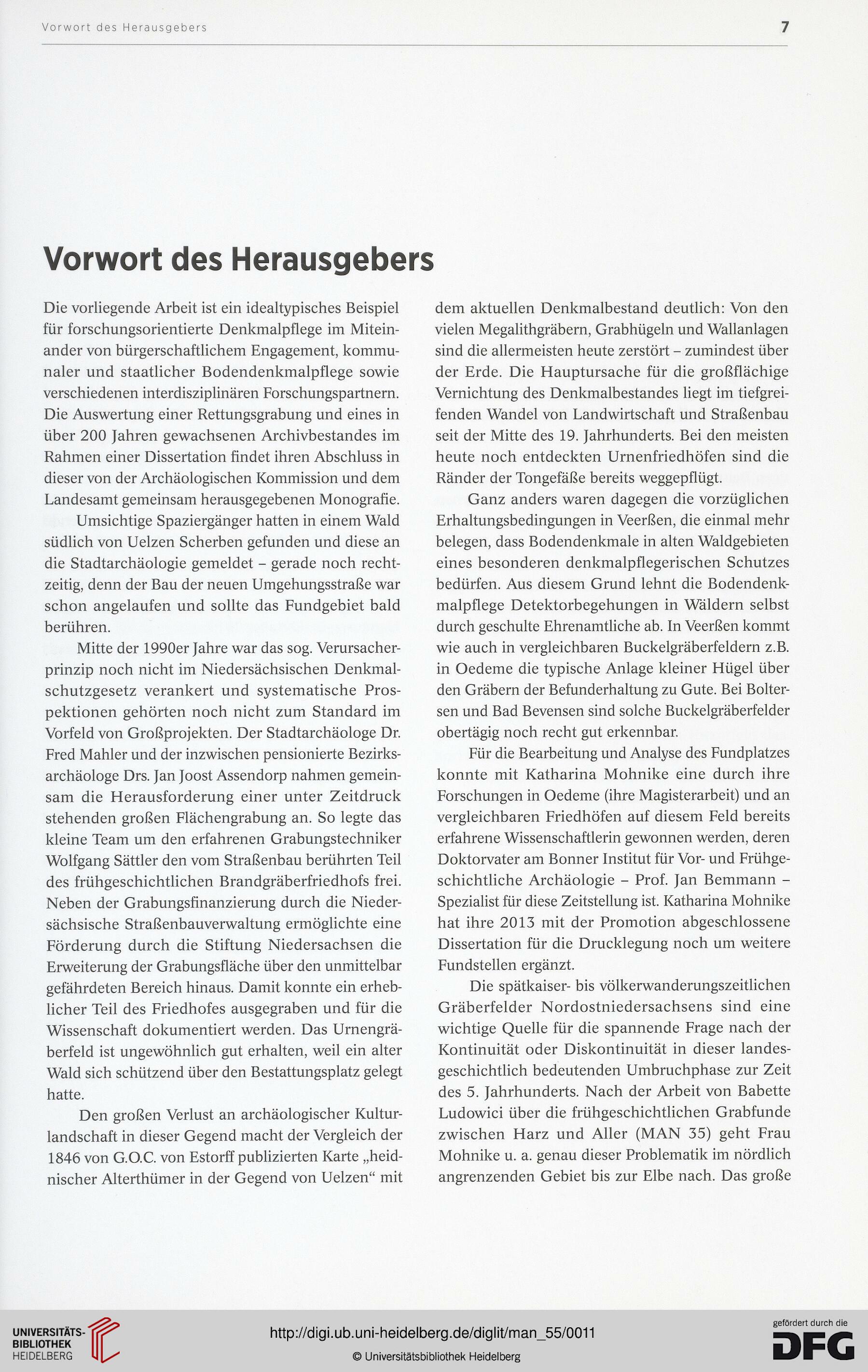Vorwort des Herausgebers
7
Vorwort des Herausgebers
Die vorliegende Arbeit ist ein idealtypisches Beispiel
für forschungsorientierte Denkmalpflege im Mitein-
ander von bürgerschaftlichem Engagement, kommu-
naler und staatlicher Bodendenkmalpflege sowie
verschiedenen interdisziplinären Forschungspartnern.
Die Auswertung einer Rettungsgrabung und eines in
über 200 Jahren gewachsenen Archivbestandes im
Rahmen einer Dissertation findet ihren Abschluss in
dieser von der Archäologischen Kommission und dem
Landesamt gemeinsam herausgegebenen Monografie.
Umsichtige Spaziergänger hatten in einem Wald
südlich von Uelzen Scherben gefunden und diese an
die Stadtarchäologie gemeldet - gerade noch recht-
zeitig, denn der Bau der neuen Umgehungsstraße war
schon angelaufen und sollte das Fundgebiet bald
berühren.
Mitte der 1990er Jahre war das sog. Verursacher-
prinzip noch nicht im Niedersächsischen Denkmal-
schutzgesetz verankert und systematische Pros-
pektionen gehörten noch nicht zum Standard im
Vorfeld von Großprojekten. Der Stadtarchäologe Dr.
Fred Mahler und der inzwischen pensionierte Bezirks-
archäologe Drs. Jan Joost Assendorp nahmen gemein-
sam die Herausforderung einer unter Zeitdruck
stehenden großen Flächengrabung an. So legte das
kleine Team um den erfahrenen Grabungstechniker
Wolfgang Sättler den vom Straßenbau berührten Teil
des frühgeschichtlichen Brandgräberfriedhofs frei.
Neben der Grabungsfinanzierung durch die Nieder-
sächsische Straßenbauverwaltung ermöglichte eine
Förderung durch die Stiftung Niedersachsen die
Erweiterung der Grabungsfläche über den unmittelbar
gefährdeten Bereich hinaus. Damit konnte ein erheb-
licher Teil des Friedhofes ausgegraben und für die
Wissenschaft dokumentiert werden. Das Urnengrä-
berfeld ist ungewöhnlich gut erhalten, weil ein alter
Wald sich schützend über den Bestattungsplatz gelegt
hatte.
Den großen Verlust an archäologischer Kultur-
landschaft in dieser Gegend macht der Vergleich der
1846 von G.O.C. von Estorff publizierten Karte „heid-
nischer Alterthümer in der Gegend von Uelzen" mit
dem aktuellen Denkmalbestand deutlich: Von den
vielen Megalithgräbern, Grabhügeln und Wallanlagen
sind die allermeisten heute zerstört - zumindest über
der Erde. Die Hauptursache für die großflächige
Vernichtung des Denkmalbestandes liegt im tiefgrei-
fenden Wandel von Landwirtschaft und Straßenbau
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Bei den meisten
heute noch entdeckten Urnenfriedhöfen sind die
Ränder der Tongefäße bereits weggepflügt.
Ganz anders waren dagegen die vorzüglichen
Erhaltungsbedingungen in Veerßen, die einmal mehr
belegen, dass Bodendenkmale in alten Waldgebieten
eines besonderen denkmalpflegerischen Schutzes
bedürfen. Aus diesem Grund lehnt die Bodendenk-
malpflege Detektorbegehungen in Wäldern selbst
durch geschulte Ehrenamtliche ab. In Veerßen kommt
wie auch in vergleichbaren Buckelgräberfeldern z.B.
in Oedeme die typische Anlage kleiner Hügel über
den Gräbern der Befunderhaltung zu Gute. Bei Bolter-
sen und Bad Bevensen sind solche Buckelgräberfelder
obertägig noch recht gut erkennbar.
Für die Bearbeitung und Analyse des Fundplatzes
konnte mit Katharina Mohnike eine durch ihre
Forschungen in Oedeme (ihre Magisterarbeit) und an
vergleichbaren Friedhöfen auf diesem Feld bereits
erfahrene Wissenschaftlerin gewonnen werden, deren
Doktorvater am Bonner Institut für Vor- und Frühge-
schichtliche Archäologie - Prof. Jan Bemmann -
Spezialist für diese Zeitstellung ist. Katharina Mohnike
hat ihre 2013 mit der Promotion abgeschlossene
Dissertation für die Drucklegung noch um weitere
Fundstellen ergänzt.
Die spätkaiser- bis völkerwanderungszeitlichen
Gräberfelder Nordostniedersachsens sind eine
wichtige Quelle für die spannende Frage nach der
Kontinuität oder Diskontinuität in dieser landes-
geschichtlich bedeutenden Umbruchphase zur Zeit
des 5. Jahrhunderts. Nach der Arbeit von Babette
Ludowici über die frühgeschichtlichen Grabfunde
zwischen Harz und Aller (MAN 35) geht Frau
Mohnike u. a. genau dieser Problematik im nördlich
angrenzenden Gebiet bis zur Elbe nach. Das große
7
Vorwort des Herausgebers
Die vorliegende Arbeit ist ein idealtypisches Beispiel
für forschungsorientierte Denkmalpflege im Mitein-
ander von bürgerschaftlichem Engagement, kommu-
naler und staatlicher Bodendenkmalpflege sowie
verschiedenen interdisziplinären Forschungspartnern.
Die Auswertung einer Rettungsgrabung und eines in
über 200 Jahren gewachsenen Archivbestandes im
Rahmen einer Dissertation findet ihren Abschluss in
dieser von der Archäologischen Kommission und dem
Landesamt gemeinsam herausgegebenen Monografie.
Umsichtige Spaziergänger hatten in einem Wald
südlich von Uelzen Scherben gefunden und diese an
die Stadtarchäologie gemeldet - gerade noch recht-
zeitig, denn der Bau der neuen Umgehungsstraße war
schon angelaufen und sollte das Fundgebiet bald
berühren.
Mitte der 1990er Jahre war das sog. Verursacher-
prinzip noch nicht im Niedersächsischen Denkmal-
schutzgesetz verankert und systematische Pros-
pektionen gehörten noch nicht zum Standard im
Vorfeld von Großprojekten. Der Stadtarchäologe Dr.
Fred Mahler und der inzwischen pensionierte Bezirks-
archäologe Drs. Jan Joost Assendorp nahmen gemein-
sam die Herausforderung einer unter Zeitdruck
stehenden großen Flächengrabung an. So legte das
kleine Team um den erfahrenen Grabungstechniker
Wolfgang Sättler den vom Straßenbau berührten Teil
des frühgeschichtlichen Brandgräberfriedhofs frei.
Neben der Grabungsfinanzierung durch die Nieder-
sächsische Straßenbauverwaltung ermöglichte eine
Förderung durch die Stiftung Niedersachsen die
Erweiterung der Grabungsfläche über den unmittelbar
gefährdeten Bereich hinaus. Damit konnte ein erheb-
licher Teil des Friedhofes ausgegraben und für die
Wissenschaft dokumentiert werden. Das Urnengrä-
berfeld ist ungewöhnlich gut erhalten, weil ein alter
Wald sich schützend über den Bestattungsplatz gelegt
hatte.
Den großen Verlust an archäologischer Kultur-
landschaft in dieser Gegend macht der Vergleich der
1846 von G.O.C. von Estorff publizierten Karte „heid-
nischer Alterthümer in der Gegend von Uelzen" mit
dem aktuellen Denkmalbestand deutlich: Von den
vielen Megalithgräbern, Grabhügeln und Wallanlagen
sind die allermeisten heute zerstört - zumindest über
der Erde. Die Hauptursache für die großflächige
Vernichtung des Denkmalbestandes liegt im tiefgrei-
fenden Wandel von Landwirtschaft und Straßenbau
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Bei den meisten
heute noch entdeckten Urnenfriedhöfen sind die
Ränder der Tongefäße bereits weggepflügt.
Ganz anders waren dagegen die vorzüglichen
Erhaltungsbedingungen in Veerßen, die einmal mehr
belegen, dass Bodendenkmale in alten Waldgebieten
eines besonderen denkmalpflegerischen Schutzes
bedürfen. Aus diesem Grund lehnt die Bodendenk-
malpflege Detektorbegehungen in Wäldern selbst
durch geschulte Ehrenamtliche ab. In Veerßen kommt
wie auch in vergleichbaren Buckelgräberfeldern z.B.
in Oedeme die typische Anlage kleiner Hügel über
den Gräbern der Befunderhaltung zu Gute. Bei Bolter-
sen und Bad Bevensen sind solche Buckelgräberfelder
obertägig noch recht gut erkennbar.
Für die Bearbeitung und Analyse des Fundplatzes
konnte mit Katharina Mohnike eine durch ihre
Forschungen in Oedeme (ihre Magisterarbeit) und an
vergleichbaren Friedhöfen auf diesem Feld bereits
erfahrene Wissenschaftlerin gewonnen werden, deren
Doktorvater am Bonner Institut für Vor- und Frühge-
schichtliche Archäologie - Prof. Jan Bemmann -
Spezialist für diese Zeitstellung ist. Katharina Mohnike
hat ihre 2013 mit der Promotion abgeschlossene
Dissertation für die Drucklegung noch um weitere
Fundstellen ergänzt.
Die spätkaiser- bis völkerwanderungszeitlichen
Gräberfelder Nordostniedersachsens sind eine
wichtige Quelle für die spannende Frage nach der
Kontinuität oder Diskontinuität in dieser landes-
geschichtlich bedeutenden Umbruchphase zur Zeit
des 5. Jahrhunderts. Nach der Arbeit von Babette
Ludowici über die frühgeschichtlichen Grabfunde
zwischen Harz und Aller (MAN 35) geht Frau
Mohnike u. a. genau dieser Problematik im nördlich
angrenzenden Gebiet bis zur Elbe nach. Das große