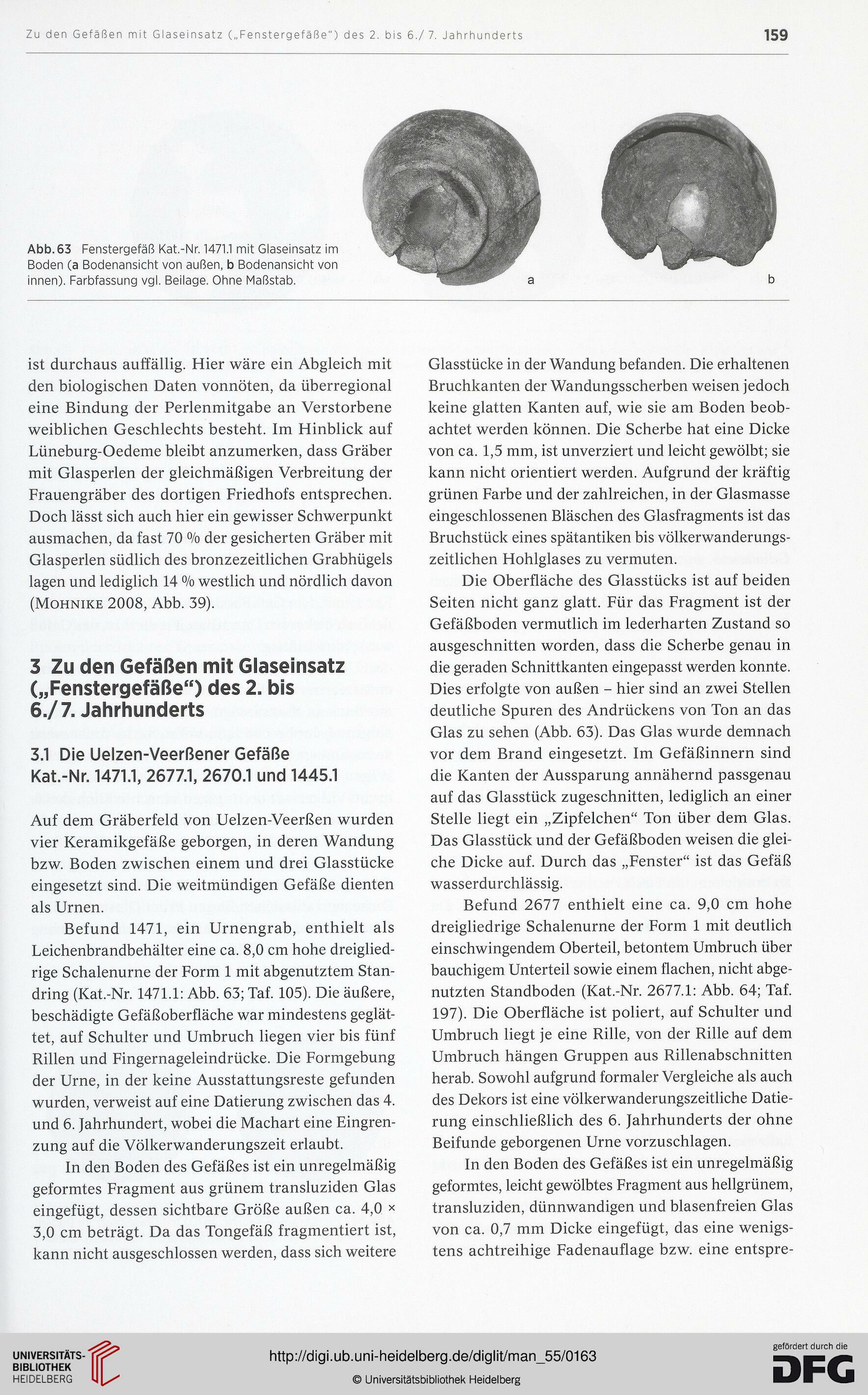Zu den Gefäßen mit Glaseinsatz („Fenstergefäße") des 2. bis 6./ 7. Jahrhunderts
159
Abb.63 Fenstergefäß Kat.-Nr. 1471.1 mit Glaseinsatz im
Boden (a Bodenansicht von außen, b Bodenansicht von
innen). Farbfassung vgl. Beilage. Ohne Maßstab.
ist durchaus auffällig. Hier wäre ein Abgleich mit
den biologischen Daten vonnöten, da überregional
eine Bindung der Perlenmitgabe an Verstorbene
weiblichen Geschlechts besteht. Im Hinblick auf
Lüneburg-Oedeme bleibt anzumerken, dass Gräber
mit Glasperlen der gleichmäßigen Verbreitung der
Frauengräber des dortigen Friedhofs entsprechen.
Doch lässt sich auch hier ein gewisser Schwerpunkt
ausmachen, da fast 70 % der gesicherten Gräber mit
Glasperlen südlich des bronzezeitlichen Grabhügels
lagen und lediglich 14 % westlich und nördlich davon
(Mohnike 2008, Abb. 39).
3 Zu den Gefäßen mit Glaseinsatz
(„Fenstergefäße") des 2. bis
6./ 7. Jahrhunderts
3.1 Die Uelzen-Veerßener Gefäße
Kat.-Nr. 1471.1, 2677.1, 2670.1 und 1445.1
Auf dem Gräberfeld von Uelzen-Veerßen wurden
vier Keramikgefäße geborgen, in deren Wandung
bzw. Boden zwischen einem und drei Glasstücke
eingesetzt sind. Die weitmündigen Gefäße dienten
als Urnen.
Befund 1471, ein Urnengrab, enthielt als
Leichenbrandbehälter eine ca. 8,0 cm hohe dreiglied-
rige Schalenurne der Form 1 mit abgenutztem Stan-
dring (Kat.-Nr. 1471.1: Abb. 63; Taf. 105). Die äußere,
beschädigte Gefäßoberfläche war mindestens geglät-
tet, auf Schulter und Umbruch liegen vier bis fünf
Rillen und Fingernageleindrücke. Die Formgebung
der Urne, in der keine Ausstattungsreste gefunden
wurden, verweist auf eine Datierung zwischen das 4.
und 6. Jahrhundert, wobei die Machart eine Eingren-
zung auf die Völkerwanderungszeit erlaubt.
In den Boden des Gefäßes ist ein unregelmäßig
geformtes Fragment aus grünem transluziden Glas
eingefügt, dessen sichtbare Größe außen ca. 4,0 x
3,0 cm beträgt. Da das Tongefäß fragmentiert ist,
kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere
Glasstücke in der Wandung befanden. Die erhaltenen
Bruchkanten der Wandungsscherben weisen jedoch
keine glatten Kanten auf, wie sie am Boden beob-
achtet werden können. Die Scherbe hat eine Dicke
von ca. 1,5 mm, ist unverziert und leicht gewölbt; sie
kann nicht orientiert werden. Aufgrund der kräftig
grünen Farbe und der zahlreichen, in der Glasmasse
eingeschlossenen Bläschen des Glasfragments ist das
Bruchstück eines spätantiken bis völkerwanderungs-
zeitlichen Hohlglases zu vermuten.
Die Oberfläche des Glasstücks ist auf beiden
Seiten nicht ganz glatt. Für das Fragment ist der
Gefäßboden vermutlich im lederharten Zustand so
ausgeschnitten worden, dass die Scherbe genau in
die geraden Schnittkanten eingepasst werden konnte.
Dies erfolgte von außen - hier sind an zwei Stellen
deutliche Spuren des Andrückens von Ton an das
Glas zu sehen (Abb. 63). Das Glas wurde demnach
vor dem Brand eingesetzt. Im Gefäßinnern sind
die Kanten der Aussparung annähernd passgenau
auf das Glasstück zugeschnitten, lediglich an einer
Stelle liegt ein „Zipfelchen" Ton über dem Glas.
Das Glasstück und der Gefäßboden weisen die glei-
che Dicke auf. Durch das „Fenster" ist das Gefäß
wasserdurchlässig.
Befund 2677 enthielt eine ca. 9,0 cm hohe
dreigliedrige Schalenurne der Form 1 mit deutlich
einschwingendem Oberteil, betontem Umbruch über
bauchigem Unterteil sowie einem flachen, nicht abge-
nutzten Standboden (Kat.-Nr. 2677.1: Abb. 64; Taf.
197). Die Oberfläche ist poliert, auf Schulter und
Umbruch liegt je eine Rille, von der Rille auf dem
Umbruch hängen Gruppen aus Rillenabschnitten
herab. Sowohl aufgrund formaler Vergleiche als auch
des Dekors ist eine völkerwanderungszeitliche Datie-
rung einschließlich des 6. Jahrhunderts der ohne
Beifunde geborgenen Urne vorzuschlagen.
In den Boden des Gefäßes ist ein unregelmäßig
geformtes, leicht gewölbtes Fragment aus hellgrünem,
transluziden, dünnwandigen und blasenfreien Glas
von ca. 0,7 mm Dicke eingefügt, das eine wenigs-
tens achtreihige Fadenauflage bzw. eine entspre-
159
Abb.63 Fenstergefäß Kat.-Nr. 1471.1 mit Glaseinsatz im
Boden (a Bodenansicht von außen, b Bodenansicht von
innen). Farbfassung vgl. Beilage. Ohne Maßstab.
ist durchaus auffällig. Hier wäre ein Abgleich mit
den biologischen Daten vonnöten, da überregional
eine Bindung der Perlenmitgabe an Verstorbene
weiblichen Geschlechts besteht. Im Hinblick auf
Lüneburg-Oedeme bleibt anzumerken, dass Gräber
mit Glasperlen der gleichmäßigen Verbreitung der
Frauengräber des dortigen Friedhofs entsprechen.
Doch lässt sich auch hier ein gewisser Schwerpunkt
ausmachen, da fast 70 % der gesicherten Gräber mit
Glasperlen südlich des bronzezeitlichen Grabhügels
lagen und lediglich 14 % westlich und nördlich davon
(Mohnike 2008, Abb. 39).
3 Zu den Gefäßen mit Glaseinsatz
(„Fenstergefäße") des 2. bis
6./ 7. Jahrhunderts
3.1 Die Uelzen-Veerßener Gefäße
Kat.-Nr. 1471.1, 2677.1, 2670.1 und 1445.1
Auf dem Gräberfeld von Uelzen-Veerßen wurden
vier Keramikgefäße geborgen, in deren Wandung
bzw. Boden zwischen einem und drei Glasstücke
eingesetzt sind. Die weitmündigen Gefäße dienten
als Urnen.
Befund 1471, ein Urnengrab, enthielt als
Leichenbrandbehälter eine ca. 8,0 cm hohe dreiglied-
rige Schalenurne der Form 1 mit abgenutztem Stan-
dring (Kat.-Nr. 1471.1: Abb. 63; Taf. 105). Die äußere,
beschädigte Gefäßoberfläche war mindestens geglät-
tet, auf Schulter und Umbruch liegen vier bis fünf
Rillen und Fingernageleindrücke. Die Formgebung
der Urne, in der keine Ausstattungsreste gefunden
wurden, verweist auf eine Datierung zwischen das 4.
und 6. Jahrhundert, wobei die Machart eine Eingren-
zung auf die Völkerwanderungszeit erlaubt.
In den Boden des Gefäßes ist ein unregelmäßig
geformtes Fragment aus grünem transluziden Glas
eingefügt, dessen sichtbare Größe außen ca. 4,0 x
3,0 cm beträgt. Da das Tongefäß fragmentiert ist,
kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere
Glasstücke in der Wandung befanden. Die erhaltenen
Bruchkanten der Wandungsscherben weisen jedoch
keine glatten Kanten auf, wie sie am Boden beob-
achtet werden können. Die Scherbe hat eine Dicke
von ca. 1,5 mm, ist unverziert und leicht gewölbt; sie
kann nicht orientiert werden. Aufgrund der kräftig
grünen Farbe und der zahlreichen, in der Glasmasse
eingeschlossenen Bläschen des Glasfragments ist das
Bruchstück eines spätantiken bis völkerwanderungs-
zeitlichen Hohlglases zu vermuten.
Die Oberfläche des Glasstücks ist auf beiden
Seiten nicht ganz glatt. Für das Fragment ist der
Gefäßboden vermutlich im lederharten Zustand so
ausgeschnitten worden, dass die Scherbe genau in
die geraden Schnittkanten eingepasst werden konnte.
Dies erfolgte von außen - hier sind an zwei Stellen
deutliche Spuren des Andrückens von Ton an das
Glas zu sehen (Abb. 63). Das Glas wurde demnach
vor dem Brand eingesetzt. Im Gefäßinnern sind
die Kanten der Aussparung annähernd passgenau
auf das Glasstück zugeschnitten, lediglich an einer
Stelle liegt ein „Zipfelchen" Ton über dem Glas.
Das Glasstück und der Gefäßboden weisen die glei-
che Dicke auf. Durch das „Fenster" ist das Gefäß
wasserdurchlässig.
Befund 2677 enthielt eine ca. 9,0 cm hohe
dreigliedrige Schalenurne der Form 1 mit deutlich
einschwingendem Oberteil, betontem Umbruch über
bauchigem Unterteil sowie einem flachen, nicht abge-
nutzten Standboden (Kat.-Nr. 2677.1: Abb. 64; Taf.
197). Die Oberfläche ist poliert, auf Schulter und
Umbruch liegt je eine Rille, von der Rille auf dem
Umbruch hängen Gruppen aus Rillenabschnitten
herab. Sowohl aufgrund formaler Vergleiche als auch
des Dekors ist eine völkerwanderungszeitliche Datie-
rung einschließlich des 6. Jahrhunderts der ohne
Beifunde geborgenen Urne vorzuschlagen.
In den Boden des Gefäßes ist ein unregelmäßig
geformtes, leicht gewölbtes Fragment aus hellgrünem,
transluziden, dünnwandigen und blasenfreien Glas
von ca. 0,7 mm Dicke eingefügt, das eine wenigs-
tens achtreihige Fadenauflage bzw. eine entspre-