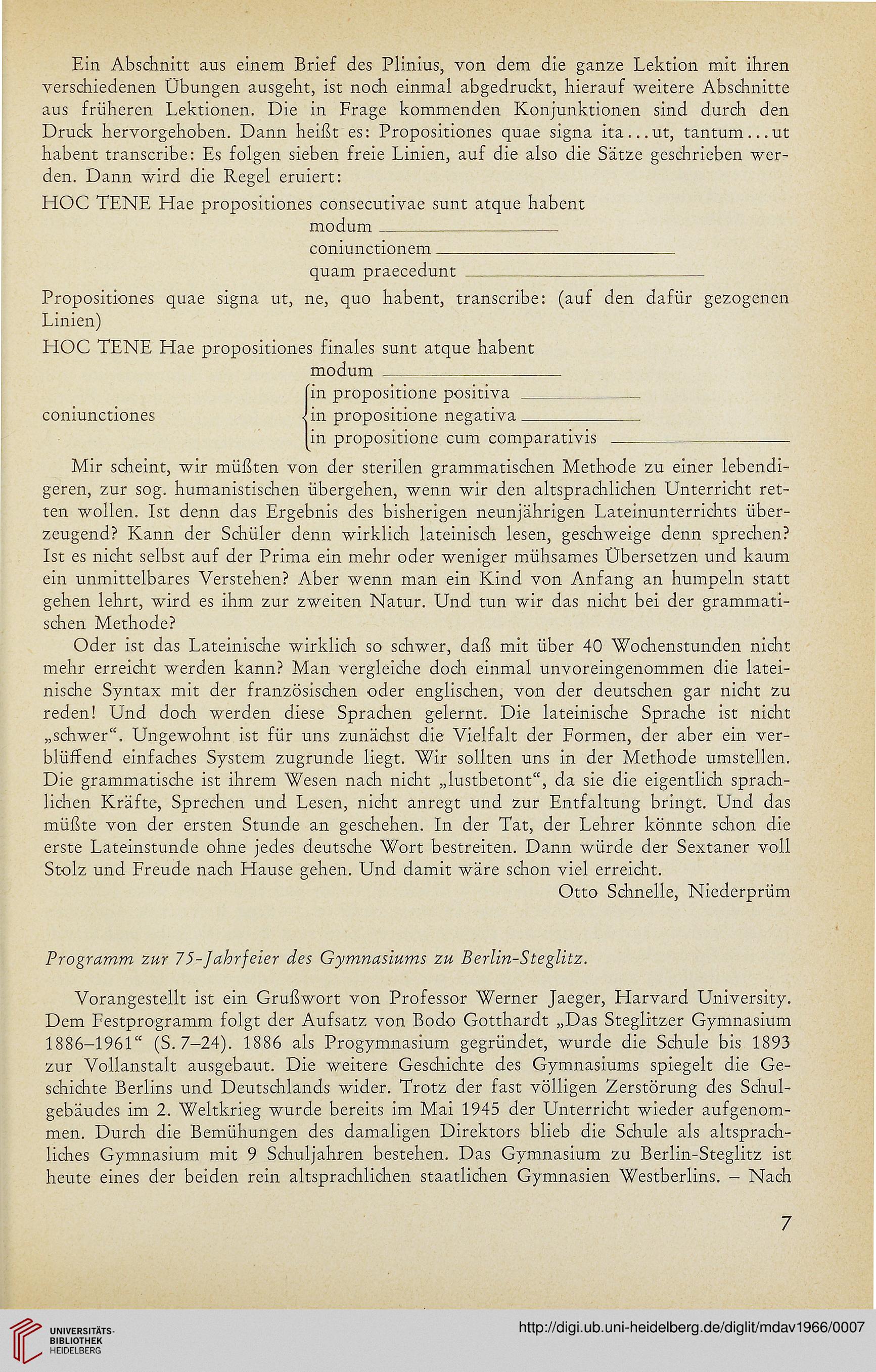Ein Abschnitt aus einem Brief des Plinius, von dem die ganze Lektion mit ihren
verschiedenen Übungen ausgeht, ist noch einmal abgedruckt, hierauf weitere Abschnitte
aus früheren Lektionen. Die in Frage kommenden Konjunktionen sind durch den
Druck hervorgehoben. Dann heißt es: Propositiones quae signa ita...ut, tantum...ut
habent transcribe: Es folgen sieben freie Linien, auf die also die Sätze geschrieben wer-
den. Dann wird die Regel eruiert:
HOC TENE Hae propositiones consecutivae sunt atque habent
modum_
coniunctionem_
quam praecedunt _
Propositiones quae signa ut, ne, quo habent, transcribe: (auf den dafür gezogenen
Linien)
HOC TENE Hae propositiones finales sunt atque habent
modum _
{in propositione positiva _
in propositione negativa__
in propositione cum comparativis -
Mir scheint, wir müßten von der sterilen grammatischen Methode zu einer lebendi-
geren, zur sog. humanistischen iibergehen, wenn wir den altsprachlichen Unterricht ret-
ten wollen. Ist denn das Ergebnis des bisherigen neunjährigen Lateinunterrichts iiber-
zeugend? Kann der Schiiler denn wirklich lateinisch lesen, geschweige denn sprechen?
Ist es nicht selbst auf der Prima ein mehr oder weniger miihsames Ubersetzen und kaum
ein unmittelbares Verstehen? Aber wenn man ein Kind von Anfang an humpeln statt
gehen lehrt, wird es ihm zur zweiten Natur. Und tun wir das nicht bei der grammati-
schen Methode?
Oder ist das Lateinische wirklich so schwer, daß mit iiber 40 Wochenstunden nicht
mehr erreicht werden kann? Man vergleiche doch einmal unvoreingenommen die latei-
nische Syntax mit der französischen oder englischen, von der deutschen gar nicht zu
reden! Und doch werden diese Sprachen gelernt. Die lateinische Sprache ist nicht
„schwer“. Ungewohnt ist für uns zunächst die Vielfalt der Formen, der aber ein ver-
blüffend einfaches System zugrunde liegt. Wir sollten uns in der Methode umstellen.
Die grammatische ist ihrem Wesen nach nicht „lustbetont“, da sie die eigentlich sprach-
lichen Kräfte, Sprechen und Lesen, nicht anregt und zur Entfaltung bringt. Und das
müßte von der ersten Stunde an geschehen. In der Tat, der Lehrer könnte schon die
erste Lateinstunde ohne jedes deutsche Wort bestreiten. Dann würde der Sextaner voll
Stolz und Freude nach Hause gehen. Und damit wäre schon viel erreicht.
Otto Schnelie, Niederprüm
Programm zur 75-Jahrfeier des Gymnasiums zu Berlin-Steglitz.
Vorangestellt ist ein Grußwort von Professor Werner Jaeger, Harvard University.
Dem Festprogramm folgt der Aufsatz von Bodo Gotthardt „Das Steglitzer Gymnasium
1886-1961“ (S. 7-24). 1886 als Progymnasium gegründet, wurde die Schule bis 1893
zur Vollanstalt ausgebaut. Die weitere Geschichte des Gymnasiums spiegelt die Ge-
schichte Berlins und Deutschlands wider. Trotz der fast völligen Zerstörung des Schul-
gebäudes im 2. Weltkrieg wurde bereits im Mai 1945 der Unterricht wieder aufgenom-
men. Durch die Bemühungen des damaligen Direktors blieb die Schule als altsprach-
liches Gymnasium mit 9 Schuljahren bestehen. Das Gymnasium zu Berlin-Steglitz ist
heute eines der beiden rein altsprachlichen staatlichen Gymnasien Westberlins. - Nach
7
verschiedenen Übungen ausgeht, ist noch einmal abgedruckt, hierauf weitere Abschnitte
aus früheren Lektionen. Die in Frage kommenden Konjunktionen sind durch den
Druck hervorgehoben. Dann heißt es: Propositiones quae signa ita...ut, tantum...ut
habent transcribe: Es folgen sieben freie Linien, auf die also die Sätze geschrieben wer-
den. Dann wird die Regel eruiert:
HOC TENE Hae propositiones consecutivae sunt atque habent
modum_
coniunctionem_
quam praecedunt _
Propositiones quae signa ut, ne, quo habent, transcribe: (auf den dafür gezogenen
Linien)
HOC TENE Hae propositiones finales sunt atque habent
modum _
{in propositione positiva _
in propositione negativa__
in propositione cum comparativis -
Mir scheint, wir müßten von der sterilen grammatischen Methode zu einer lebendi-
geren, zur sog. humanistischen iibergehen, wenn wir den altsprachlichen Unterricht ret-
ten wollen. Ist denn das Ergebnis des bisherigen neunjährigen Lateinunterrichts iiber-
zeugend? Kann der Schiiler denn wirklich lateinisch lesen, geschweige denn sprechen?
Ist es nicht selbst auf der Prima ein mehr oder weniger miihsames Ubersetzen und kaum
ein unmittelbares Verstehen? Aber wenn man ein Kind von Anfang an humpeln statt
gehen lehrt, wird es ihm zur zweiten Natur. Und tun wir das nicht bei der grammati-
schen Methode?
Oder ist das Lateinische wirklich so schwer, daß mit iiber 40 Wochenstunden nicht
mehr erreicht werden kann? Man vergleiche doch einmal unvoreingenommen die latei-
nische Syntax mit der französischen oder englischen, von der deutschen gar nicht zu
reden! Und doch werden diese Sprachen gelernt. Die lateinische Sprache ist nicht
„schwer“. Ungewohnt ist für uns zunächst die Vielfalt der Formen, der aber ein ver-
blüffend einfaches System zugrunde liegt. Wir sollten uns in der Methode umstellen.
Die grammatische ist ihrem Wesen nach nicht „lustbetont“, da sie die eigentlich sprach-
lichen Kräfte, Sprechen und Lesen, nicht anregt und zur Entfaltung bringt. Und das
müßte von der ersten Stunde an geschehen. In der Tat, der Lehrer könnte schon die
erste Lateinstunde ohne jedes deutsche Wort bestreiten. Dann würde der Sextaner voll
Stolz und Freude nach Hause gehen. Und damit wäre schon viel erreicht.
Otto Schnelie, Niederprüm
Programm zur 75-Jahrfeier des Gymnasiums zu Berlin-Steglitz.
Vorangestellt ist ein Grußwort von Professor Werner Jaeger, Harvard University.
Dem Festprogramm folgt der Aufsatz von Bodo Gotthardt „Das Steglitzer Gymnasium
1886-1961“ (S. 7-24). 1886 als Progymnasium gegründet, wurde die Schule bis 1893
zur Vollanstalt ausgebaut. Die weitere Geschichte des Gymnasiums spiegelt die Ge-
schichte Berlins und Deutschlands wider. Trotz der fast völligen Zerstörung des Schul-
gebäudes im 2. Weltkrieg wurde bereits im Mai 1945 der Unterricht wieder aufgenom-
men. Durch die Bemühungen des damaligen Direktors blieb die Schule als altsprach-
liches Gymnasium mit 9 Schuljahren bestehen. Das Gymnasium zu Berlin-Steglitz ist
heute eines der beiden rein altsprachlichen staatlichen Gymnasien Westberlins. - Nach
7