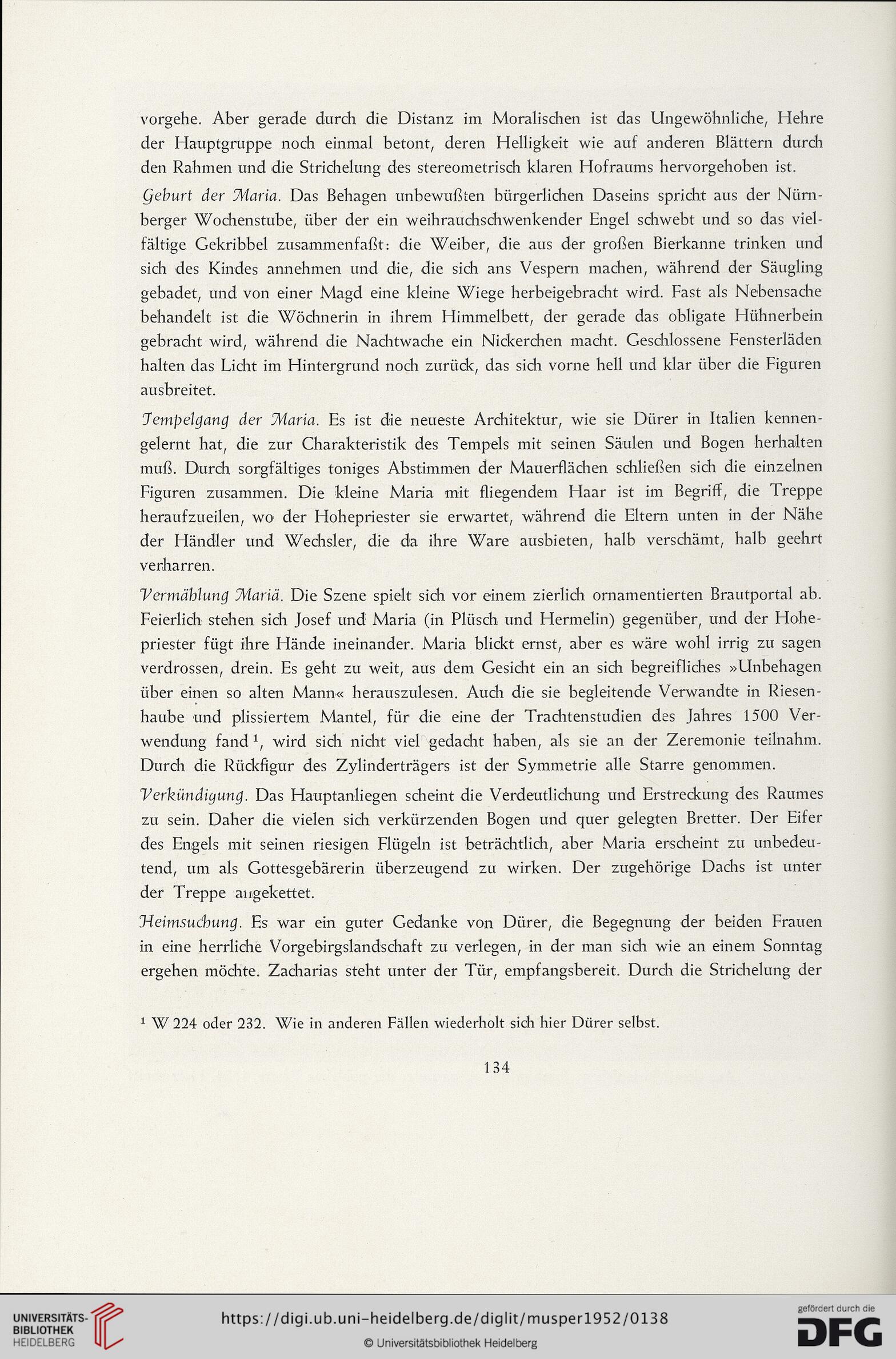vorgehe. Aber gerade durch die Distanz im Moralischen ist das Ungewöhnliche, Hehre
der Hauptgruppe noch einmal betont, deren Helligkeit wie auf anderen Blättern durch
den Rahmen und die Strichelung des stereometrisch klaren Hofraums hervorgehoben ist.
Qeburt der Maria. Das Behagen unbewußten bürgerlichen Daseins spricht aus der Nürn-
berger Wochenstube, über der ein weihrauchschwenkender Engel schwebt und so das viel-
fältige Gekribbel zusammenfaßt: die Weiber, die aus der großen Bierkanne trinken und
sich des Kindes annehmen und die, die sich ans Vespern machen, während der Säugling
gebadet, und von einer Magd eine kleine Wiege herbeigebracht wird. Fast als Nebensache
behandelt ist die Wöchnerin in ihrem Himmelbett, der gerade das obligate Hühnerbein
gebracht wird, während die Nachtwache ein Nickerchen macht. Geschlossene Fensterläden
halten das Licht im Hintergrund noch zurück, das sich vorne hell und klar über die Figuren
ausbreitet.
‘J'empelgang der Maria. Es ist die neueste Architektur, wie sie Dürer in Italien kennen-
gelernt hat, die zur Charakteristik des Tempels mit seinen Säulen und Bogen herhalten
muß. Durch sorgfältiges toniges Abstimmen der Mauerflächen schließen sich die einzelnen
Figuren zusammen. Die kleine Maria mit fliegendem Haar ist im Begriff, die Treppe
heraufzueilen, wo der Hohepriester sie erwartet, während die Eltern unten in der Nähe
der Händler und Wechsler, die da ihre Ware ausbieten, halb verschämt, halb geehrt
verharren.
Vermählung Mariä. Die Szene spielt sich vor einem zierlich ornamentierten Brautportal ab.
Feierlich stehen sich Josef und Maria (in Plüsch und Hermelin) gegenüber, und der Hohe-
priester fügt ihre Hände ineinander. Maria blickt ernst, aber es wäre wohl irrig zu sagen
verdrossen, drein. Es geht zu weit, aus dem Gesicht ein an sich begreifliches »Unbehagen
über einen so alten Mann« herauszulesen. Auch die sie begleitende Verwandte in Riesen-
haube und plissiertem Mantel, für die eine der Trachten Studien des Jahres 1500 Ver-
wendung fand \ wird sich nicht viel gedacht haben, als sie an der Zeremonie teilnahm.
Durch die Rückfigur des Zylinderträgers ist der Symmetrie alle Starre genommen.
Verkündigung. Das Hauptanliegen scheint die Verdeutlichung und Erstreckung des Raumes
zu sein. Daher die vielen sich verkürzenden Bogen und quer gelegten Bretter. Der Eifer
des Engels mit seinen riesigen Flügeln ist beträchtlich, aber Maria erscheint zu unbedeu-
tend, um als Gottesgebärerin überzeugend zu wirken. Der zugehörige Dachs ist unter
der Treppe angekettet.
Meimsudhung. Es war ein guter Gedanke von Dürer, die Begegnung der beiden Frauen
in eine herrliche Vorgebirgslandschaft zu verlegen, in der man sich wie an einem Sonntag
ergehen möchte. Zacharias steht unter der Tür, empfangsbereit. Durch die Strichelung der
1 W 224 oder 232. Wie in anderen Fällen wiederholt sich hier Dürer selbst.
134
der Hauptgruppe noch einmal betont, deren Helligkeit wie auf anderen Blättern durch
den Rahmen und die Strichelung des stereometrisch klaren Hofraums hervorgehoben ist.
Qeburt der Maria. Das Behagen unbewußten bürgerlichen Daseins spricht aus der Nürn-
berger Wochenstube, über der ein weihrauchschwenkender Engel schwebt und so das viel-
fältige Gekribbel zusammenfaßt: die Weiber, die aus der großen Bierkanne trinken und
sich des Kindes annehmen und die, die sich ans Vespern machen, während der Säugling
gebadet, und von einer Magd eine kleine Wiege herbeigebracht wird. Fast als Nebensache
behandelt ist die Wöchnerin in ihrem Himmelbett, der gerade das obligate Hühnerbein
gebracht wird, während die Nachtwache ein Nickerchen macht. Geschlossene Fensterläden
halten das Licht im Hintergrund noch zurück, das sich vorne hell und klar über die Figuren
ausbreitet.
‘J'empelgang der Maria. Es ist die neueste Architektur, wie sie Dürer in Italien kennen-
gelernt hat, die zur Charakteristik des Tempels mit seinen Säulen und Bogen herhalten
muß. Durch sorgfältiges toniges Abstimmen der Mauerflächen schließen sich die einzelnen
Figuren zusammen. Die kleine Maria mit fliegendem Haar ist im Begriff, die Treppe
heraufzueilen, wo der Hohepriester sie erwartet, während die Eltern unten in der Nähe
der Händler und Wechsler, die da ihre Ware ausbieten, halb verschämt, halb geehrt
verharren.
Vermählung Mariä. Die Szene spielt sich vor einem zierlich ornamentierten Brautportal ab.
Feierlich stehen sich Josef und Maria (in Plüsch und Hermelin) gegenüber, und der Hohe-
priester fügt ihre Hände ineinander. Maria blickt ernst, aber es wäre wohl irrig zu sagen
verdrossen, drein. Es geht zu weit, aus dem Gesicht ein an sich begreifliches »Unbehagen
über einen so alten Mann« herauszulesen. Auch die sie begleitende Verwandte in Riesen-
haube und plissiertem Mantel, für die eine der Trachten Studien des Jahres 1500 Ver-
wendung fand \ wird sich nicht viel gedacht haben, als sie an der Zeremonie teilnahm.
Durch die Rückfigur des Zylinderträgers ist der Symmetrie alle Starre genommen.
Verkündigung. Das Hauptanliegen scheint die Verdeutlichung und Erstreckung des Raumes
zu sein. Daher die vielen sich verkürzenden Bogen und quer gelegten Bretter. Der Eifer
des Engels mit seinen riesigen Flügeln ist beträchtlich, aber Maria erscheint zu unbedeu-
tend, um als Gottesgebärerin überzeugend zu wirken. Der zugehörige Dachs ist unter
der Treppe angekettet.
Meimsudhung. Es war ein guter Gedanke von Dürer, die Begegnung der beiden Frauen
in eine herrliche Vorgebirgslandschaft zu verlegen, in der man sich wie an einem Sonntag
ergehen möchte. Zacharias steht unter der Tür, empfangsbereit. Durch die Strichelung der
1 W 224 oder 232. Wie in anderen Fällen wiederholt sich hier Dürer selbst.
134