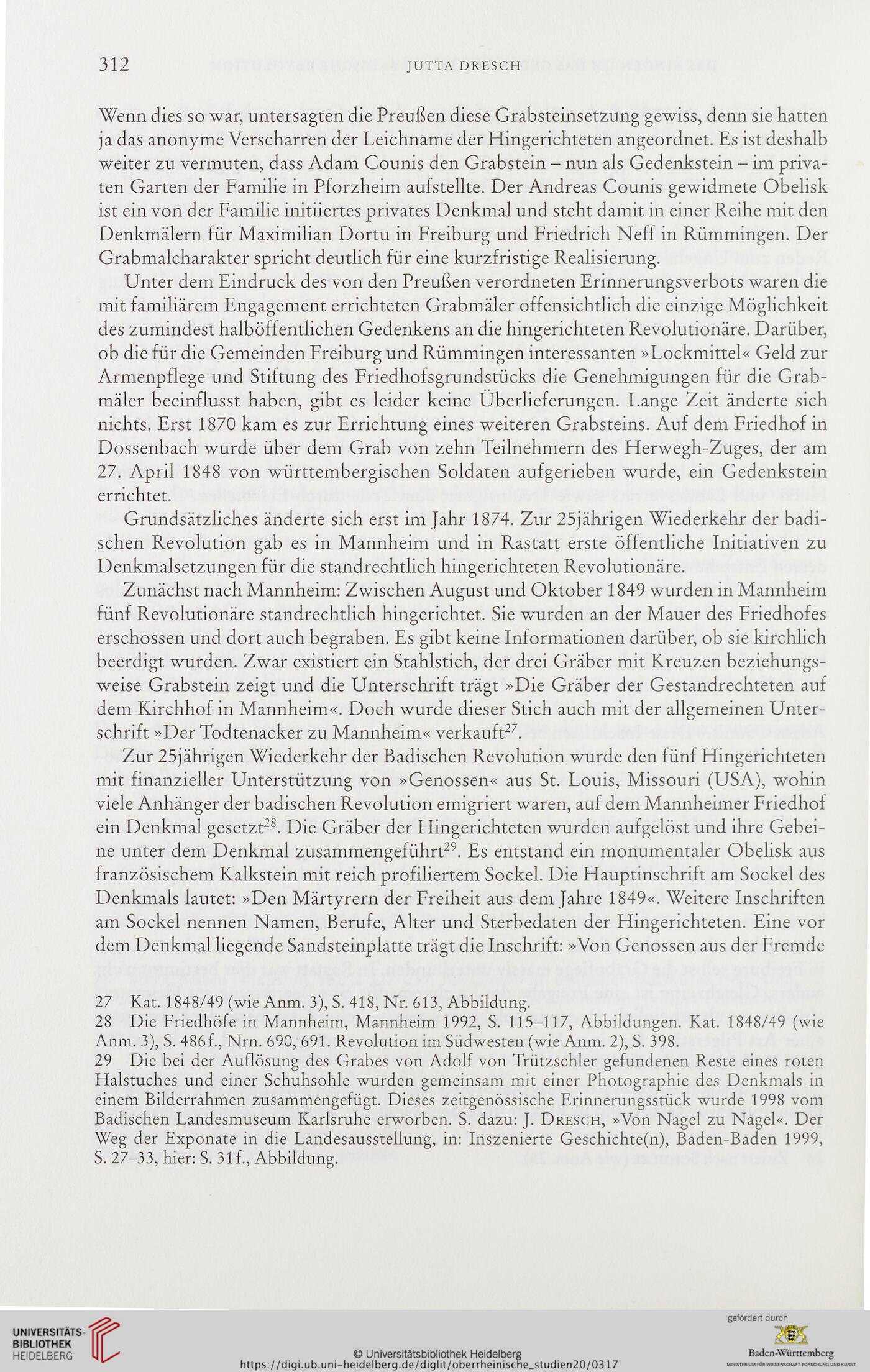312
JUTTA DRESCH
Wenn dies so war, untersagten die Preußen diese Grabsteinsetzung gewiss, denn sie hatten
ja das anonyme Verscharren der Leichname der Hingerichteten angeordnet. Es ist deshalb
weiter zu vermuten, dass Adam Counis den Grabstein - nun als Gedenkstein - im priva-
ten Garten der Familie in Pforzheim aufstellte. Der Andreas Counis gewidmete Obelisk
ist ein von der Familie initiiertes privates Denkmal und steht damit in einer Reihe mit den
Denkmälern für Maximilian Dortu in Freiburg und Friedrich Neff in Rümmingen. Der
Grabmalcharakter spricht deutlich für eine kurzfristige Realisierung.
Unter dem Eindruck des von den Preußen verordneten Erinnerungsverbots waren die
mit familiärem Engagement errichteten Grabmäler offensichtlich die einzige Möglichkeit
des zumindest halböffentlichen Gedenkens an die hingerichteten Revolutionäre. Darüber,
ob die für die Gemeinden Freiburg und Rümmingen interessanten »Lockmittel« Geld zur
Armenpflege und Stiftung des Friedhofsgrundstücks die Genehmigungen für die Grab-
mäler beeinflusst haben, gibt es leider keine Überlieferungen. Lange Zeit änderte sich
nichts. Erst 1870 kam es zur Errichtung eines weiteren Grabsteins. Auf dem Friedhof in
Dossenbach wurde über dem Grab von zehn Teilnehmern des Herwegh-Zuges, der am
27. April 1848 von württembergischen Soldaten aufgerieben wurde, ein Gedenkstein
errichtet.
Grundsätzliches änderte sich erst im Jahr 1874. Zur 25jährigen Wiederkehr der badi-
schen Revolution gab es in Mannheim und in Rastatt erste öffentliche Initiativen zu
Denkmalsetzungen für die standrechtlich hingerichteten Revolutionäre.
Zunächst nach Mannheim: Zwischen August und Oktober 1849 wurden in Mannheim
fünf Revolutionäre standrechtlich hingerichtet. Sie wurden an der Mauer des Friedhofes
erschossen und dort auch begraben. Es gibt keine Informationen darüber, ob sie kirchlich
beerdigt wurden. Zwar existiert ein Stahlstich, der drei Gräber mit Kreuzen beziehungs-
weise Grabstein zeigt und die Unterschrift trägt »Die Gräber der Gestandrechteten auf
dem Kirchhof in Mannheim«. Doch wurde dieser Stich auch mit der allgemeinen Unter-
schrift »Der Todtenacker zu Mannheim« verkauft27.
Zur 25jährigen Wiederkehr der Badischen Revolution wurde den fünf Hingerichteten
mit finanzieller Unterstützung von »Genossen« aus St. Louis, Missouri (USA), wohin
viele Anhänger der badischen Revolution emigriert waren, auf dem Mannheimer Friedhof
ein Denkmal gesetzt28. Die Gräber der Hingerichteten wurden aufgelöst und ihre Gebei-
ne unter dem Denkmal zusammengeführt29. Es entstand ein monumentaler Obelisk aus
französischem Kalkstein mit reich profiliertem Sockel. Die Hauptinschrift am Sockel des
Denkmals lautet: »Den Märtyrern der Freiheit aus dem Jahre 1849«. Weitere Inschriften
am Sockel nennen Namen, Berufe, Alter und Sterbedaten der Hingerichteten. Eine vor
dem Denkmal liegende Sandsteinplatte trägt die Inschrift: »Von Genossen aus der Fremde
27 Kat. 1848/49 (wie Anm. 3), S. 418, Nr. 613, Abbildung.
28 Die Friedhöfe in Mannheim, Mannheim 1992, S. 115-117, Abbildungen. Kat. 1848/49 (wie
Anm. 3), S. 486f., Nrn. 690, 691. Revolution im Südwesten (wie Anm. 2), S. 398.
29 Die bei der Auflösung des Grabes von Adolf von Trützschler gefundenen Reste eines roten
Halstuches und einer Schuhsohle wurden gemeinsam mit einer Photographie des Denkmals in
einem Bilderrahmen zusammengefügt. Dieses zeitgenössische Erinnerungsstück wurde 1998 vom
Badischen Landesmuseum Karlsruhe erworben. S. dazu: J. Dresch, »Von Nagel zu Nagel«. Der
Weg der Exponate in die Landesausstellung, in: Inszenierte Geschichte(n), Baden-Baden 1999,
S. 27-33, hier: S. 31 f., Abbildung.
JUTTA DRESCH
Wenn dies so war, untersagten die Preußen diese Grabsteinsetzung gewiss, denn sie hatten
ja das anonyme Verscharren der Leichname der Hingerichteten angeordnet. Es ist deshalb
weiter zu vermuten, dass Adam Counis den Grabstein - nun als Gedenkstein - im priva-
ten Garten der Familie in Pforzheim aufstellte. Der Andreas Counis gewidmete Obelisk
ist ein von der Familie initiiertes privates Denkmal und steht damit in einer Reihe mit den
Denkmälern für Maximilian Dortu in Freiburg und Friedrich Neff in Rümmingen. Der
Grabmalcharakter spricht deutlich für eine kurzfristige Realisierung.
Unter dem Eindruck des von den Preußen verordneten Erinnerungsverbots waren die
mit familiärem Engagement errichteten Grabmäler offensichtlich die einzige Möglichkeit
des zumindest halböffentlichen Gedenkens an die hingerichteten Revolutionäre. Darüber,
ob die für die Gemeinden Freiburg und Rümmingen interessanten »Lockmittel« Geld zur
Armenpflege und Stiftung des Friedhofsgrundstücks die Genehmigungen für die Grab-
mäler beeinflusst haben, gibt es leider keine Überlieferungen. Lange Zeit änderte sich
nichts. Erst 1870 kam es zur Errichtung eines weiteren Grabsteins. Auf dem Friedhof in
Dossenbach wurde über dem Grab von zehn Teilnehmern des Herwegh-Zuges, der am
27. April 1848 von württembergischen Soldaten aufgerieben wurde, ein Gedenkstein
errichtet.
Grundsätzliches änderte sich erst im Jahr 1874. Zur 25jährigen Wiederkehr der badi-
schen Revolution gab es in Mannheim und in Rastatt erste öffentliche Initiativen zu
Denkmalsetzungen für die standrechtlich hingerichteten Revolutionäre.
Zunächst nach Mannheim: Zwischen August und Oktober 1849 wurden in Mannheim
fünf Revolutionäre standrechtlich hingerichtet. Sie wurden an der Mauer des Friedhofes
erschossen und dort auch begraben. Es gibt keine Informationen darüber, ob sie kirchlich
beerdigt wurden. Zwar existiert ein Stahlstich, der drei Gräber mit Kreuzen beziehungs-
weise Grabstein zeigt und die Unterschrift trägt »Die Gräber der Gestandrechteten auf
dem Kirchhof in Mannheim«. Doch wurde dieser Stich auch mit der allgemeinen Unter-
schrift »Der Todtenacker zu Mannheim« verkauft27.
Zur 25jährigen Wiederkehr der Badischen Revolution wurde den fünf Hingerichteten
mit finanzieller Unterstützung von »Genossen« aus St. Louis, Missouri (USA), wohin
viele Anhänger der badischen Revolution emigriert waren, auf dem Mannheimer Friedhof
ein Denkmal gesetzt28. Die Gräber der Hingerichteten wurden aufgelöst und ihre Gebei-
ne unter dem Denkmal zusammengeführt29. Es entstand ein monumentaler Obelisk aus
französischem Kalkstein mit reich profiliertem Sockel. Die Hauptinschrift am Sockel des
Denkmals lautet: »Den Märtyrern der Freiheit aus dem Jahre 1849«. Weitere Inschriften
am Sockel nennen Namen, Berufe, Alter und Sterbedaten der Hingerichteten. Eine vor
dem Denkmal liegende Sandsteinplatte trägt die Inschrift: »Von Genossen aus der Fremde
27 Kat. 1848/49 (wie Anm. 3), S. 418, Nr. 613, Abbildung.
28 Die Friedhöfe in Mannheim, Mannheim 1992, S. 115-117, Abbildungen. Kat. 1848/49 (wie
Anm. 3), S. 486f., Nrn. 690, 691. Revolution im Südwesten (wie Anm. 2), S. 398.
29 Die bei der Auflösung des Grabes von Adolf von Trützschler gefundenen Reste eines roten
Halstuches und einer Schuhsohle wurden gemeinsam mit einer Photographie des Denkmals in
einem Bilderrahmen zusammengefügt. Dieses zeitgenössische Erinnerungsstück wurde 1998 vom
Badischen Landesmuseum Karlsruhe erworben. S. dazu: J. Dresch, »Von Nagel zu Nagel«. Der
Weg der Exponate in die Landesausstellung, in: Inszenierte Geschichte(n), Baden-Baden 1999,
S. 27-33, hier: S. 31 f., Abbildung.