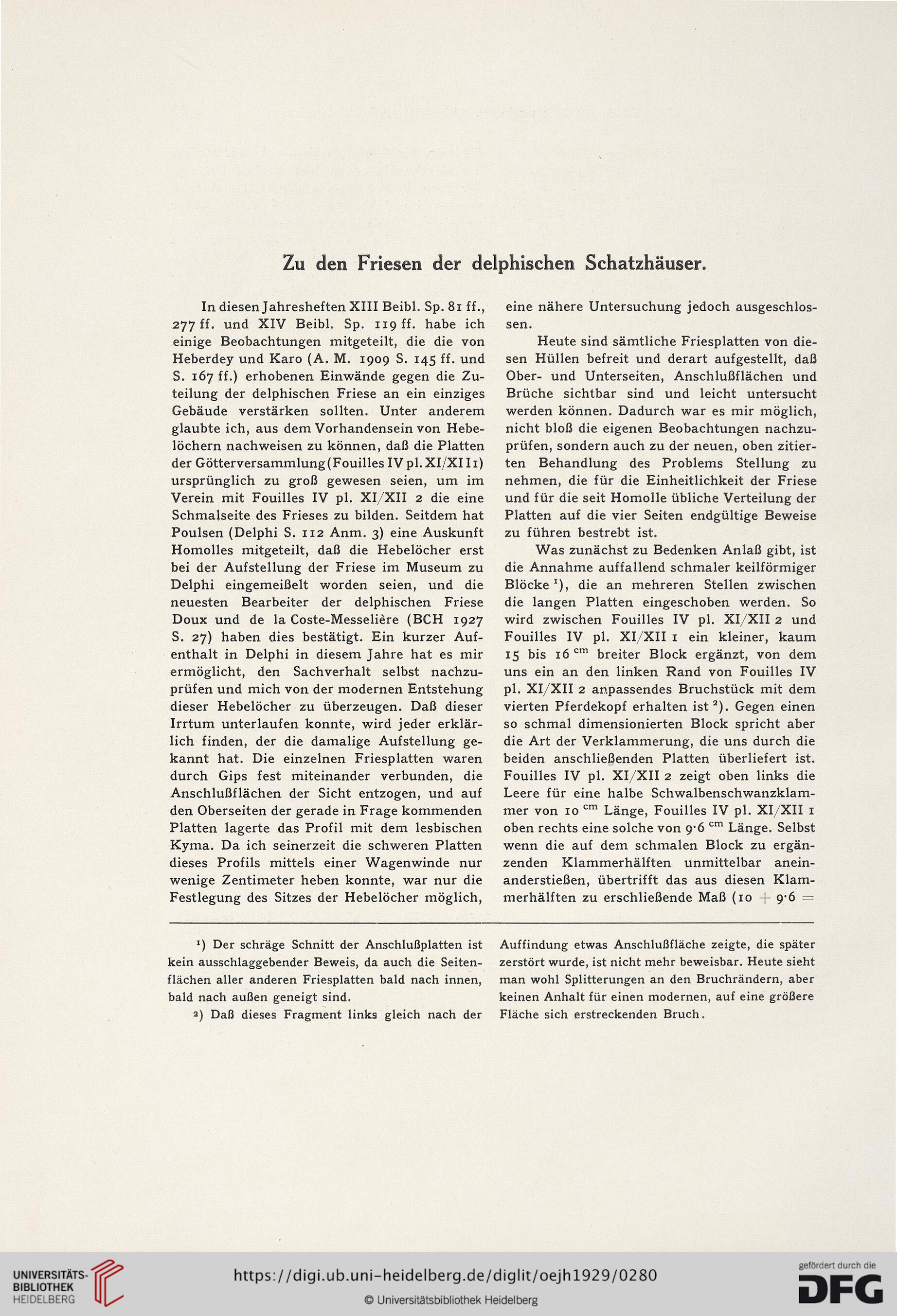Zu den Friesen der delphischen Schatzhäuser.
In diesen Jahresheften XIII Beibl. Sp. 81 ff.,
277 ff. und XIV Beibl. Sp. 119 ff. habe ich
einige Beobachtungen mitgeteilt, die die von
Heberdey und Karo (A. Μ. 1909 S. 145 ff. und
S. 167 ff.) erhobenen Einwände gegen die Zu-
teilung der delphischen Friese an ein einziges
Gebäude verstärken sollten. Unter anderem
glaubte ich, aus dem Vorhandensein von Hebe-
löchern nachweisen zu können, daß die Platten
der Götterversammlung(Fouilles IV pl. XI/XI11)
ursprünglich zu groß gewesen seien, um im
Verein mit Fouilles IV pl. XI/XII 2 die eine
Schmalseite des Frieses zu bilden. Seitdem hat
Poulsen (Delphi S. 112 Anm. 3) eine Auskunft
Homolles mitgeteilt, daß die Hebelöcher erst
bei der Aufstellung der Friese im Museum zu
Delphi eingemeißelt worden seien, und die
neuesten Bearbeiter der delphischen Friese
Doux und de la Coste-Messeliere (BCH 1927
S. 27) haben dies bestätigt. Ein kurzer Auf-
enthalt in Delphi in diesem Jahre hat es mir
ermöglicht, den Sachverhalt selbst nachzu-
prüfen und mich von der modernen Entstehung
dieser Hebelöcher zu überzeugen. Daß dieser
Irrtum unterlaufen konnte, wird jeder erklär-
lich finden, der die damalige Aufstellung ge-
kannt hat. Die einzelnen Friesplatten waren
durch Gips fest miteinander verbunden, die
Anschlußflächen der Sicht entzogen, und auf
den Oberseiten der gerade in Frage kommenden
Platten lagerte das Profil mit dem lesbischen
Kyma. Da ich seinerzeit die schweren Platten
dieses Profils mittels einer Wagenwinde nur
wenige Zentimeter heben konnte, war nur die
Festlegung des Sitzes der Hebelöcher möglich,
x) Der schräge Schnitt der Anschlußplatten ist
kein ausschlaggebender Beweis, da auch die Seiten-
flächen aller anderen Friesplatten bald nach innen,
bald nach außen geneigt sind.
2) Daß dieses Fragment links gleich nach der
eine nähere Untersuchung jedoch ausgeschlos-
sen.
Heute sind sämtliche Friesplatten von die-
sen Hüllen befreit und derart aufgestellt, daß
Ober- und Unterseiten, Anschlußflächen und
Brüche sichtbar sind und leicht untersucht
werden können. Dadurch war es mir möglich,
nicht bloß die eigenen Beobachtungen nachzu-
prüfen, sondern auch zu der neuen, oben zitier-
ten Behandlung des Problems Stellung zu
nehmen, die für die Einheitlichkeit der Friese
und für die seit Homolle übliche Verteilung der
Platten auf die vier Seiten endgültige Beweise
zu führen bestrebt ist.
Was zunächst zu Bedenken Anlaß gibt, ist
die Annahme auffallend schmaler keilförmiger
Blöcke1), die an mehreren Stellen zwischen
die langen Platten eingeschoben werden. So
wird zwischen Fouilles IV pl. XI/XII 2 und
Fouilles IV pl. XI/XII 1 ein kleiner, kaum
15 bis 16 cm breiter Block ergänzt, von dem
uns ein an den linken Rand von Fouilles IV
pl. XI/XII 2 anpassendes Bruchstück mit dem
vierten Pferdekopf erhalten ist2). Gegen einen
so schmal dimensionierten Block spricht aber
die Art der Verklammerung, die uns durch die
beiden anschließenden Platten überliefert ist.
Fouilles IV pl. XI/XII 2 zeigt oben links die
Leere für eine halbe Schwalbenschwanzklam-
mer von 10 ctn Länge, Fouilles IV pl. XI/XII 1
oben rechts eine solche von 9*6 cm Länge. Selbst
wenn die auf dem schmalen Block zu ergän-
zenden Klammerhälften unmittelbar anein-
anderstießen, übertrifft das aus diesen Klam-
merhälften zu erschließende Maß (10 + 9-6 =
Auffindung etwas Anschlußfläche zeigte, die später
zerstört wurde, ist nicht mehr beweisbar. Heute sieht
man wohl Splitterungen an den Bruchrändern, aber
keinen Anhalt für einen modernen, auf eine größere
Fläche sich erstreckenden Bruch.
In diesen Jahresheften XIII Beibl. Sp. 81 ff.,
277 ff. und XIV Beibl. Sp. 119 ff. habe ich
einige Beobachtungen mitgeteilt, die die von
Heberdey und Karo (A. Μ. 1909 S. 145 ff. und
S. 167 ff.) erhobenen Einwände gegen die Zu-
teilung der delphischen Friese an ein einziges
Gebäude verstärken sollten. Unter anderem
glaubte ich, aus dem Vorhandensein von Hebe-
löchern nachweisen zu können, daß die Platten
der Götterversammlung(Fouilles IV pl. XI/XI11)
ursprünglich zu groß gewesen seien, um im
Verein mit Fouilles IV pl. XI/XII 2 die eine
Schmalseite des Frieses zu bilden. Seitdem hat
Poulsen (Delphi S. 112 Anm. 3) eine Auskunft
Homolles mitgeteilt, daß die Hebelöcher erst
bei der Aufstellung der Friese im Museum zu
Delphi eingemeißelt worden seien, und die
neuesten Bearbeiter der delphischen Friese
Doux und de la Coste-Messeliere (BCH 1927
S. 27) haben dies bestätigt. Ein kurzer Auf-
enthalt in Delphi in diesem Jahre hat es mir
ermöglicht, den Sachverhalt selbst nachzu-
prüfen und mich von der modernen Entstehung
dieser Hebelöcher zu überzeugen. Daß dieser
Irrtum unterlaufen konnte, wird jeder erklär-
lich finden, der die damalige Aufstellung ge-
kannt hat. Die einzelnen Friesplatten waren
durch Gips fest miteinander verbunden, die
Anschlußflächen der Sicht entzogen, und auf
den Oberseiten der gerade in Frage kommenden
Platten lagerte das Profil mit dem lesbischen
Kyma. Da ich seinerzeit die schweren Platten
dieses Profils mittels einer Wagenwinde nur
wenige Zentimeter heben konnte, war nur die
Festlegung des Sitzes der Hebelöcher möglich,
x) Der schräge Schnitt der Anschlußplatten ist
kein ausschlaggebender Beweis, da auch die Seiten-
flächen aller anderen Friesplatten bald nach innen,
bald nach außen geneigt sind.
2) Daß dieses Fragment links gleich nach der
eine nähere Untersuchung jedoch ausgeschlos-
sen.
Heute sind sämtliche Friesplatten von die-
sen Hüllen befreit und derart aufgestellt, daß
Ober- und Unterseiten, Anschlußflächen und
Brüche sichtbar sind und leicht untersucht
werden können. Dadurch war es mir möglich,
nicht bloß die eigenen Beobachtungen nachzu-
prüfen, sondern auch zu der neuen, oben zitier-
ten Behandlung des Problems Stellung zu
nehmen, die für die Einheitlichkeit der Friese
und für die seit Homolle übliche Verteilung der
Platten auf die vier Seiten endgültige Beweise
zu führen bestrebt ist.
Was zunächst zu Bedenken Anlaß gibt, ist
die Annahme auffallend schmaler keilförmiger
Blöcke1), die an mehreren Stellen zwischen
die langen Platten eingeschoben werden. So
wird zwischen Fouilles IV pl. XI/XII 2 und
Fouilles IV pl. XI/XII 1 ein kleiner, kaum
15 bis 16 cm breiter Block ergänzt, von dem
uns ein an den linken Rand von Fouilles IV
pl. XI/XII 2 anpassendes Bruchstück mit dem
vierten Pferdekopf erhalten ist2). Gegen einen
so schmal dimensionierten Block spricht aber
die Art der Verklammerung, die uns durch die
beiden anschließenden Platten überliefert ist.
Fouilles IV pl. XI/XII 2 zeigt oben links die
Leere für eine halbe Schwalbenschwanzklam-
mer von 10 ctn Länge, Fouilles IV pl. XI/XII 1
oben rechts eine solche von 9*6 cm Länge. Selbst
wenn die auf dem schmalen Block zu ergän-
zenden Klammerhälften unmittelbar anein-
anderstießen, übertrifft das aus diesen Klam-
merhälften zu erschließende Maß (10 + 9-6 =
Auffindung etwas Anschlußfläche zeigte, die später
zerstört wurde, ist nicht mehr beweisbar. Heute sieht
man wohl Splitterungen an den Bruchrändern, aber
keinen Anhalt für einen modernen, auf eine größere
Fläche sich erstreckenden Bruch.