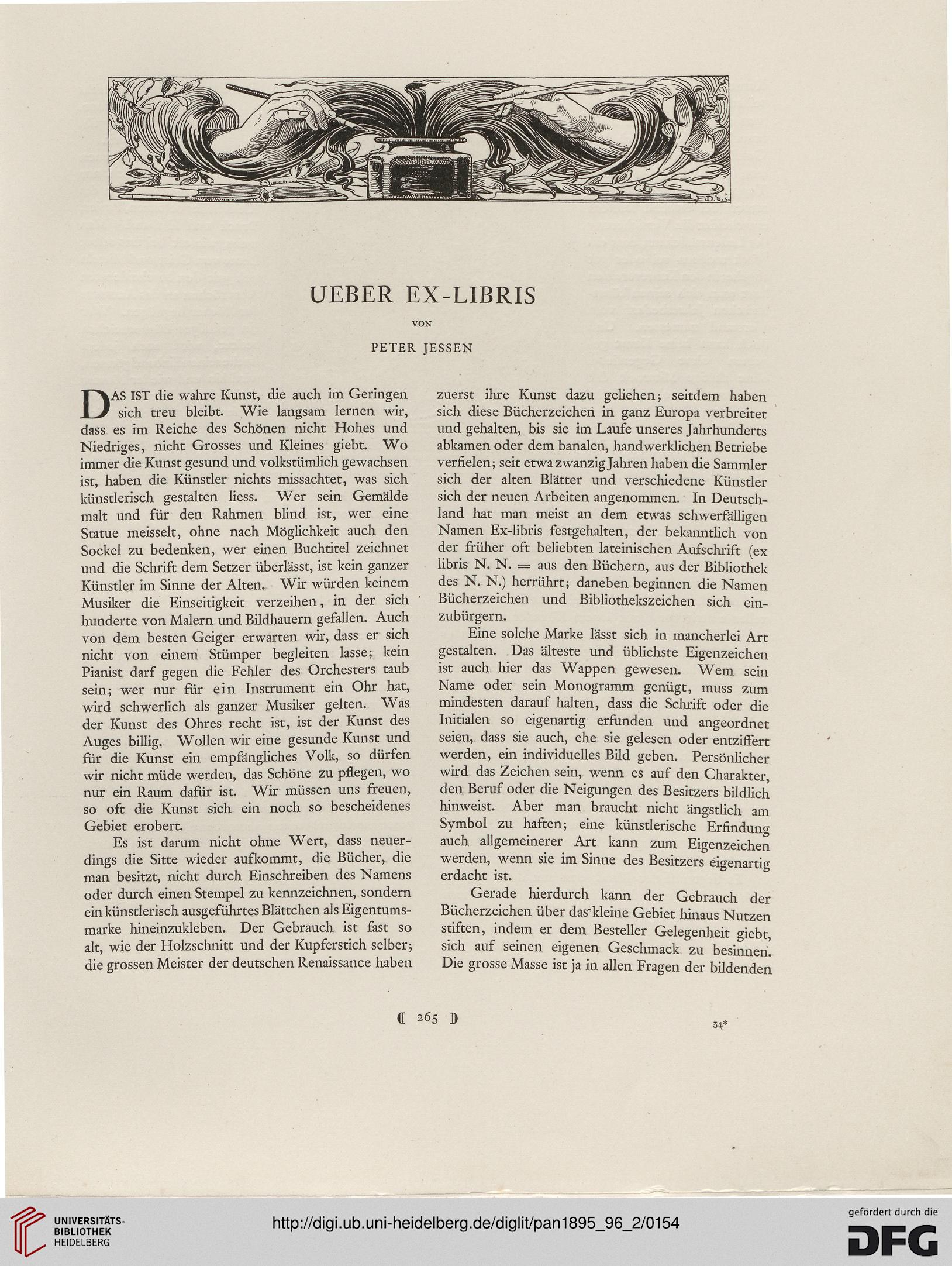ÜEBER EX-LIBRIS
VON
PETER JESSEN
DAS IST die wahre Kunst, die auch im Geringen
sich treu bleibt. Wie langsam lernen wir,
dass es im Reiche des Schönen nicht Hohes und
Niedriges, nicht Grosses und Kleines giebt. Wo
immer die Kunst gesund und volkstümlich gewachsen
ist, haben die Künstler nichts missachtet, was sich
künstlerisch gestalten liess. Wer sein Gemälde
malt und für den Rahmen blind ist, wer eine
Statue meisselt, ohne nach Möglichkeit auch den
Sockel zu bedenken, wer einen Buchtitel zeichnet
und die Schrift dem Setzer überlässt, ist kein ganzer
Künstler im Sinne der Alten. Wir würden keinem
Musiker die Einseitigkeit verzeihen, in der sich
hunderte von Malern und Bildhauern gefallen. Auch
von dem besten Geiger erwarten wir, dass er sich
nicht von einem Stümper begleiten lasse; kein
Pianist darf gegen die Fehler des Orchesters taub
sein; wer nur für ein Instrument ein Ohr hat,
wird schwerlich als ganzer Musiker gelten. Was
der Kunst des Ohres recht ist, ist der Kunst des
Auges billig. Wollen wir eine gesunde Kunst und
für die Kunst ein empfängliches Volk, so dürfen
wir nicht müde werden, das Schöne zu pflegen, wo
nur ein Raum dafür ist. Wir müssen uns freuen,
so oft die Kunst sich ein noch so bescheidenes
Gebiet erobert.
Es ist darum nicht ohne Wert, dass neuer-
dings die Sitte wieder aufkommt, die Bücher, die
man besitzt, nicht durch Einschreiben des Namens
oder durch einen Stempel zu kennzeichnen, sondern
ein künstlerisch ausgeführtes Blättchen als Eigentums-
marke hineinzukleben. Der Gebrauch ist fast so
alt, wie der Holzschnitt und der Kupferstich selber;
die grossen Meister der deutschen Renaissance haben
zuerst ihre Kunst dazu geliehen; seitdem haben
sich diese Bücherzeichen in ganz Europa verbreitet
und gehalten, bis sie im Laufe unseres Jahrhunderts
abkamen oder dem banalen, handwerklichen Betriebe
verfielen; seit etwa zwanzig Jahren haben die Sammler
sich der alten Blätter und verschiedene Künstler
sich der neuen Arbeiten angenommen. In Deutsch-
land hat man meist an dem etwas schwerfälligen
Namen Ex-libris festgehalten, der bekanntlich von
der früher oft beliebten lateinischen Aufschrift (ex
libris N. N. = aus den Büchern, aus der Bibliothek
des N. N.) herrührt; daneben beginnen die Namen
Bücherzeichen und Bibliothekszeichen sich ein-
zubürgern.
Eine solche Marke lässt sich in mancherlei Art
gestalten. Das älteste und üblichste Eigenzeichen
ist auch hier das Wappen gewesen. Wem sein
Name oder sein Monogramm genügt, muss zum
mindesten darauf halten, dass die Schrift oder die
Initialen so eigenartig erfunden und angeordnet
seien, dass sie auch, ehe sie gelesen oder entziffert
werden, ein individuelles Bild geben. Persönlicher
wird das Zeichen sein, wenn es auf den Charakter
den Beruf oder die Neigungen des Besitzers bildlich
hinweist. Aber man braucht nicht ängstlich am
Symbol zu haften; eine künstlerische Erfindung
auch allgemeinerer Art kann zum Eigenzeichen
werden, wenn sie im Sinne des Besitzers eigenartig
erdacht ist.
Gerade hierdurch kann der Gebrauch der
Bücherzeichen über das" kleine Gebiet hinaus Nutzen
stiften, indem er dem Besteller Gelegenheit giebt,
sich auf seinen eigenen Geschmack zu besinnen!
Die grosse Masse ist ja in allen Fragen der bildenden
C 265 ])
3^*
VON
PETER JESSEN
DAS IST die wahre Kunst, die auch im Geringen
sich treu bleibt. Wie langsam lernen wir,
dass es im Reiche des Schönen nicht Hohes und
Niedriges, nicht Grosses und Kleines giebt. Wo
immer die Kunst gesund und volkstümlich gewachsen
ist, haben die Künstler nichts missachtet, was sich
künstlerisch gestalten liess. Wer sein Gemälde
malt und für den Rahmen blind ist, wer eine
Statue meisselt, ohne nach Möglichkeit auch den
Sockel zu bedenken, wer einen Buchtitel zeichnet
und die Schrift dem Setzer überlässt, ist kein ganzer
Künstler im Sinne der Alten. Wir würden keinem
Musiker die Einseitigkeit verzeihen, in der sich
hunderte von Malern und Bildhauern gefallen. Auch
von dem besten Geiger erwarten wir, dass er sich
nicht von einem Stümper begleiten lasse; kein
Pianist darf gegen die Fehler des Orchesters taub
sein; wer nur für ein Instrument ein Ohr hat,
wird schwerlich als ganzer Musiker gelten. Was
der Kunst des Ohres recht ist, ist der Kunst des
Auges billig. Wollen wir eine gesunde Kunst und
für die Kunst ein empfängliches Volk, so dürfen
wir nicht müde werden, das Schöne zu pflegen, wo
nur ein Raum dafür ist. Wir müssen uns freuen,
so oft die Kunst sich ein noch so bescheidenes
Gebiet erobert.
Es ist darum nicht ohne Wert, dass neuer-
dings die Sitte wieder aufkommt, die Bücher, die
man besitzt, nicht durch Einschreiben des Namens
oder durch einen Stempel zu kennzeichnen, sondern
ein künstlerisch ausgeführtes Blättchen als Eigentums-
marke hineinzukleben. Der Gebrauch ist fast so
alt, wie der Holzschnitt und der Kupferstich selber;
die grossen Meister der deutschen Renaissance haben
zuerst ihre Kunst dazu geliehen; seitdem haben
sich diese Bücherzeichen in ganz Europa verbreitet
und gehalten, bis sie im Laufe unseres Jahrhunderts
abkamen oder dem banalen, handwerklichen Betriebe
verfielen; seit etwa zwanzig Jahren haben die Sammler
sich der alten Blätter und verschiedene Künstler
sich der neuen Arbeiten angenommen. In Deutsch-
land hat man meist an dem etwas schwerfälligen
Namen Ex-libris festgehalten, der bekanntlich von
der früher oft beliebten lateinischen Aufschrift (ex
libris N. N. = aus den Büchern, aus der Bibliothek
des N. N.) herrührt; daneben beginnen die Namen
Bücherzeichen und Bibliothekszeichen sich ein-
zubürgern.
Eine solche Marke lässt sich in mancherlei Art
gestalten. Das älteste und üblichste Eigenzeichen
ist auch hier das Wappen gewesen. Wem sein
Name oder sein Monogramm genügt, muss zum
mindesten darauf halten, dass die Schrift oder die
Initialen so eigenartig erfunden und angeordnet
seien, dass sie auch, ehe sie gelesen oder entziffert
werden, ein individuelles Bild geben. Persönlicher
wird das Zeichen sein, wenn es auf den Charakter
den Beruf oder die Neigungen des Besitzers bildlich
hinweist. Aber man braucht nicht ängstlich am
Symbol zu haften; eine künstlerische Erfindung
auch allgemeinerer Art kann zum Eigenzeichen
werden, wenn sie im Sinne des Besitzers eigenartig
erdacht ist.
Gerade hierdurch kann der Gebrauch der
Bücherzeichen über das" kleine Gebiet hinaus Nutzen
stiften, indem er dem Besteller Gelegenheit giebt,
sich auf seinen eigenen Geschmack zu besinnen!
Die grosse Masse ist ja in allen Fragen der bildenden
C 265 ])
3^*