Hinweis: Dies ist eine zusätzlich gescannte Seite, um Farbkeil und Maßstab abbilden zu können.
0.5
1 cm
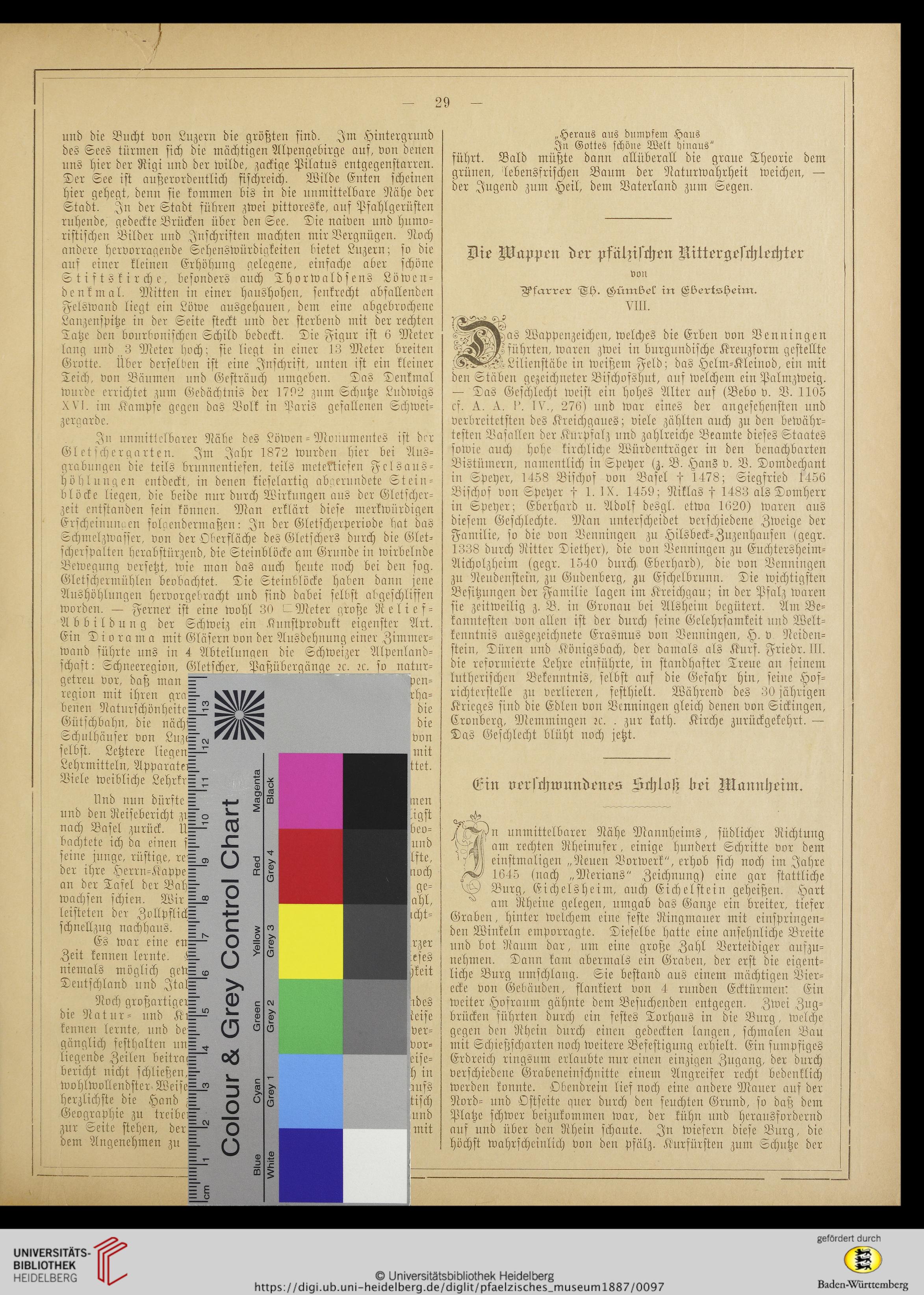
29
pen-
ttet.
Ein verschwundenes Schloß der Mannheim.
rzer
eses
jkeit
o
o
öS
men
ngst
beo-
uud
lste,
noch
ge-
ahl,
icht-
Aie Mappen der pfälzischen Mttergeschlechter
von
H'fcrrrrev GH. Gümöet in GüercksHeim.
VIII.
„Heraus aus dumpfem Haus
In Gottes schöne Welt hinaus"
fuhrt. Bald müßte dann allüberall die graue Theorie dem
grünen, lebenssrischen Baum der Naturwahrheit weichem —
der Jugend zum Heil, dem Vaterland zum Segen.
unmittelbarer Nähe Mannheims, südlicher Richtung
am rechten Rheinufer, einige hundert Schritte vor dem
'7 einstmaligen „Neuen Vorwerk", erhob sich noch im Jahre
1045 (noch „Merians" Zeichnung) eine gar stattliche
Burg, Eichelsheim, auch Eichelstein geheißen. Hart
"" am Rheine gelegen, umgab das Ganze ein breiter, tiefer
Graben, hinter welchem eine feste Ringmauer mit einspringen-
den Winkeln emporragte. Dieselbe hatte eine ansehnliche Breite
und bot Raum dar, um eine große Zahl Verteidiger auszu-
nehmen. Dann kam abermals ein Graben, der erst die eigent-
liche Burg umschlang. Sie bestand aus einem mächtigen Vier-
ecke von Gebäuden, flankiert von 4 runden Ecktürmem Ein
weiter Hofraum gähnte dem Besuchenden entgegen. Zwei Zug-
brücken führten durch ein festes Torhans in die Burg, welche
gegen den Rhein durch einen gedeckten langen, schmalen Bau
mit Schießscharten noch weitere Befestigung erhielt. Ein sumpfiges
Erdreich ringsum erlaubte nur einen einzigen Zugang, der durch
verschiedene Grabeneinschmtte einem Angreifer recht bedenklich
werden konnte. Obendrein lies noch eine andere Mauer aus der
Nord- und Ostseite quer durch den feuchten Grund, so daß dem
Platze schwer beizukommen war, der kühn und herausfordernd
auf und über den Rhein schaute. In wiefern diese Burg, die
höchst wahrscheinlich von den Psülz. Kurfürsten zum Schutze der
selbst. Letztere liegen^-^
Lehrmitteln, Apparate^
Viele weibliche LehrkrS
Und nun dürste
und den Reisebericht ziS
nach Basel zurück. US
beichtete ich da einen sS.
seine junge, rüstige, re^
der ihre Herru-Kappe^
an der Tafel der BahS
wachsen schien. Wir S.
leisteten der Zollpslick^
schnellzug nachhaus.
Es war eine enS
Zeit kennen lernte. iS.
niemals möglich geü^ co
Deutschland und Jtal^
Noch großartigeeS"
die Natur- und KnS-^
kennen lernte, und de^_
gänglich festhalten un^
liegende Zeilen beitrag
bericht nicht schließen,:
wohlwollendster Weisei
herzlichste die Hand 1
Geographie Zu treibe:
zur Seite stehen, der
dem Angenehmen zu
chf^Mrws Wappenzeichen, welches die Erben von Venningen
waren zwei in burgundische Kreuzform gestellte
W^^M Lilienstäbe in weißem Feld; das Helm-Kleinod, ein mit
den Stäben gezeichneter Bischosshut, auf welchem ein Palmzweig.
— Das Geschlecht weist ein hohes Alter auf (Bebo v. V. 1105
cs. rV. T. 0. IV., 276) und war eines der angesehensten und
verbreitetsten des Kreichgaues; viele zählten auch zu den bewähr-
testen Vasallen der Kurpsalz und zahlreiche Beamte dieses Staates
sowie auch hohe kirchliche Würdenträger in den benachbarten
Bistümern, namentlich in Speyer (z. B. Hans v. V. Domdechant
in Speyer, 1458 Bischof von Basel p 1478; Siegfried 1456
Bischof von Speyer ß 1. I X. 1459; Niklas p 1483 als Domherr
in Speyer; Eberhard u. Adolf desgl. etwa 1620) waren aus
diesem Geschlechte. Man unterscheidet verschiedene Zweige der
Familie, so die von Venningen zu Hilsbeck-Zuzenhausen (gegr.
1338 durch Ritter Diether), die von Venningen zu Euchtersheim-
Aicholzheim (gegr. 1540 durch Eberhard), die von Venningen
zu Neudenstein, zu Gudenberg, zu Eschelbrunn. Die wichtigsten
Besitzungen der Familie lagen im Kreichgau; in der Pfalz waren
sie zeitweilig z. B. in Gronau bei Alsheim begütert. Am Be-
kanntesten von allen ist der durch seine Gelehrsamkeit und Welt-
kenntnis ausgezeichnete Erasmus von Venningen, H. v Neiden-
stein, Düren und Königsbach, der damals als Kurf. Friedr. III.
die reformierte Lehre einsührte, in standhafter Treue an seinem
lutherischen Bekenntnis, selbst aus die Gefahr hin, seine Hos-
richterstclle zu verlieren, sesthielt. Während des 30 jährigen
Krieges sind die Edlen von Venningen gleich denen von Sickingen,
Cronberg, Memmingen rc. . zur kath. Kirche zurückgekehrt. —
Das Geschlecht blüht noch jetzt.
und die Bucht von Luzern die größten sind. Im Hintergrund
des Sees türmen sich die mächtigen Alpengebirge aus, von denen
uns hier der Rigi und der wilde, zackige Pilatus entgegenstarren.
Der See ist außerordentlich fischreich. Wilde Enten scheinen
hier gehegt, denn sie kommen bis in die unmittelbare Nähe der
Stadt. In der Stadt führen zwei pittoreske, auf Psahlgerüsten
ruhende, gedeckte Brücken über den See. Die naiven und humo-
ristischen Bilder und Inschriften machten mir Vergnügen. Noch
andere hervorragende Sehenswürdigkeiten bietet Luzern; so die
aus einer kleinen Erhöhung gelegene, einfache aber schöne
Stiftskirche, besonders auch Thorwaldsens Löwen-
denkmal. Mitten in einer haushohen, senkrecht abfallenden
Felswand liegt ein Löwe ausgehauen, dem eine abgebrochene
Lanzenspitze in der Seite steckt und der sterbend mit der rechten
Tatze den bourbonischen Schild bedeckt. Die Figur ist 6 Meter
lang und 3 Meter hoch: sie liegt in einer 13 Meter breiten
Grotte. Uber derselben ist eine Inschrift, unten ist ein kleiner
Teich, von Bäumen und Gesträuch umgeben. Das Denkmal
wurde errichtet zum Gedächtnis der 1792 zum Schutze Ludwigs
XVI. im Kampfe gegen das Volk in Paris gefallenen Schwei-
zergarde.
In unmittelbarer Näbe des Löwen-Monumentes ist der
Gletschergarten. Im Jahr 1872 wurden hier bei Aus-
grabungen die teils brunnentiesen, teils meteVtiesen Fels aus-
höhl ungen entdeckt, in denen kieselartig abgerundete St ein -
blöcke liegen, die beide nur durch Wirkungen aus der Gletscher-
zeit entstanden sein können. Man erklärt diese merkwürdigen
Erschcinumen folgendermaßen: In der Gletscherperiode bat das
Schmelzwasser, von der Oberfläche des Gletschers durch die Glet-
scherspalten herabstürzend, die Steinblöcke am Grunde in wirbelnde
Bewegung versetzt, wie man das auch heute noch bei den sog.
Gletschermühlen beobachtet. Tie Steinblöcke haben dann jene
Aushöhlungen hervorgebracht und sind dabei selbst abgeschlisfen
worden. — Ferner ist eine Wohl 30 !—Meter große Relief-
Abbildung der Schweiz ein Kunstprodukt eigenster Art.
Ein Diorama mit Gläsern vou der Ausdehnung einer Zimmer-
wand führte uns in 4 Abteilungen die Schweizer Alpenland-
schaft: Schneeregion, Gletscher, Paßübergänge rc. rc. so natur-
getreu vor, daß man
region mit ihren gra^-
benen Naturschönbeite^
Gütschbahn, die nächiS
Lchulhäuser von LunS"^
M einstmaligen „Neuen Vorwerk", erhob sich noch im Jahre
1645 (nach „Merians" Zeichnung) eine gar stattliche
g
pen-
ttet.
Ein verschwundenes Schloß der Mannheim.
rzer
eses
jkeit
o
o
öS
men
ngst
beo-
uud
lste,
noch
ge-
ahl,
icht-
Aie Mappen der pfälzischen Mttergeschlechter
von
H'fcrrrrev GH. Gümöet in GüercksHeim.
VIII.
„Heraus aus dumpfem Haus
In Gottes schöne Welt hinaus"
fuhrt. Bald müßte dann allüberall die graue Theorie dem
grünen, lebenssrischen Baum der Naturwahrheit weichem —
der Jugend zum Heil, dem Vaterland zum Segen.
unmittelbarer Nähe Mannheims, südlicher Richtung
am rechten Rheinufer, einige hundert Schritte vor dem
'7 einstmaligen „Neuen Vorwerk", erhob sich noch im Jahre
1045 (noch „Merians" Zeichnung) eine gar stattliche
Burg, Eichelsheim, auch Eichelstein geheißen. Hart
"" am Rheine gelegen, umgab das Ganze ein breiter, tiefer
Graben, hinter welchem eine feste Ringmauer mit einspringen-
den Winkeln emporragte. Dieselbe hatte eine ansehnliche Breite
und bot Raum dar, um eine große Zahl Verteidiger auszu-
nehmen. Dann kam abermals ein Graben, der erst die eigent-
liche Burg umschlang. Sie bestand aus einem mächtigen Vier-
ecke von Gebäuden, flankiert von 4 runden Ecktürmem Ein
weiter Hofraum gähnte dem Besuchenden entgegen. Zwei Zug-
brücken führten durch ein festes Torhans in die Burg, welche
gegen den Rhein durch einen gedeckten langen, schmalen Bau
mit Schießscharten noch weitere Befestigung erhielt. Ein sumpfiges
Erdreich ringsum erlaubte nur einen einzigen Zugang, der durch
verschiedene Grabeneinschmtte einem Angreifer recht bedenklich
werden konnte. Obendrein lies noch eine andere Mauer aus der
Nord- und Ostseite quer durch den feuchten Grund, so daß dem
Platze schwer beizukommen war, der kühn und herausfordernd
auf und über den Rhein schaute. In wiefern diese Burg, die
höchst wahrscheinlich von den Psülz. Kurfürsten zum Schutze der
selbst. Letztere liegen^-^
Lehrmitteln, Apparate^
Viele weibliche LehrkrS
Und nun dürste
und den Reisebericht ziS
nach Basel zurück. US
beichtete ich da einen sS.
seine junge, rüstige, re^
der ihre Herru-Kappe^
an der Tafel der BahS
wachsen schien. Wir S.
leisteten der Zollpslick^
schnellzug nachhaus.
Es war eine enS
Zeit kennen lernte. iS.
niemals möglich geü^ co
Deutschland und Jtal^
Noch großartigeeS"
die Natur- und KnS-^
kennen lernte, und de^_
gänglich festhalten un^
liegende Zeilen beitrag
bericht nicht schließen,:
wohlwollendster Weisei
herzlichste die Hand 1
Geographie Zu treibe:
zur Seite stehen, der
dem Angenehmen zu
chf^Mrws Wappenzeichen, welches die Erben von Venningen
waren zwei in burgundische Kreuzform gestellte
W^^M Lilienstäbe in weißem Feld; das Helm-Kleinod, ein mit
den Stäben gezeichneter Bischosshut, auf welchem ein Palmzweig.
— Das Geschlecht weist ein hohes Alter auf (Bebo v. V. 1105
cs. rV. T. 0. IV., 276) und war eines der angesehensten und
verbreitetsten des Kreichgaues; viele zählten auch zu den bewähr-
testen Vasallen der Kurpsalz und zahlreiche Beamte dieses Staates
sowie auch hohe kirchliche Würdenträger in den benachbarten
Bistümern, namentlich in Speyer (z. B. Hans v. V. Domdechant
in Speyer, 1458 Bischof von Basel p 1478; Siegfried 1456
Bischof von Speyer ß 1. I X. 1459; Niklas p 1483 als Domherr
in Speyer; Eberhard u. Adolf desgl. etwa 1620) waren aus
diesem Geschlechte. Man unterscheidet verschiedene Zweige der
Familie, so die von Venningen zu Hilsbeck-Zuzenhausen (gegr.
1338 durch Ritter Diether), die von Venningen zu Euchtersheim-
Aicholzheim (gegr. 1540 durch Eberhard), die von Venningen
zu Neudenstein, zu Gudenberg, zu Eschelbrunn. Die wichtigsten
Besitzungen der Familie lagen im Kreichgau; in der Pfalz waren
sie zeitweilig z. B. in Gronau bei Alsheim begütert. Am Be-
kanntesten von allen ist der durch seine Gelehrsamkeit und Welt-
kenntnis ausgezeichnete Erasmus von Venningen, H. v Neiden-
stein, Düren und Königsbach, der damals als Kurf. Friedr. III.
die reformierte Lehre einsührte, in standhafter Treue an seinem
lutherischen Bekenntnis, selbst aus die Gefahr hin, seine Hos-
richterstclle zu verlieren, sesthielt. Während des 30 jährigen
Krieges sind die Edlen von Venningen gleich denen von Sickingen,
Cronberg, Memmingen rc. . zur kath. Kirche zurückgekehrt. —
Das Geschlecht blüht noch jetzt.
und die Bucht von Luzern die größten sind. Im Hintergrund
des Sees türmen sich die mächtigen Alpengebirge aus, von denen
uns hier der Rigi und der wilde, zackige Pilatus entgegenstarren.
Der See ist außerordentlich fischreich. Wilde Enten scheinen
hier gehegt, denn sie kommen bis in die unmittelbare Nähe der
Stadt. In der Stadt führen zwei pittoreske, auf Psahlgerüsten
ruhende, gedeckte Brücken über den See. Die naiven und humo-
ristischen Bilder und Inschriften machten mir Vergnügen. Noch
andere hervorragende Sehenswürdigkeiten bietet Luzern; so die
aus einer kleinen Erhöhung gelegene, einfache aber schöne
Stiftskirche, besonders auch Thorwaldsens Löwen-
denkmal. Mitten in einer haushohen, senkrecht abfallenden
Felswand liegt ein Löwe ausgehauen, dem eine abgebrochene
Lanzenspitze in der Seite steckt und der sterbend mit der rechten
Tatze den bourbonischen Schild bedeckt. Die Figur ist 6 Meter
lang und 3 Meter hoch: sie liegt in einer 13 Meter breiten
Grotte. Uber derselben ist eine Inschrift, unten ist ein kleiner
Teich, von Bäumen und Gesträuch umgeben. Das Denkmal
wurde errichtet zum Gedächtnis der 1792 zum Schutze Ludwigs
XVI. im Kampfe gegen das Volk in Paris gefallenen Schwei-
zergarde.
In unmittelbarer Näbe des Löwen-Monumentes ist der
Gletschergarten. Im Jahr 1872 wurden hier bei Aus-
grabungen die teils brunnentiesen, teils meteVtiesen Fels aus-
höhl ungen entdeckt, in denen kieselartig abgerundete St ein -
blöcke liegen, die beide nur durch Wirkungen aus der Gletscher-
zeit entstanden sein können. Man erklärt diese merkwürdigen
Erschcinumen folgendermaßen: In der Gletscherperiode bat das
Schmelzwasser, von der Oberfläche des Gletschers durch die Glet-
scherspalten herabstürzend, die Steinblöcke am Grunde in wirbelnde
Bewegung versetzt, wie man das auch heute noch bei den sog.
Gletschermühlen beobachtet. Tie Steinblöcke haben dann jene
Aushöhlungen hervorgebracht und sind dabei selbst abgeschlisfen
worden. — Ferner ist eine Wohl 30 !—Meter große Relief-
Abbildung der Schweiz ein Kunstprodukt eigenster Art.
Ein Diorama mit Gläsern vou der Ausdehnung einer Zimmer-
wand führte uns in 4 Abteilungen die Schweizer Alpenland-
schaft: Schneeregion, Gletscher, Paßübergänge rc. rc. so natur-
getreu vor, daß man
region mit ihren gra^-
benen Naturschönbeite^
Gütschbahn, die nächiS
Lchulhäuser von LunS"^
M einstmaligen „Neuen Vorwerk", erhob sich noch im Jahre
1645 (nach „Merians" Zeichnung) eine gar stattliche
g



