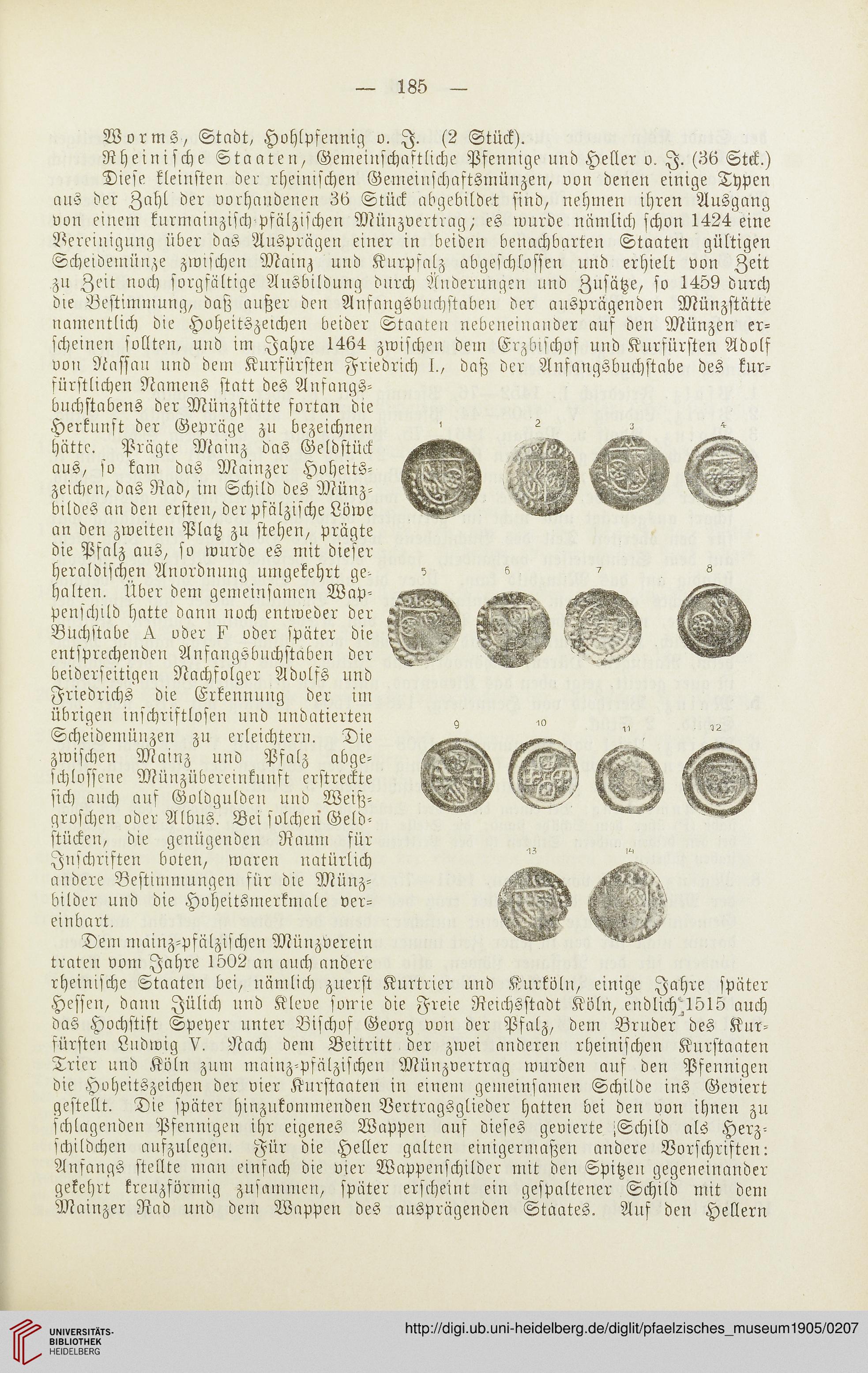185
Worms/ Stadt, Hohlpfennig o. I. (2 Stück).
Rheinische Staaten/ Gemeinschaftliche Pfennige und Heller o. I. (86 Stck.)
Diese kleinsten der rheinischen Gemeinschaftsmünzen/ von denen einige Typen
ans der Zahl der vorhandenen 36 Stück abgebildet sind/ nehmen ihren Ausgang
von einem knrmainzisch pfälzischen Münzvertrag,' es wurde nämlich schon 1424 eine
Bereinigung über das Ausprägen einer in beiden benachbarten Staaten gültigen
Scheidemünze zwischen Mainz und Kurpfalz abgeschlossen und erhielt von Zeit
zu Zeit noch sorgfältige Ausbildung durch Änderungen und Zusätze/ so 1459 durch
die Bestimmung/ daß außer den Anfangsbuchstaben der ausprägenden Münzstätte
namentlich die Hoheitszeichen beider Staaten nebeneinander auf den Münzen er-
scheinen sollten, und im Jahre 1464 zwischen dem Erzbischof und Kurfürsten Adolf
von Nassau und dem Kurfürsten Friedrich I., daß der Anfangsbuchstabe des kur-
fürstlichen Namens statt des Anfangs-
buchstabens der Münzstätte fortan die
Herkunft der Gepräge zu bezeichnen
hätte. Prägte Mainz das Geldstück
aus/ so kam das Mainzer Hoheits-
zeichen, das Rad/ im Schild des Münz-
bildes an den ersten/ der pfälzische Löwe
an den zweiten Platz zu stehen/ prägte
die Pfalz aus/ so wurde es mit dieser
heraldischen Anordnung umgekehrt ge-
halten. Über deni gemeinsamen Wap-
penschild hatte dann noch entweder der
Buchstabe ^ oder oder später die
entsprechenden Anfangsbuchstaben der
beiderseitigen Nachfolger Adolfs und
Friedrichs die Erkennung der im
übrigen inschriftlosen und undatierten
Scheidemünzen zu erleichtern. Die
zwischen Mainz und Pfalz abge-
schlossene Münzübereinkunft erstreckte
sich auch auf Goldgulden und Weiß-
groschen oder Albus. Bei solchen Geld-
stücken/ die genügenden Raum für
Inschriften boten, waren natürlich
andere Bestimmungen für die Münz-
bilder und die Hoheitsmerkmale ver-
einbart.
Dem mainz-pfälzischen Münzverein
traten vom Jahre 1502 an auch andere
rheinische Staaten bei, nämlich zuerst Kurtrier und Kurköln/ einige Jahre später
Hessen, dann Jülich und Kleve svwie die Freie Reichsstadt Köln, endlich)1515 auch
das Hochstift Speyer unter Bischof Georg von der Pfalz, dem Bruder des Kur-
fürsten Ludwig V. Nach dem Beitritt der zwei anderen rheinischen Kurstaaten
Trier und Köln zürn mainz-pfälzischen Münzvertrag wurden auf den Pfennigen
die Hoheitszeichen der vier Kurstaaten in einem gemeinsamen Schilde ins Geviert
gestellt. Die später hinzukommenden Vertragsglieder hatten bei den von ihnen zu
schlagenden Pfennigen ihr eigenes Wappen auf dieses gevierte .Schild als Herz-
schildchen aufzulegen. Für die Heller galten einigermaßen andere Vorschriften:
Anfangs stellte man einfach die vier Wappenschilder mit den Spitzen gegeneinander
gekehrt kreuzförmig zusammen, später erscheint ein gespaltener Schild mit dem
Mainzer Rad und dem Wappen des ausprägenden Staates. Auf den Hellern
Worms/ Stadt, Hohlpfennig o. I. (2 Stück).
Rheinische Staaten/ Gemeinschaftliche Pfennige und Heller o. I. (86 Stck.)
Diese kleinsten der rheinischen Gemeinschaftsmünzen/ von denen einige Typen
ans der Zahl der vorhandenen 36 Stück abgebildet sind/ nehmen ihren Ausgang
von einem knrmainzisch pfälzischen Münzvertrag,' es wurde nämlich schon 1424 eine
Bereinigung über das Ausprägen einer in beiden benachbarten Staaten gültigen
Scheidemünze zwischen Mainz und Kurpfalz abgeschlossen und erhielt von Zeit
zu Zeit noch sorgfältige Ausbildung durch Änderungen und Zusätze/ so 1459 durch
die Bestimmung/ daß außer den Anfangsbuchstaben der ausprägenden Münzstätte
namentlich die Hoheitszeichen beider Staaten nebeneinander auf den Münzen er-
scheinen sollten, und im Jahre 1464 zwischen dem Erzbischof und Kurfürsten Adolf
von Nassau und dem Kurfürsten Friedrich I., daß der Anfangsbuchstabe des kur-
fürstlichen Namens statt des Anfangs-
buchstabens der Münzstätte fortan die
Herkunft der Gepräge zu bezeichnen
hätte. Prägte Mainz das Geldstück
aus/ so kam das Mainzer Hoheits-
zeichen, das Rad/ im Schild des Münz-
bildes an den ersten/ der pfälzische Löwe
an den zweiten Platz zu stehen/ prägte
die Pfalz aus/ so wurde es mit dieser
heraldischen Anordnung umgekehrt ge-
halten. Über deni gemeinsamen Wap-
penschild hatte dann noch entweder der
Buchstabe ^ oder oder später die
entsprechenden Anfangsbuchstaben der
beiderseitigen Nachfolger Adolfs und
Friedrichs die Erkennung der im
übrigen inschriftlosen und undatierten
Scheidemünzen zu erleichtern. Die
zwischen Mainz und Pfalz abge-
schlossene Münzübereinkunft erstreckte
sich auch auf Goldgulden und Weiß-
groschen oder Albus. Bei solchen Geld-
stücken/ die genügenden Raum für
Inschriften boten, waren natürlich
andere Bestimmungen für die Münz-
bilder und die Hoheitsmerkmale ver-
einbart.
Dem mainz-pfälzischen Münzverein
traten vom Jahre 1502 an auch andere
rheinische Staaten bei, nämlich zuerst Kurtrier und Kurköln/ einige Jahre später
Hessen, dann Jülich und Kleve svwie die Freie Reichsstadt Köln, endlich)1515 auch
das Hochstift Speyer unter Bischof Georg von der Pfalz, dem Bruder des Kur-
fürsten Ludwig V. Nach dem Beitritt der zwei anderen rheinischen Kurstaaten
Trier und Köln zürn mainz-pfälzischen Münzvertrag wurden auf den Pfennigen
die Hoheitszeichen der vier Kurstaaten in einem gemeinsamen Schilde ins Geviert
gestellt. Die später hinzukommenden Vertragsglieder hatten bei den von ihnen zu
schlagenden Pfennigen ihr eigenes Wappen auf dieses gevierte .Schild als Herz-
schildchen aufzulegen. Für die Heller galten einigermaßen andere Vorschriften:
Anfangs stellte man einfach die vier Wappenschilder mit den Spitzen gegeneinander
gekehrt kreuzförmig zusammen, später erscheint ein gespaltener Schild mit dem
Mainzer Rad und dem Wappen des ausprägenden Staates. Auf den Hellern