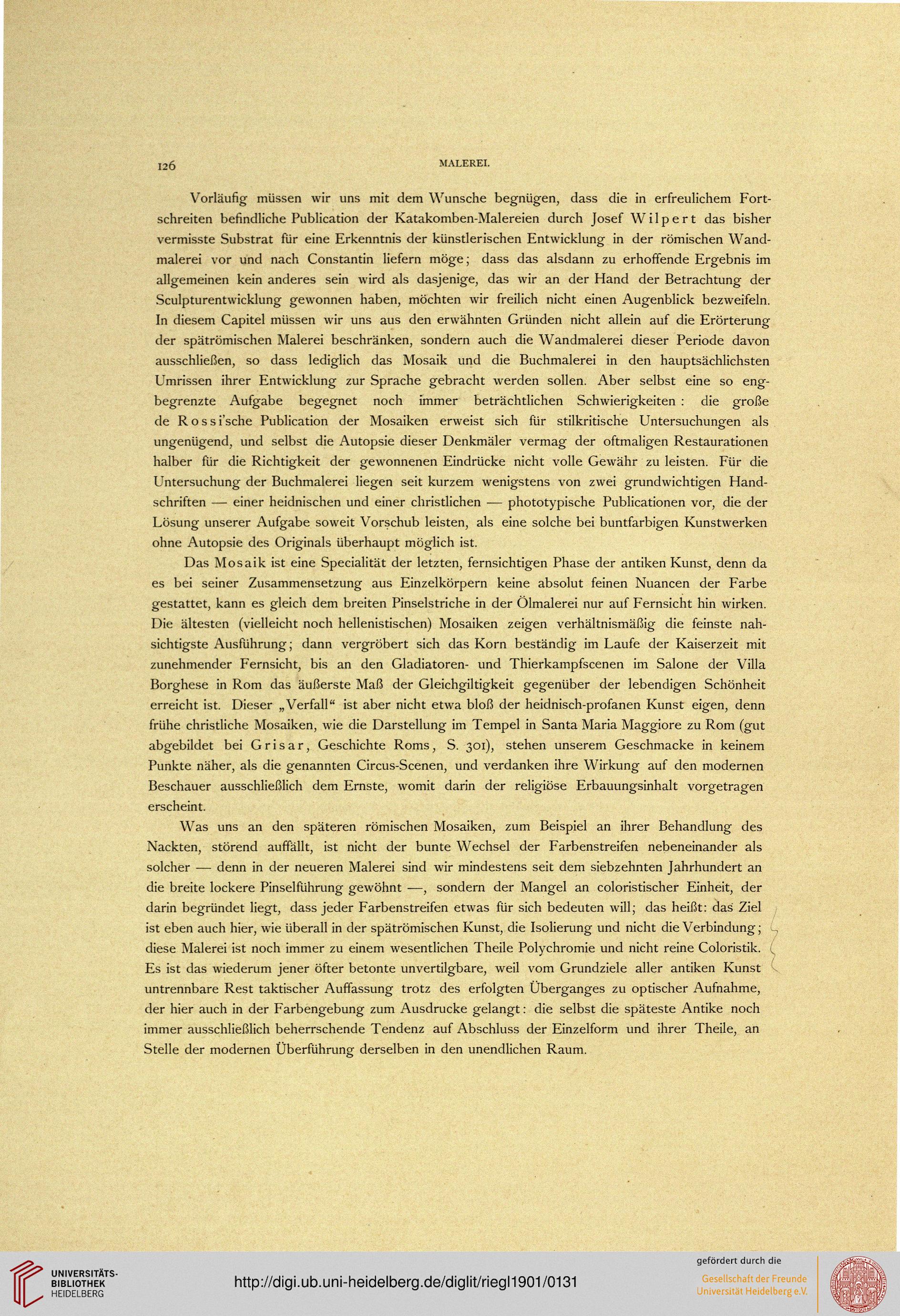I26 MALEREI.
Vorläufig müssen wir uns mit dem Wunsche begnügen, dass die in erfreulichem Fort-
schreiten befindliche Publication der Katakomben-Malereien durch Josef W i 1 p e r t das bisher
vermisste Substrat für eine Erkenntnis der künstlerischen Entwicklung in der römischen Wand-
malerei vor und nach Constantin liefern möge; dass das alsdann zu erhoffende Ergebnis im
allgemeinen kein anderes sein wird als dasjenige, das wir an der Hand der Betrachtung der
Sculpturentwicklung gewonnen haben, möchten wir freilich nicht einen Augenblick bezweifeln.
In diesem Capitel müssen wir uns aus den erwähnten Gründen nicht allein auf die Erörterung
der spätrömischen Malerei beschränken, sondern auch die Wandmalerei dieser Periode davon
ausschließen, so dass lediglich das Mosaik und die Buchmalerei in den hauptsächlichsten
Umrissen ihrer Entwicklung zur Sprache gebracht werden sollen. Aber selbst eine so eng-
begrenzte Aufgabe begegnet noch immer beträchtlichen Schwierigkeiten : die große
de Rossi'sche Publication der Mosaiken erweist sich für stilkritische Untersuchungen als
ungenügend, und selbst die Autopsie dieser Denkmäler vermag der oftmaligen Restaurationen
halber für die Richtigkeit der gewonnenen Eindrücke nicht volle Gewähr zu leisten. Für die
Untersuchung der Buchmalerei liegen seit kurzem wenigstens von zwei grundwichtigen Hand-
schriften — einer heidnischen und einer christlichen — phototypische Publicationen vor, die der
Lösung unserer Aufgabe soweit Vorschub leisten, als eine solche bei buntfarbigen Kunstwerken
ohne Autopsie des Originals überhaupt möglich ist.
Das Mosaik ist eine Specialität der letzten, fernsichtigen Phase der antiken Kunst, denn da
es bei seiner Zusammensetzung aus Einzelkörpern keine absolut feinen Nuancen der Farbe
gestattet, kann es gleich dem breiten Pinselstriche in der Ölmalerei nur auf Fernsicht hin wirken.
Die ältesten (vielleicht noch hellenistischen) Mosaiken zeigen verhältnismäßig die feinste nah-
sichtigste Ausführung; dann vergröbert sich das Korn beständig im Laufe der Kaiserzeit mit
zunehmender Fernsicht, bis an den Gladiatoren- und Thierkampfscenen im Salone der Villa
Borghese in Rom das äußerste Maß der Gleichgiltigkeit gegenüber der lebendigen Schönheit
erreicht ist. Dieser „Verfall" ist aber nicht etwa bloß der heidnisch-profanen Kunst eigen, denn
frühe christliche Mosaiken, wie die Darstellung im Tempel in Santa Maria Maggiore zu Rom (gut
abgebildet bei Grisar, Geschichte Roms, S. 301), stehen unserem Geschmacke in keinem
Punkte näher, als die genannten Circus-Scenen, und verdanken ihre Wirkung auf den modernen
Beschauer ausschließlich dem Ernste, womit darin der religiöse Erbauungsinhalt vorgetragen
erscheint.
Was uns an den späteren römischen Mosaiken, zum Beispiel an ihrer Behandlung des
Nackten, störend auffällt, ist nicht der bunte Wechsel der Farbenstreifen nebeneinander als
solcher — denn in der neueren Malerei sind wir mindestens seit dem siebzehnten Jahrhundert an
die breite lockere Pinselführung gewöhnt —, sondern der Mangel an coloristischer Einheit, der
darin begründet liegt, dass jeder Farbenstreifen etwas für sich bedeuten will; das heißt: das Ziel
ist eben auch hier, wie überall in der spätrömischen Kunst, die Isolierung und nicht die Verbindung; L
diese Malerei ist noch immer zu einem wesentlichen Theile Polychromie und nicht reine Coloristik. (
Es ist das wiederum jener öfter betonte unvertilgbare, weil vom Grundziele aller antiken Kunst
untrennbare Rest taktischer Auffassung trotz des erfolgten Überganges zu optischer Aufnahme,
der hier auch in der Farbengebung zum Ausdrucke gelangt: die selbst die späteste Antike noch
immer ausschließlich beherrschende Tendenz auf Abschluss der Einzelform und ihrer Theile, an
Stelle der modernen Überführung derselben in den unendlichen Raum.
Vorläufig müssen wir uns mit dem Wunsche begnügen, dass die in erfreulichem Fort-
schreiten befindliche Publication der Katakomben-Malereien durch Josef W i 1 p e r t das bisher
vermisste Substrat für eine Erkenntnis der künstlerischen Entwicklung in der römischen Wand-
malerei vor und nach Constantin liefern möge; dass das alsdann zu erhoffende Ergebnis im
allgemeinen kein anderes sein wird als dasjenige, das wir an der Hand der Betrachtung der
Sculpturentwicklung gewonnen haben, möchten wir freilich nicht einen Augenblick bezweifeln.
In diesem Capitel müssen wir uns aus den erwähnten Gründen nicht allein auf die Erörterung
der spätrömischen Malerei beschränken, sondern auch die Wandmalerei dieser Periode davon
ausschließen, so dass lediglich das Mosaik und die Buchmalerei in den hauptsächlichsten
Umrissen ihrer Entwicklung zur Sprache gebracht werden sollen. Aber selbst eine so eng-
begrenzte Aufgabe begegnet noch immer beträchtlichen Schwierigkeiten : die große
de Rossi'sche Publication der Mosaiken erweist sich für stilkritische Untersuchungen als
ungenügend, und selbst die Autopsie dieser Denkmäler vermag der oftmaligen Restaurationen
halber für die Richtigkeit der gewonnenen Eindrücke nicht volle Gewähr zu leisten. Für die
Untersuchung der Buchmalerei liegen seit kurzem wenigstens von zwei grundwichtigen Hand-
schriften — einer heidnischen und einer christlichen — phototypische Publicationen vor, die der
Lösung unserer Aufgabe soweit Vorschub leisten, als eine solche bei buntfarbigen Kunstwerken
ohne Autopsie des Originals überhaupt möglich ist.
Das Mosaik ist eine Specialität der letzten, fernsichtigen Phase der antiken Kunst, denn da
es bei seiner Zusammensetzung aus Einzelkörpern keine absolut feinen Nuancen der Farbe
gestattet, kann es gleich dem breiten Pinselstriche in der Ölmalerei nur auf Fernsicht hin wirken.
Die ältesten (vielleicht noch hellenistischen) Mosaiken zeigen verhältnismäßig die feinste nah-
sichtigste Ausführung; dann vergröbert sich das Korn beständig im Laufe der Kaiserzeit mit
zunehmender Fernsicht, bis an den Gladiatoren- und Thierkampfscenen im Salone der Villa
Borghese in Rom das äußerste Maß der Gleichgiltigkeit gegenüber der lebendigen Schönheit
erreicht ist. Dieser „Verfall" ist aber nicht etwa bloß der heidnisch-profanen Kunst eigen, denn
frühe christliche Mosaiken, wie die Darstellung im Tempel in Santa Maria Maggiore zu Rom (gut
abgebildet bei Grisar, Geschichte Roms, S. 301), stehen unserem Geschmacke in keinem
Punkte näher, als die genannten Circus-Scenen, und verdanken ihre Wirkung auf den modernen
Beschauer ausschließlich dem Ernste, womit darin der religiöse Erbauungsinhalt vorgetragen
erscheint.
Was uns an den späteren römischen Mosaiken, zum Beispiel an ihrer Behandlung des
Nackten, störend auffällt, ist nicht der bunte Wechsel der Farbenstreifen nebeneinander als
solcher — denn in der neueren Malerei sind wir mindestens seit dem siebzehnten Jahrhundert an
die breite lockere Pinselführung gewöhnt —, sondern der Mangel an coloristischer Einheit, der
darin begründet liegt, dass jeder Farbenstreifen etwas für sich bedeuten will; das heißt: das Ziel
ist eben auch hier, wie überall in der spätrömischen Kunst, die Isolierung und nicht die Verbindung; L
diese Malerei ist noch immer zu einem wesentlichen Theile Polychromie und nicht reine Coloristik. (
Es ist das wiederum jener öfter betonte unvertilgbare, weil vom Grundziele aller antiken Kunst
untrennbare Rest taktischer Auffassung trotz des erfolgten Überganges zu optischer Aufnahme,
der hier auch in der Farbengebung zum Ausdrucke gelangt: die selbst die späteste Antike noch
immer ausschließlich beherrschende Tendenz auf Abschluss der Einzelform und ihrer Theile, an
Stelle der modernen Überführung derselben in den unendlichen Raum.