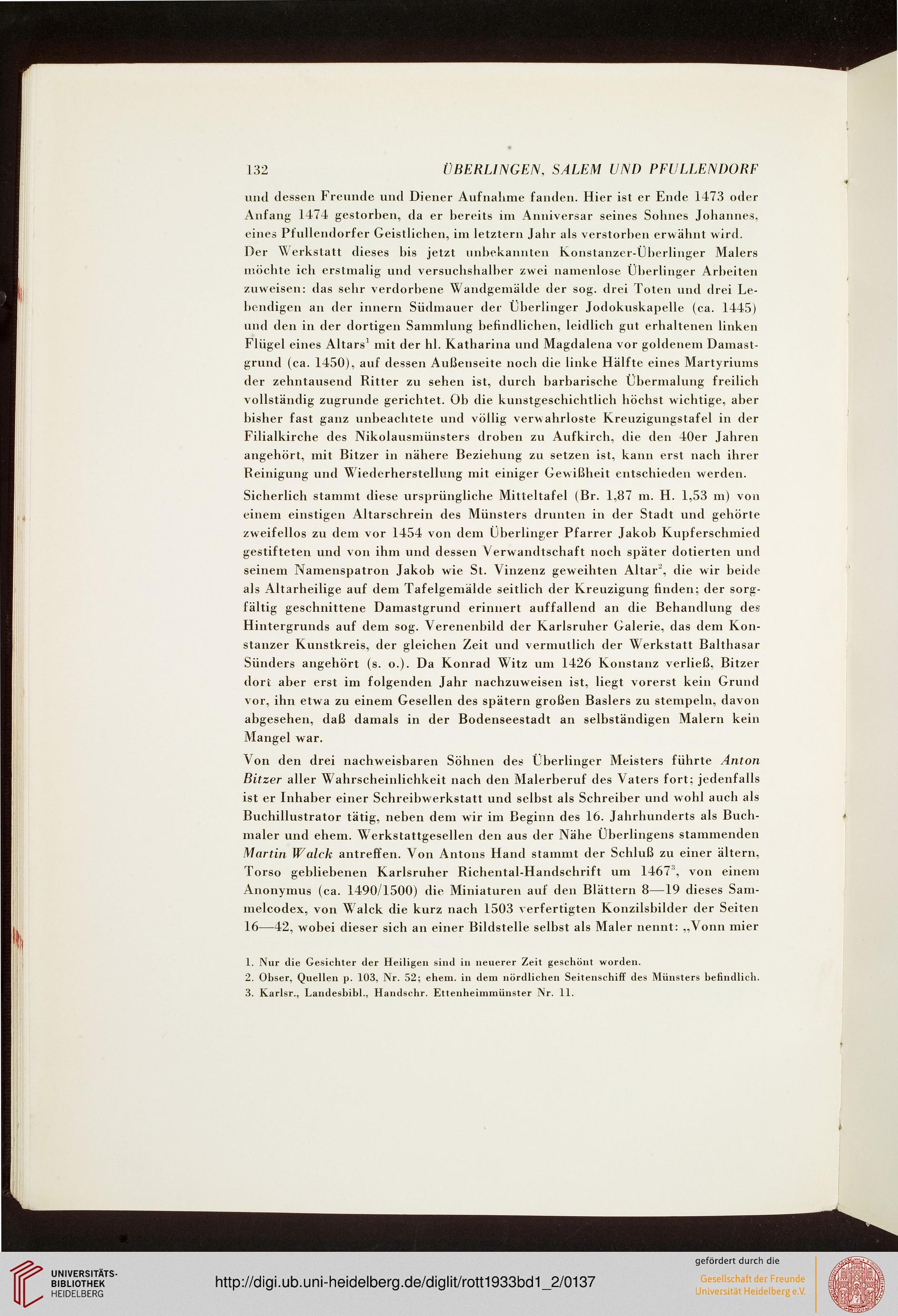132
ÜBERLINGEN, SALEM UND PEULLENDORE
und dessen Freunde und Diener Aufnahme fanden. Hier ist er Ende 1473 oder
Anfang 1474 gestorben, da er bereits im Anniversar seines Sohnes Johannes,
eines Pfullendorfer Geistlichen, im letztem Jahr als verstorben erwähnt wird.
Der Werkstatt dieses bis jetzt unbekannten Konstanzer-Überlinger Malers
möchte ich erstmalig und versuchshalber zwei namenlose Überlinger Arbeiten
zuweisen: das sehr verdorbene Wandgemälde der sog. drei Toten und drei Le-
bendigen an der innern Südmauer der Überlinger Jodokuskapelle (ca. 1445)
und den in der dortigen Sammlung befindlichen, leidlich gut erhaltenen linken
Flügel eines Altars1 mit der hl. Katharina und Magdalena vor goldenem Damast-
grund (ca. 1450), auf dessen Außenseite noch die linke Hälfte eines Martyriums
der zehntausend Ritter zu sehen ist, durch barbarische Übermalung freilich
vollständig zugrunde gerichtet. Ob die kunstgeschichtlich höchst wichtige, aber
bisher fast ganz unbeachtete und völlig verwahrloste Kreuzigungstafel in der
Filialkirche des Nikolausmünsters droben zu Aufkirch, die den 40er Jahren
angehört, mit Bitzer in nähere Beziehung zu setzen ist, kann erst nach ihrer
Reinigung und Wiederherstellung mit einiger Gewißheit entschieden werden.
Sicherlich stammt diese ursprüngliche Mitteltafel (Br. 1,87 m. H. 1,53 m) von
einem einstigen Altarschrein des Münsters drunten in der Stadt und gehörte
zweifellos zu dem vor 1454 von dem Überlinger Pfarrer Jakob Kupferschmied
gestifteten und von ihm und dessen Verwandtschaft noch später dotierten und
seinem Namenspatron Jakob wie St. Vinzenz geweihten Altar2, die wir beide
als Altarheilige auf dem Tafelgemälde seitlich der Kreuzigung finden; der sorg-
fältig geschnittene Damastgrund erinnert auffallend an die Behandlung des
Hintergrunds auf dem sog. Verenenbild der Karlsruher Galerie, das dem Kon-
stanzer Kunstkreis, der gleichen Zeit und vermutlich der Werkstatt Balthasar
Sünders angehört (s. o.). Da Konrad Witz um 1426 Konstanz verließ, Bitzer
dort aber erst im folgenden Jahr nachzuweisen ist, liegt vorerst kein Grund
vor, ihn etwa zu einem Gesellen des spätem großen Baslers zu stempeln, davon
abgesehen, daß damals in der Bodenseestadt an selbständigen Malern kein
Mangel war.
Von den drei nachweisbaren Söhnen des Überlinger Meisters führte Anton
Bitzer aller Wahrscheinlichkeit nach den Malerberuf des Vaters fort; jedenfalls
ist er Inhaber einer Schreibwerkstatt und selbst als Schreiber und wohl auch als
Buchillustrator tätig, neben dem wir im Beginn des 16. Jahrhunderts als Buch-
maler und ehem. Werkstattgesellen den aus der Nähe Überlingens stammenden
Martin Walck antreffen. Von Antons Hand stammt der Schluß zu einer altern,
Torso gebliebenen Karlsruher Richental-Handschrift um 14678, von einem
Anonymus (ca. 1490/1500) die Miniaturen auf den Blättern 8—19 dieses Sam-
melcodex, von Walck die kurz nach 1503 verfertigten Konzilsbilder der Seiten
16—42, wobei dieser sich an einer Bildstelle selbst als Maler nennt: „Vonn mier
1. Nur die Gesichter der Heiligen sind in neuerer Zeit geschönt worden.
2. Obser, Quellen p. 103, Nr. 52; ehem. in dem nördlichen Seitenschiff des Münsters befindlich.
3. Karlsr., Landesbibl., Handschr. Ettenheimmünster Nr. 11.
ÜBERLINGEN, SALEM UND PEULLENDORE
und dessen Freunde und Diener Aufnahme fanden. Hier ist er Ende 1473 oder
Anfang 1474 gestorben, da er bereits im Anniversar seines Sohnes Johannes,
eines Pfullendorfer Geistlichen, im letztem Jahr als verstorben erwähnt wird.
Der Werkstatt dieses bis jetzt unbekannten Konstanzer-Überlinger Malers
möchte ich erstmalig und versuchshalber zwei namenlose Überlinger Arbeiten
zuweisen: das sehr verdorbene Wandgemälde der sog. drei Toten und drei Le-
bendigen an der innern Südmauer der Überlinger Jodokuskapelle (ca. 1445)
und den in der dortigen Sammlung befindlichen, leidlich gut erhaltenen linken
Flügel eines Altars1 mit der hl. Katharina und Magdalena vor goldenem Damast-
grund (ca. 1450), auf dessen Außenseite noch die linke Hälfte eines Martyriums
der zehntausend Ritter zu sehen ist, durch barbarische Übermalung freilich
vollständig zugrunde gerichtet. Ob die kunstgeschichtlich höchst wichtige, aber
bisher fast ganz unbeachtete und völlig verwahrloste Kreuzigungstafel in der
Filialkirche des Nikolausmünsters droben zu Aufkirch, die den 40er Jahren
angehört, mit Bitzer in nähere Beziehung zu setzen ist, kann erst nach ihrer
Reinigung und Wiederherstellung mit einiger Gewißheit entschieden werden.
Sicherlich stammt diese ursprüngliche Mitteltafel (Br. 1,87 m. H. 1,53 m) von
einem einstigen Altarschrein des Münsters drunten in der Stadt und gehörte
zweifellos zu dem vor 1454 von dem Überlinger Pfarrer Jakob Kupferschmied
gestifteten und von ihm und dessen Verwandtschaft noch später dotierten und
seinem Namenspatron Jakob wie St. Vinzenz geweihten Altar2, die wir beide
als Altarheilige auf dem Tafelgemälde seitlich der Kreuzigung finden; der sorg-
fältig geschnittene Damastgrund erinnert auffallend an die Behandlung des
Hintergrunds auf dem sog. Verenenbild der Karlsruher Galerie, das dem Kon-
stanzer Kunstkreis, der gleichen Zeit und vermutlich der Werkstatt Balthasar
Sünders angehört (s. o.). Da Konrad Witz um 1426 Konstanz verließ, Bitzer
dort aber erst im folgenden Jahr nachzuweisen ist, liegt vorerst kein Grund
vor, ihn etwa zu einem Gesellen des spätem großen Baslers zu stempeln, davon
abgesehen, daß damals in der Bodenseestadt an selbständigen Malern kein
Mangel war.
Von den drei nachweisbaren Söhnen des Überlinger Meisters führte Anton
Bitzer aller Wahrscheinlichkeit nach den Malerberuf des Vaters fort; jedenfalls
ist er Inhaber einer Schreibwerkstatt und selbst als Schreiber und wohl auch als
Buchillustrator tätig, neben dem wir im Beginn des 16. Jahrhunderts als Buch-
maler und ehem. Werkstattgesellen den aus der Nähe Überlingens stammenden
Martin Walck antreffen. Von Antons Hand stammt der Schluß zu einer altern,
Torso gebliebenen Karlsruher Richental-Handschrift um 14678, von einem
Anonymus (ca. 1490/1500) die Miniaturen auf den Blättern 8—19 dieses Sam-
melcodex, von Walck die kurz nach 1503 verfertigten Konzilsbilder der Seiten
16—42, wobei dieser sich an einer Bildstelle selbst als Maler nennt: „Vonn mier
1. Nur die Gesichter der Heiligen sind in neuerer Zeit geschönt worden.
2. Obser, Quellen p. 103, Nr. 52; ehem. in dem nördlichen Seitenschiff des Münsters befindlich.
3. Karlsr., Landesbibl., Handschr. Ettenheimmünster Nr. 11.