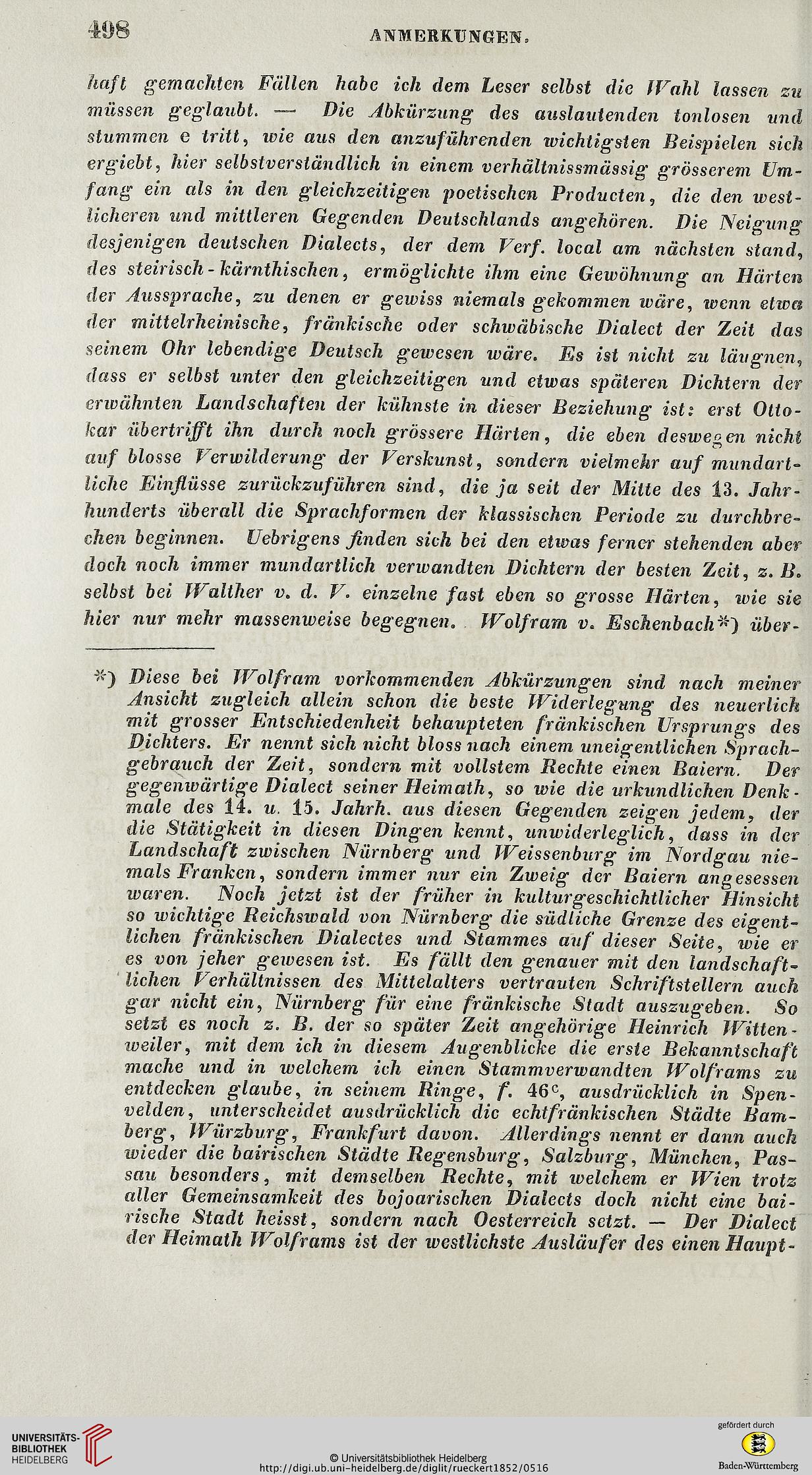Für diese Seite ist auch eine manuell angefertigte Transkription bzw. Edition verfügbar. Bitte wechseln Sie dafür zum Reiter "Transkription" oder "Edition".
408
ANMERKUNGEN.
hafl gemachten Fällen habe ich dem Leser selbst die fVahl lassen zu
müssen geglaubt. — Die Abkürzung des auslautenden tonlosen und
stummen e tritt, wie aus den anzuführenden ivichtigsten Beispielen sich
ergiebt, hier selbstverständlich in einem verhältnissmässig grösserem Um-
fang ein als in den gleichzeitigen poetischen Producten, die den west-
licheren and mittleren Gegenden Deutschlands angehören. Die Neigung
desjenigen deutschen Dialects, der dem T erf. local am nächsten stand,
des steirisch - kärnthischen, ermöglichte ihm eine Gewöhnung an Härten
der Aussprache, zu denen er gewiss niemals gekommen wäre, wenn etwa
der mittelrheinische, fränkische oder schwäbische Dialect der Zeit das
seinem Ohr lebendige Deutsch gewesen wäre. Es ist nicht zu läugnen,
dass er selbst unter den gleichzeitigen und etwas späteren Dichtern der
erwähnten Landschaften der kühnste in dieser Beziehung ist: erst Otlo-
kar übertrifft ihn durch noch grössere Härten, die eben deswegen nicht
auf blosse Verwilderung der Verskunst, sondern vielmehr auf mundart-
liche Einflüsse zurückzuführen sind, die ja seit der Mitte des 13. Jahr-
hunderts überall die Sprachformen der klassischen Periode zu durchbre-
chen beginnen. Uebrigens finden sich bei den etwas ferner stehenden aber
doch noch immer mundartlich verwandten Dichtern der besten Zeit, z. B.
selbst bei JValther v. d. V. einzelne fast eben so grosse Härten, wie sie
hier nur mehr massenweise begegnen. Wolfram v. Eschenbach^O über-
-;:-) Diese bei Wolfram vorkommenden Abkürzungen sind nach meiner
Ansicht zugleich allein schon die beste Widerlegung des neuerlich
mit grosser Entschiedenheit behaupteten fränkischen Ursprungs des
Dichters. Er nennt sich nicht bloss nach einem uneigentlichen Sprach-
gebrauch der Zeit, sondern mit vollstem Rechte einen Baiern. Der
gegenwärtige Dialect seiner Heimath, so wie die urkundlichen Denk -
male des 14. u. 15. Jahrh. aus diesen Gegenden zeigen jedem, der
die Stätigkeit in diesen Dingen kennt, unwiderleglich, dass in der
Landschaft zwischen Nürnberg und Weissenburg im Nordgau nie-
mals Franken, sondern immer nur ein Zweig der Baiern angesessen
waren. Noch jetzt ist der früher in kulturgeschichtlicher Hinsicht
so wichtige Reichswald von Nürnberg die südliche Grenze des eigent-
lichen fränkischen Dialectes und Stammes auf dieser Seite, wie er
es von jeher gewesen ist. Es fällt den genauer mit den landschaft-
lichen Verhältnissen des Mittelalters vertrauten Schriftstellern auch
gar nicht ein, Nürnberg für eine fränkische Stadt auszugeben. So
setzt es noch z. B. der so später Zeit angehörige Heinrich JVitten-
weiter, mit dem ich in diesem Augenblicke die erste Bekanntschaft
mache und in welchem ich einen Stammverwandten Wolframs zu
entdecken glaube, in seinein Ringe, f. 46°, ausdrücklich in Spen-
velden, unterscheidet ausdrücklich die echt fränkischen Städte Bam-
berg, Würzburg, Frankfurt davon. Allerdings nennt er dann auch
wieder die bairischen Städte Regensburg, Salzburg, München, Pas-
sau besonders, mit demselben Rechte, mit welchem er Wien trotz
aller Gemeinsamkeit des bojoarischen Dialects doch nicht eine bai-
rische Stadt heisst, sondern nach Oesterreich setzt. — Der Dialect
der Heimath JVolframs ist der westlichste Ausläufer des einen Haupt-
ANMERKUNGEN.
hafl gemachten Fällen habe ich dem Leser selbst die fVahl lassen zu
müssen geglaubt. — Die Abkürzung des auslautenden tonlosen und
stummen e tritt, wie aus den anzuführenden ivichtigsten Beispielen sich
ergiebt, hier selbstverständlich in einem verhältnissmässig grösserem Um-
fang ein als in den gleichzeitigen poetischen Producten, die den west-
licheren and mittleren Gegenden Deutschlands angehören. Die Neigung
desjenigen deutschen Dialects, der dem T erf. local am nächsten stand,
des steirisch - kärnthischen, ermöglichte ihm eine Gewöhnung an Härten
der Aussprache, zu denen er gewiss niemals gekommen wäre, wenn etwa
der mittelrheinische, fränkische oder schwäbische Dialect der Zeit das
seinem Ohr lebendige Deutsch gewesen wäre. Es ist nicht zu läugnen,
dass er selbst unter den gleichzeitigen und etwas späteren Dichtern der
erwähnten Landschaften der kühnste in dieser Beziehung ist: erst Otlo-
kar übertrifft ihn durch noch grössere Härten, die eben deswegen nicht
auf blosse Verwilderung der Verskunst, sondern vielmehr auf mundart-
liche Einflüsse zurückzuführen sind, die ja seit der Mitte des 13. Jahr-
hunderts überall die Sprachformen der klassischen Periode zu durchbre-
chen beginnen. Uebrigens finden sich bei den etwas ferner stehenden aber
doch noch immer mundartlich verwandten Dichtern der besten Zeit, z. B.
selbst bei JValther v. d. V. einzelne fast eben so grosse Härten, wie sie
hier nur mehr massenweise begegnen. Wolfram v. Eschenbach^O über-
-;:-) Diese bei Wolfram vorkommenden Abkürzungen sind nach meiner
Ansicht zugleich allein schon die beste Widerlegung des neuerlich
mit grosser Entschiedenheit behaupteten fränkischen Ursprungs des
Dichters. Er nennt sich nicht bloss nach einem uneigentlichen Sprach-
gebrauch der Zeit, sondern mit vollstem Rechte einen Baiern. Der
gegenwärtige Dialect seiner Heimath, so wie die urkundlichen Denk -
male des 14. u. 15. Jahrh. aus diesen Gegenden zeigen jedem, der
die Stätigkeit in diesen Dingen kennt, unwiderleglich, dass in der
Landschaft zwischen Nürnberg und Weissenburg im Nordgau nie-
mals Franken, sondern immer nur ein Zweig der Baiern angesessen
waren. Noch jetzt ist der früher in kulturgeschichtlicher Hinsicht
so wichtige Reichswald von Nürnberg die südliche Grenze des eigent-
lichen fränkischen Dialectes und Stammes auf dieser Seite, wie er
es von jeher gewesen ist. Es fällt den genauer mit den landschaft-
lichen Verhältnissen des Mittelalters vertrauten Schriftstellern auch
gar nicht ein, Nürnberg für eine fränkische Stadt auszugeben. So
setzt es noch z. B. der so später Zeit angehörige Heinrich JVitten-
weiter, mit dem ich in diesem Augenblicke die erste Bekanntschaft
mache und in welchem ich einen Stammverwandten Wolframs zu
entdecken glaube, in seinein Ringe, f. 46°, ausdrücklich in Spen-
velden, unterscheidet ausdrücklich die echt fränkischen Städte Bam-
berg, Würzburg, Frankfurt davon. Allerdings nennt er dann auch
wieder die bairischen Städte Regensburg, Salzburg, München, Pas-
sau besonders, mit demselben Rechte, mit welchem er Wien trotz
aller Gemeinsamkeit des bojoarischen Dialects doch nicht eine bai-
rische Stadt heisst, sondern nach Oesterreich setzt. — Der Dialect
der Heimath JVolframs ist der westlichste Ausläufer des einen Haupt-