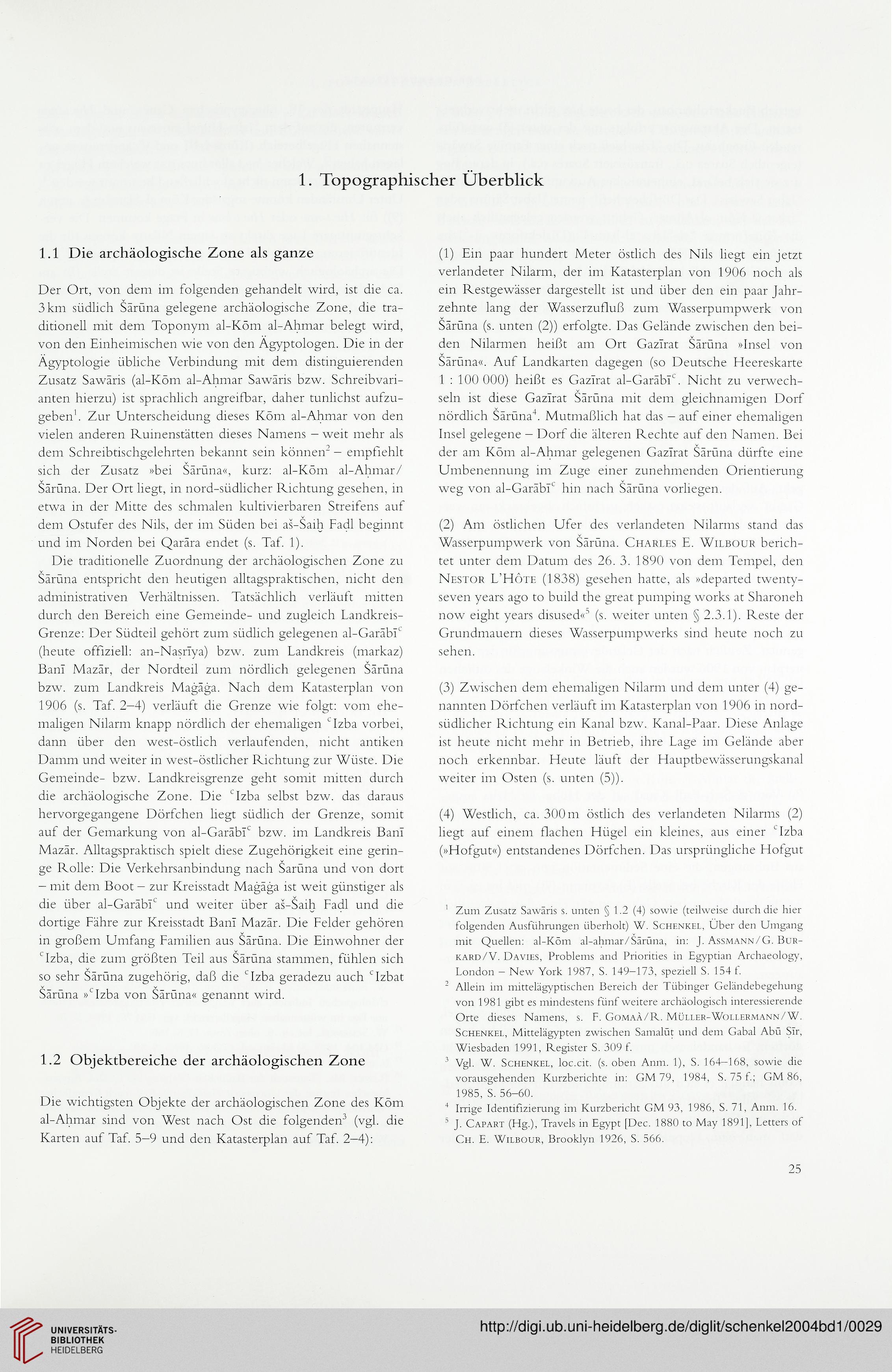1. Topographischer Überblick
1.1 Die archäologische Zone als ganze
Der Ort, von dem im folgenden gehandelt wird, ist die ca.
3 km südlich Särüna gelegene archäologische Zone, die tra-
ditionell mit dem Toponym al-Köm al-Ahmar belegt wird,
von den Einheimischen wie von den Agyptologen. Die in der
Ägyptologie übliche Verbindung mit dem distinguierenden
Zusatz Sawäris (al-Köm al-Ahmar Sawäns bzw. Schreibvari-
anten hierzu) ist sprachlich angreifbar, daher tunlichst aufzu-
geben1. Zur Unterscheidung dieses Köm al-Ahmar von den
vielen anderen Ruinenstätten dieses Namens - weit mehr als
dem Schreibtischgelehrten bekannt sein können2 — empfiehlt
sich der Zusatz »bei Särüna«, kurz: al-Köm al-Ahmar/
Särüna. Der Ort liegt, in nord-südlicher Richtung gesehen, in
etwa in der Mitte des schmalen kultivierbaren Streifens auf
dem Ostufer des Nils, der im Süden bei as-Saih Fadl beginnt
und im Norden bei Qarära endet (s. Tat. 1).
Die traditionelle Zuordnung der archäologischen Zone zu
Särüna entspricht den heutigen alltagspraktischen, nicht den
administrativen Verhältnissen. Tatsächlich verläuft mitten
durch den Bereich eine Gemeinde- und zugleich Landkreis-
Grenze: Der Südteil gehört zum südlich gelegenen al-GaräbiL
(heute offiziell: an-Nasriya) bzw. zum Landkreis (markaz)
Banl Mazär, der Nordteil zum nördlich gelegenen Särüna
bzw. zum Landkreis Magäga. Nach dem Katasterplan von
1906 (s. Taf. 2—1) verläuft die Grenze wie folgt: vom ehe-
maligen Nilarm knapp nördlich der ehemaligen L Izba vorbei,
dann über den west-östlich verlaufenden, nicht antiken
Damm und weiter in west-östlicher Richtung zur Wüste. Die
Gemeinde- bzw. Landkreisgrenze geht somit mitten durch
die archäologische Zone. Die cIzba selbst bzw. das daraus
hervorgegangene Dörfchen Hegt südlich der Grenze, somit
auf der Gemarkung von al-Garäbic bzw. im Landkreis Banl
Mazär. Alltagspraktisch spielt diese Zugehörigkeit eine gerin-
ge Rolle: Die Verkehrsanbindung nach Särüna und von dort
— mit dem Boot — zur Kreisstadt Magäga ist weit günstiger als
die über al-Garäbic und weiter über as-Saih Fadl und die
dortige Fähre zur Kreisstadt Banl Mazär. Die Felder gehören
in großem Umfang Familien aus Särüna. Die Einwohner der
cIzba, die zum größten Teil aus Särüna stammen, fühlen sich
so sehr Särüna zugehörig, daß die LIzba geradezu auch Hzbat
Särüna »Tzba von Särüna« genannt wird.
1.2 Objektbereiche der archäologischen Zone
Die wichtigsten Objekte der archäologischen Zone des Köm
al-Ahmar sind von West nach Ost die folgenden3 (vgl. die
Karten auf Taf. 5-9 und den Katasterplan auf Taf. 2-4):
(1) Em paar hundert Meter östlich des Nils liegt ein jetzt
verlandeter Nilarm, der im Katasterplan von 1906 noch als
ein Restgewässer dargestellt ist und über den ein paar Jahr-
zehnte lang der Wasserzufluß zum Wasserpumpwerk von
Särüna (s. unten (2)) erfolgte. Das Gelände zwischen den bei-
den Nilarmen heißt am Ort Gazlrat Särüna »Insel von
Särüna«. Auf Landkarten dagegen (so Deutsche Heereskarte
1 : 100 000) heißt es Gazlrat al-Garäbic. Nicht zu verwech-
seln ist diese Gazlrat Särüna mit dem gleichnamigen Dorf
nördlich Särüna4. Mutmaßlich hat das — auf einer ehemaligen
Insel gelegene - Dorf die älteren Rechte auf den Namen. Bei
der am Köm al-Ahmar gelegenen Gazlrat Särüna dürfte eine
Umbenennung im Zuge einer zunehmenden Orientierung
weg von al-GaräbIL hm nach Särüna vorliegen.
(2) Am östlichen Ufer des verlandeten Nilarms stand das
Wasserpumpwerk von Särüna. Charles E. Wilbour berich-
tet unter dem Datum des 26. 3. 1890 von dem Tempel, den
Nestor L'HÖTE (1838) gesehen hatte, als »departed twenty-
seven years ago to build the great pumpmg works at Sharoneh
now eight years disused«"1 (s. weiter unten § 2.3.1). Reste der
Grundmauern dieses Wasserpumpwerks sind heute noch zu
sehen.
(3) Zwischen dem ehemaligen Nilarm und dem unter (4) ge-
nannten Dörfchen verläuft im Katasterplan von 1906 in nord-
südlicher Richtung ein Kanal bzw. Kanal-Paar. Diese Anlage
ist heute nicht mehr in Betrieb, ihre Lage im Gelände aber
noch erkennbar. Heute läuft der Hauptbewässerungskanal
weiter im Osten (s. unten (5)).
(4) Westlich, ca. 300 m östlich des verlandeten Nilarms (2)
liegt auf einem flachen Hügel ein kleines, aus einer Hzba
(»Hofgut«) entstandenes Dörfchen. Das ursprüngliche Hofgut
1 Zum Zusatz Sawäns s. unten § 1.2 (4) sowie (teilweise durch die hier
folgenden Ausführungen überholt) W. Schenkel, Über den Umgang
mit Quellen: al-Köm al-ahmar/Särüna, in: J. Assmann/G. Bur-
kard/V. Davies, Problems and Pnorities in Egyptian Archaeology,
London - New York 1987, S. 149-173, speziell S. 154 f.
2 Allem im mittelägyptischen Bereich der Tübinger Geländebegehung
von 1981 gibt es mindestens fünf weitere archäologisch interessierende
Orte dieses Namens, s. F. Gomaä/R. Müller-Wollermann/W.
Schenkel, Mittelägypten zwischen Samalüt und dem Gabal Abü Sir,
Wiesbaden 1991, Register S. 309 f.
3 Vgl. W. Schenkel, loc.cit. (s. oben Anm. 1), S. 164-168, sowie die
vorausgehenden Kurzberichte in: GM 79, 1984, S. 75 f.; GM 86,
1985, S. 56-60.
4 Irrige Identifizierung im Kurzbericht GM 93, 1986, S. 71, Anm. 16.
5 J. Capart (Hg.), Travels in Egypt [Dec. 1880 to May 1891], Letters of
Ch. E. Wilbour, Brooklyn 1926, S. 566.
25
1.1 Die archäologische Zone als ganze
Der Ort, von dem im folgenden gehandelt wird, ist die ca.
3 km südlich Särüna gelegene archäologische Zone, die tra-
ditionell mit dem Toponym al-Köm al-Ahmar belegt wird,
von den Einheimischen wie von den Agyptologen. Die in der
Ägyptologie übliche Verbindung mit dem distinguierenden
Zusatz Sawäris (al-Köm al-Ahmar Sawäns bzw. Schreibvari-
anten hierzu) ist sprachlich angreifbar, daher tunlichst aufzu-
geben1. Zur Unterscheidung dieses Köm al-Ahmar von den
vielen anderen Ruinenstätten dieses Namens - weit mehr als
dem Schreibtischgelehrten bekannt sein können2 — empfiehlt
sich der Zusatz »bei Särüna«, kurz: al-Köm al-Ahmar/
Särüna. Der Ort liegt, in nord-südlicher Richtung gesehen, in
etwa in der Mitte des schmalen kultivierbaren Streifens auf
dem Ostufer des Nils, der im Süden bei as-Saih Fadl beginnt
und im Norden bei Qarära endet (s. Tat. 1).
Die traditionelle Zuordnung der archäologischen Zone zu
Särüna entspricht den heutigen alltagspraktischen, nicht den
administrativen Verhältnissen. Tatsächlich verläuft mitten
durch den Bereich eine Gemeinde- und zugleich Landkreis-
Grenze: Der Südteil gehört zum südlich gelegenen al-GaräbiL
(heute offiziell: an-Nasriya) bzw. zum Landkreis (markaz)
Banl Mazär, der Nordteil zum nördlich gelegenen Särüna
bzw. zum Landkreis Magäga. Nach dem Katasterplan von
1906 (s. Taf. 2—1) verläuft die Grenze wie folgt: vom ehe-
maligen Nilarm knapp nördlich der ehemaligen L Izba vorbei,
dann über den west-östlich verlaufenden, nicht antiken
Damm und weiter in west-östlicher Richtung zur Wüste. Die
Gemeinde- bzw. Landkreisgrenze geht somit mitten durch
die archäologische Zone. Die cIzba selbst bzw. das daraus
hervorgegangene Dörfchen Hegt südlich der Grenze, somit
auf der Gemarkung von al-Garäbic bzw. im Landkreis Banl
Mazär. Alltagspraktisch spielt diese Zugehörigkeit eine gerin-
ge Rolle: Die Verkehrsanbindung nach Särüna und von dort
— mit dem Boot — zur Kreisstadt Magäga ist weit günstiger als
die über al-Garäbic und weiter über as-Saih Fadl und die
dortige Fähre zur Kreisstadt Banl Mazär. Die Felder gehören
in großem Umfang Familien aus Särüna. Die Einwohner der
cIzba, die zum größten Teil aus Särüna stammen, fühlen sich
so sehr Särüna zugehörig, daß die LIzba geradezu auch Hzbat
Särüna »Tzba von Särüna« genannt wird.
1.2 Objektbereiche der archäologischen Zone
Die wichtigsten Objekte der archäologischen Zone des Köm
al-Ahmar sind von West nach Ost die folgenden3 (vgl. die
Karten auf Taf. 5-9 und den Katasterplan auf Taf. 2-4):
(1) Em paar hundert Meter östlich des Nils liegt ein jetzt
verlandeter Nilarm, der im Katasterplan von 1906 noch als
ein Restgewässer dargestellt ist und über den ein paar Jahr-
zehnte lang der Wasserzufluß zum Wasserpumpwerk von
Särüna (s. unten (2)) erfolgte. Das Gelände zwischen den bei-
den Nilarmen heißt am Ort Gazlrat Särüna »Insel von
Särüna«. Auf Landkarten dagegen (so Deutsche Heereskarte
1 : 100 000) heißt es Gazlrat al-Garäbic. Nicht zu verwech-
seln ist diese Gazlrat Särüna mit dem gleichnamigen Dorf
nördlich Särüna4. Mutmaßlich hat das — auf einer ehemaligen
Insel gelegene - Dorf die älteren Rechte auf den Namen. Bei
der am Köm al-Ahmar gelegenen Gazlrat Särüna dürfte eine
Umbenennung im Zuge einer zunehmenden Orientierung
weg von al-GaräbIL hm nach Särüna vorliegen.
(2) Am östlichen Ufer des verlandeten Nilarms stand das
Wasserpumpwerk von Särüna. Charles E. Wilbour berich-
tet unter dem Datum des 26. 3. 1890 von dem Tempel, den
Nestor L'HÖTE (1838) gesehen hatte, als »departed twenty-
seven years ago to build the great pumpmg works at Sharoneh
now eight years disused«"1 (s. weiter unten § 2.3.1). Reste der
Grundmauern dieses Wasserpumpwerks sind heute noch zu
sehen.
(3) Zwischen dem ehemaligen Nilarm und dem unter (4) ge-
nannten Dörfchen verläuft im Katasterplan von 1906 in nord-
südlicher Richtung ein Kanal bzw. Kanal-Paar. Diese Anlage
ist heute nicht mehr in Betrieb, ihre Lage im Gelände aber
noch erkennbar. Heute läuft der Hauptbewässerungskanal
weiter im Osten (s. unten (5)).
(4) Westlich, ca. 300 m östlich des verlandeten Nilarms (2)
liegt auf einem flachen Hügel ein kleines, aus einer Hzba
(»Hofgut«) entstandenes Dörfchen. Das ursprüngliche Hofgut
1 Zum Zusatz Sawäns s. unten § 1.2 (4) sowie (teilweise durch die hier
folgenden Ausführungen überholt) W. Schenkel, Über den Umgang
mit Quellen: al-Köm al-ahmar/Särüna, in: J. Assmann/G. Bur-
kard/V. Davies, Problems and Pnorities in Egyptian Archaeology,
London - New York 1987, S. 149-173, speziell S. 154 f.
2 Allem im mittelägyptischen Bereich der Tübinger Geländebegehung
von 1981 gibt es mindestens fünf weitere archäologisch interessierende
Orte dieses Namens, s. F. Gomaä/R. Müller-Wollermann/W.
Schenkel, Mittelägypten zwischen Samalüt und dem Gabal Abü Sir,
Wiesbaden 1991, Register S. 309 f.
3 Vgl. W. Schenkel, loc.cit. (s. oben Anm. 1), S. 164-168, sowie die
vorausgehenden Kurzberichte in: GM 79, 1984, S. 75 f.; GM 86,
1985, S. 56-60.
4 Irrige Identifizierung im Kurzbericht GM 93, 1986, S. 71, Anm. 16.
5 J. Capart (Hg.), Travels in Egypt [Dec. 1880 to May 1891], Letters of
Ch. E. Wilbour, Brooklyn 1926, S. 566.
25