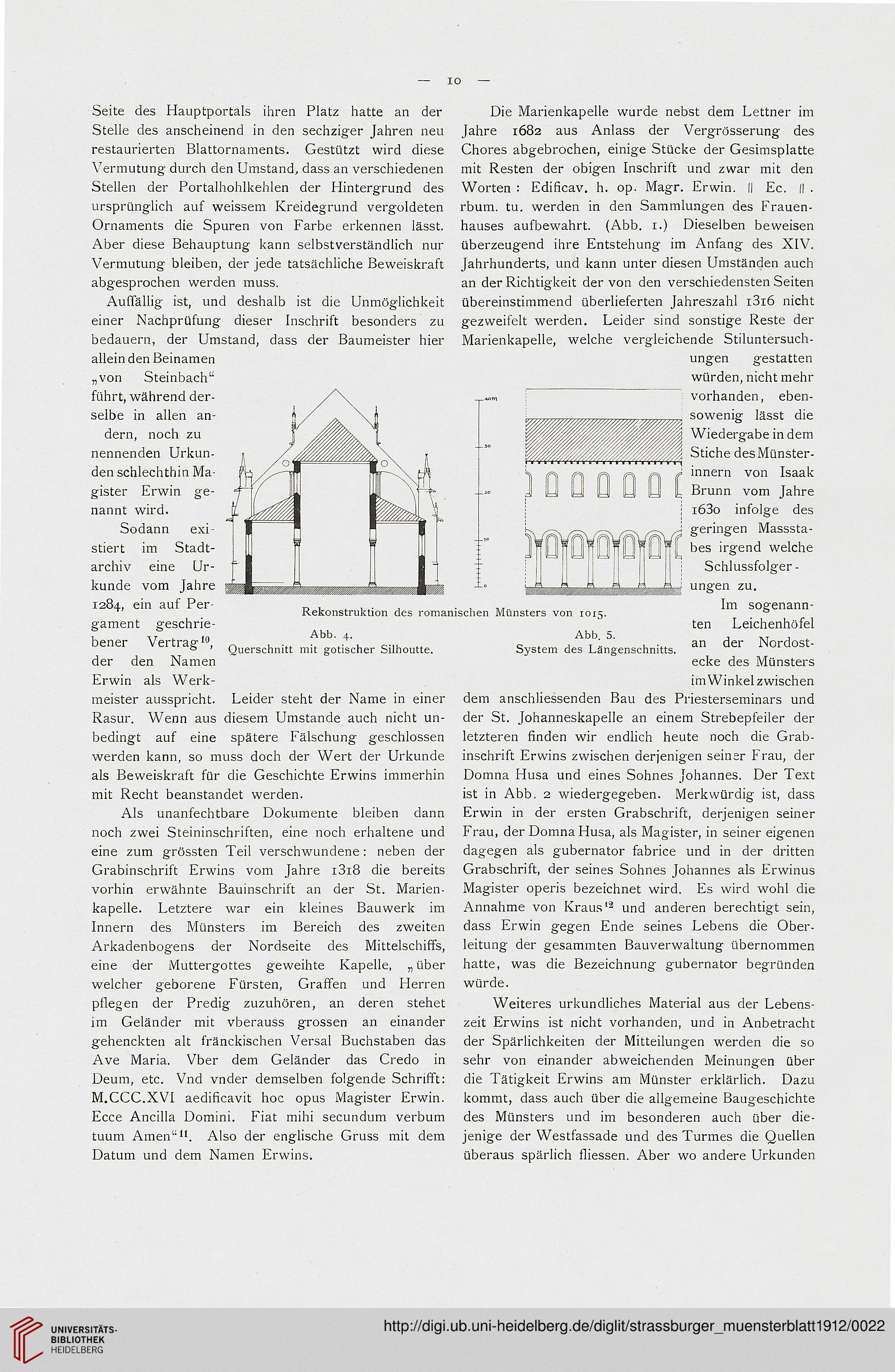IO
Rekonstruktion des romanischen Münsters von io
Seite des Hauptportals ihren Platz hatte an der
Stelle des anscheinend in den sechziger Jahren neu
restaurierten Blattornaments. Gestützt wird diese
Vermutung durch den Umstand, dass an verschiedenen
Stellen der Portalhohlkehlen der Hintergrund des
ursprünglich auf weissem Kreidegrund vergoldeten
Ornaments die Spuren von Farbe erkennen lässt.
Aber diese Behauptung kann selbstverständlich nur
Vermutung bleiben, der jede tatsächliche Beweiskraft
abgesprochen werden muss.
Auffällig ist, und deshalb ist die Unmöglichkeit
einer Nachprüfung dieser Inschrift besonders zu
bedauern, der Umstand, dass der Baumeister hier
allein den Beinamen
„von Steinbach“
führt, während der-
selbe in allen an-
dern, noch zu
nennenden Urkun-
den schlechthin Ma-
gister Erwin ge-
nannt wird.
Sodann exi-
stiert im Stadt-
archiv eine Ur-
kunde vom Jahre
1284, ein auf Per-
gament geschrie-
bener Vertrag10,
der den Namen
Erwin als Werk-
meister ausspricht. Leider steht der Name in einer
Rasur. Wenn aus diesem Umstande auch nicht un-
bedingt auf eine spätere Fälschung geschlossen
werden kann, so muss doch der Wert der Urkunde
als Beweiskraft für die Geschichte Erwins immerhin
mit Recht beanstandet werden.
Als unanfechtbare Dokumente bleiben dann
noch zwei Steininschriften, eine noch erhaltene und
eine zum grössten Teil verschwundene: neben der
Grabinschrift Erwins vom Jahre i3i8 die bereits
vorhin erwähnte Bauinschrift an der St. Marien-
kapelle. Letztere war ein kleines Bauwerk im
Innern des Münsters im Bereich des zweiten
Arkadenbogens der Nordseite des Mittelschiffs,
eine der Muttergottes geweihte Kapelle, „ über
welcher geborene Fürsten, Graffen und Herren
pflegen der Predig zuzuhören, an deren stehet
im Geländer mit vberauss grossen an einander
gehenckten alt fränckischen Versal Buchstaben das
Ave Maria. Vber dem Geländer das Credo in
Deum, etc. Vnd vnder demselben folgende Schrifft:
M.CCC.XVI aedificavit hoc opus Magister Erwin.
Ecce Ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum
tuum Amen“11. Also der englische Gruss mit dem
Datum und dem Namen Erwins.
Abb. 4.
Querschnitt mit gotischer Silhoutte.
Die Marienkapelle wurde nebst dem Lettner im
Jahre 1682 aus Anlass der Vergrösserung des
Chores abgebrochen, einige Stücke der Gesimsplatte
mit Resten der obigen Inschrift und zwar mit den
Worten : Edificav. h. op. Magr. Erwin. II Ec. II .
rbum. tu. werden in den Sammlungen des Frauen-
hauses aufbewahrt. (Abb. 1.) Dieselben beweisen
überzeugend ihre Entstehung im Anfang des XIV.
Jahrhunderts, und kann unter diesen Umständen auch
an der Richtigkeit der von den verschiedensten Seiten
übereinstimmend überlieferten Jahreszahl i3i6 nicht
gezweifelt werden. Leider sind sonstige Reste der
Marienkapelle, welche vergleichende Stiluntersuch-
ungen gestatten
würden, nicht mehr
vorhanden, eben-
, sowenig lässt die
Wiedergabe in dem
Stiche desMünster-
innern von Isaak
Brunn vom Jahre
i63o infolge des
geringen Masssta-
bes irgend welche
Schlussfolger -
ungen zu.
Im sogenann-
ten Leichenhöfel
an der Nordost-
ecke des Münsters
im Winkel zwischen
dem anschliessenden Bau des Priesterseminars und
der St. Johanneskapelle an einem Strebepfeiler der
letzteren finden wir endlich heute noch die Grab-
inschrift Erwins zwischen derjenigen seiner Frau, der
Domna Husa und eines Sohnes Johannes. Der Text
ist in Abb. 2 wiedergegeben. Merkwürdig ist, dass
Erwin in der ersten Grabschrift, derjenigen seiner
Frau, der Domna Husa, als Magister, in seiner eigenen
dagegen als gubernator fabrice und in der dritten
Grabschrift, der seines Sohnes Johannes als Erwinus
Magister operis bezeichnet wird. Es wird wohl die
Annahme von Kraus12 und anderen berechtigt sein,
dass Erwin gegen Ende seines Lebens die Ober-
leitung der gesammten Bauverwaltung übernommen
hatte, was die Bezeichnung gubernator begründen
würde.
Weiteres urkundliches Material aus der Lebens-
zeit Erwins ist nicht vorhanden, und in Anbetracht
der Spärlichkeiten der Mitteilungen werden die so
sehr von einander abweichenden Meinungen über
die Tätigkeit Erwins am Münster erklärlich. Dazu
kommt, dass auch über die allgemeine Baugeschichte
des Münsters und im besonderen auch über die-
jenige der Westfassade und des Turmes die Quellen
überaus spärlich fliessen. Aber wo andere Urkunden
15-
Abb. 5.
System des Längenschnitts.
Rekonstruktion des romanischen Münsters von io
Seite des Hauptportals ihren Platz hatte an der
Stelle des anscheinend in den sechziger Jahren neu
restaurierten Blattornaments. Gestützt wird diese
Vermutung durch den Umstand, dass an verschiedenen
Stellen der Portalhohlkehlen der Hintergrund des
ursprünglich auf weissem Kreidegrund vergoldeten
Ornaments die Spuren von Farbe erkennen lässt.
Aber diese Behauptung kann selbstverständlich nur
Vermutung bleiben, der jede tatsächliche Beweiskraft
abgesprochen werden muss.
Auffällig ist, und deshalb ist die Unmöglichkeit
einer Nachprüfung dieser Inschrift besonders zu
bedauern, der Umstand, dass der Baumeister hier
allein den Beinamen
„von Steinbach“
führt, während der-
selbe in allen an-
dern, noch zu
nennenden Urkun-
den schlechthin Ma-
gister Erwin ge-
nannt wird.
Sodann exi-
stiert im Stadt-
archiv eine Ur-
kunde vom Jahre
1284, ein auf Per-
gament geschrie-
bener Vertrag10,
der den Namen
Erwin als Werk-
meister ausspricht. Leider steht der Name in einer
Rasur. Wenn aus diesem Umstande auch nicht un-
bedingt auf eine spätere Fälschung geschlossen
werden kann, so muss doch der Wert der Urkunde
als Beweiskraft für die Geschichte Erwins immerhin
mit Recht beanstandet werden.
Als unanfechtbare Dokumente bleiben dann
noch zwei Steininschriften, eine noch erhaltene und
eine zum grössten Teil verschwundene: neben der
Grabinschrift Erwins vom Jahre i3i8 die bereits
vorhin erwähnte Bauinschrift an der St. Marien-
kapelle. Letztere war ein kleines Bauwerk im
Innern des Münsters im Bereich des zweiten
Arkadenbogens der Nordseite des Mittelschiffs,
eine der Muttergottes geweihte Kapelle, „ über
welcher geborene Fürsten, Graffen und Herren
pflegen der Predig zuzuhören, an deren stehet
im Geländer mit vberauss grossen an einander
gehenckten alt fränckischen Versal Buchstaben das
Ave Maria. Vber dem Geländer das Credo in
Deum, etc. Vnd vnder demselben folgende Schrifft:
M.CCC.XVI aedificavit hoc opus Magister Erwin.
Ecce Ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum
tuum Amen“11. Also der englische Gruss mit dem
Datum und dem Namen Erwins.
Abb. 4.
Querschnitt mit gotischer Silhoutte.
Die Marienkapelle wurde nebst dem Lettner im
Jahre 1682 aus Anlass der Vergrösserung des
Chores abgebrochen, einige Stücke der Gesimsplatte
mit Resten der obigen Inschrift und zwar mit den
Worten : Edificav. h. op. Magr. Erwin. II Ec. II .
rbum. tu. werden in den Sammlungen des Frauen-
hauses aufbewahrt. (Abb. 1.) Dieselben beweisen
überzeugend ihre Entstehung im Anfang des XIV.
Jahrhunderts, und kann unter diesen Umständen auch
an der Richtigkeit der von den verschiedensten Seiten
übereinstimmend überlieferten Jahreszahl i3i6 nicht
gezweifelt werden. Leider sind sonstige Reste der
Marienkapelle, welche vergleichende Stiluntersuch-
ungen gestatten
würden, nicht mehr
vorhanden, eben-
, sowenig lässt die
Wiedergabe in dem
Stiche desMünster-
innern von Isaak
Brunn vom Jahre
i63o infolge des
geringen Masssta-
bes irgend welche
Schlussfolger -
ungen zu.
Im sogenann-
ten Leichenhöfel
an der Nordost-
ecke des Münsters
im Winkel zwischen
dem anschliessenden Bau des Priesterseminars und
der St. Johanneskapelle an einem Strebepfeiler der
letzteren finden wir endlich heute noch die Grab-
inschrift Erwins zwischen derjenigen seiner Frau, der
Domna Husa und eines Sohnes Johannes. Der Text
ist in Abb. 2 wiedergegeben. Merkwürdig ist, dass
Erwin in der ersten Grabschrift, derjenigen seiner
Frau, der Domna Husa, als Magister, in seiner eigenen
dagegen als gubernator fabrice und in der dritten
Grabschrift, der seines Sohnes Johannes als Erwinus
Magister operis bezeichnet wird. Es wird wohl die
Annahme von Kraus12 und anderen berechtigt sein,
dass Erwin gegen Ende seines Lebens die Ober-
leitung der gesammten Bauverwaltung übernommen
hatte, was die Bezeichnung gubernator begründen
würde.
Weiteres urkundliches Material aus der Lebens-
zeit Erwins ist nicht vorhanden, und in Anbetracht
der Spärlichkeiten der Mitteilungen werden die so
sehr von einander abweichenden Meinungen über
die Tätigkeit Erwins am Münster erklärlich. Dazu
kommt, dass auch über die allgemeine Baugeschichte
des Münsters und im besonderen auch über die-
jenige der Westfassade und des Turmes die Quellen
überaus spärlich fliessen. Aber wo andere Urkunden
15-
Abb. 5.
System des Längenschnitts.