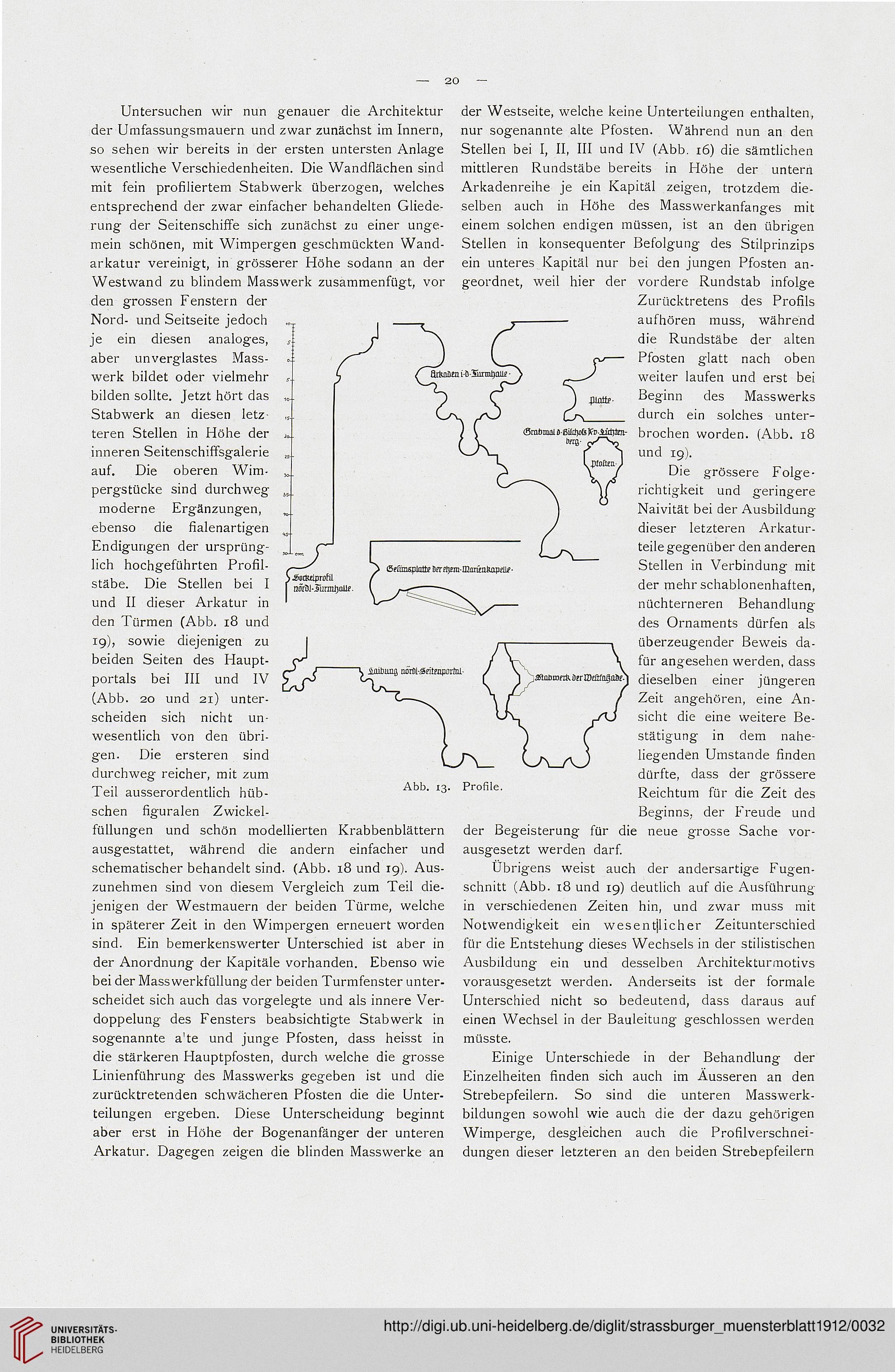20
Untersuchen wir nun genauer die Architektur
der Umfassungsmauern und zwar zunächst im Innern,
so sehen wir bereits in der ersten untersten Anlage
wesentliche Verschiedenheiten. Die Wandflächen sind
mit fein profiliertem Stabwerk überzogen, welches
entsprechend der zwar einfacher behandelten Gliede-
rung der Seitenschiffe sich zunächst zu einer unge-
mein schönen, mit Wimpergen geschmückten Wand-
arkatur vereinigt, in grösserer Höhe sodann an der
Westwand zu blindem Masswerk zusammenfügt, vor
den grossen Fenstern der
Nord- und Seitseite jedoch
je ein diesen analoges,
aber unverglastes Mass-
werk bildet oder vielmehr
bilden sollte. Jetzt hört das
Stabwerk an diesen letz
teren Stellen in Höhe der
inneren Seitenschiffsgalerie
auf. Die oberen Wim-
pergstücke sind durchweg
moderne Ergänzungen,
ebenso die fialenartigen
Endigungen der ursprüng-
lich hochgeführten Profil-
stäbe. Die Stellen bei I
und II dieser Arkatur in
den Türmen (Abb. 18 und
19), sowie diejenigen zu
beiden Seiten des Haupt-
portals bei III und IV
(Abb. 20 und 21) unter-
scheiden sich nicht un-
wesentlich von den übri-
gen. Die ersteren sind
durchweg reicher, mit zum
Teil ausserordentlich hüb-
schen figuralen Zwickel-
füllungen und schön modellierten Krabbenblättern
ausgestattet, während die andern einfacher und
schematischer behandelt sind. (Abb. 18 und 19). Aus-
zunehmen sind von diesem Vergleich zum Teil die-
jenigen der Westmauern der beiden Türme, welche
in späterer Zeit in den Wimpergen erneuert worden
sind. Ein bemerkenswerter Unterschied ist aber in
der Anordnung der Kapitale vorhanden. Ebenso wie
bei der Masswerkfüllung der beiden Turmfenster unter-
scheidet sich auch das vorgelegte und als innere Ver-
doppelung des Fensters beabsichtigte Stab werk in
sogenannte a'te und junge Pfosten, dass heisst in
die stärkeren Hauptpfosten, durch welche die grosse
Linienführung des Masswerks gegeben ist und die
zurücktretenden schwächeren Pfosten die die Unter-
teilungen ergeben. Diese Unterscheidung beginnt
aber erst in Höhe der Bogenanfänger der unteren
Arkatur. Dagegen zeigen die blinden Masswerke an
der Westseite, welche keine Unterteilungen enthalten.,
nur sogenannte alte Pfosten. Während nun an den
Stellen bei I, II, III und IV (Abb. 16) die sämtlichen
mittleren Rundstäbe bereits in Höhe der untern
Arkadenreihe je ein Kapital zeigen, trotzdem die-
selben auch in Höhe des Masswerkanfanges mit
einem solchen endigen müssen, ist an den übrigen
Stellen in konsequenter Befolgung des Stilprinzips
ein unteres Kapital nur bei den jungen Pfosten an-
geordnet, weil hier der vordere Rundstab infolge
Zurücktretens des Profils
aufhören muss, während
die Rundstäbe der alten
Pfosten glatt nach oben
weiter laufen und erst bei
Beginn des Masswerks
durch ein solches unter-
brochen worden. (Abb. 18
und 19).
Die grössere Folge-
richtigkeit und geringere
Naivität bei der Ausbildung
dieser letzteren Arkatur-
teile gegenüber den anderen
Stellen in Verbindung mit
der mehr schablonenhaften,
nüchterneren Behandlung
des Ornaments dürfen als
überzeugender Beweis da-
für angesehen werden, dass
dieselben einer jüngeren
Zeit angehören, eine An-
sicht die eine weitere Be-
stätigung in dem nahe-
liegenden Umstande finden
dürfte, dass der grössere
Reichtum für die Zeit des
Beginns, der Freude und
der Begeisterung für die neue grosse Sache vor-
ausgesetzt werden darf.
Übrigens weist auch der andersartige Fugen-
schnitt (Abb. 18 und 19) deutlich auf die Ausführung
in verschiedenen Zeiten hin, und zwar muss mit
Notwendigkeit ein wesentlicher Zeitunterschied
für die Entstehung dieses Wechsels in der stilistischen
Ausbildung ein und desselben Architekturmotivs
vorausgesetzt werden. Anderseits ist der formale
Unterschied nicht so bedeutend, dass daraus auf
einen Wechsel in der Bauleitung geschlossen werden
müsste.
Einige Unterschiede in der Behandlung der
Einzelheiten finden sich auch im Ausseren an den
Strebepfeilern. So sind die unteren Masswerk-
bildungen sowohl wie auch die der dazu gehörigen
Wimperge, desgleichen auch die Profilverschnei-
dungen dieser letzteren an den beiden Strebepfeilern
Untersuchen wir nun genauer die Architektur
der Umfassungsmauern und zwar zunächst im Innern,
so sehen wir bereits in der ersten untersten Anlage
wesentliche Verschiedenheiten. Die Wandflächen sind
mit fein profiliertem Stabwerk überzogen, welches
entsprechend der zwar einfacher behandelten Gliede-
rung der Seitenschiffe sich zunächst zu einer unge-
mein schönen, mit Wimpergen geschmückten Wand-
arkatur vereinigt, in grösserer Höhe sodann an der
Westwand zu blindem Masswerk zusammenfügt, vor
den grossen Fenstern der
Nord- und Seitseite jedoch
je ein diesen analoges,
aber unverglastes Mass-
werk bildet oder vielmehr
bilden sollte. Jetzt hört das
Stabwerk an diesen letz
teren Stellen in Höhe der
inneren Seitenschiffsgalerie
auf. Die oberen Wim-
pergstücke sind durchweg
moderne Ergänzungen,
ebenso die fialenartigen
Endigungen der ursprüng-
lich hochgeführten Profil-
stäbe. Die Stellen bei I
und II dieser Arkatur in
den Türmen (Abb. 18 und
19), sowie diejenigen zu
beiden Seiten des Haupt-
portals bei III und IV
(Abb. 20 und 21) unter-
scheiden sich nicht un-
wesentlich von den übri-
gen. Die ersteren sind
durchweg reicher, mit zum
Teil ausserordentlich hüb-
schen figuralen Zwickel-
füllungen und schön modellierten Krabbenblättern
ausgestattet, während die andern einfacher und
schematischer behandelt sind. (Abb. 18 und 19). Aus-
zunehmen sind von diesem Vergleich zum Teil die-
jenigen der Westmauern der beiden Türme, welche
in späterer Zeit in den Wimpergen erneuert worden
sind. Ein bemerkenswerter Unterschied ist aber in
der Anordnung der Kapitale vorhanden. Ebenso wie
bei der Masswerkfüllung der beiden Turmfenster unter-
scheidet sich auch das vorgelegte und als innere Ver-
doppelung des Fensters beabsichtigte Stab werk in
sogenannte a'te und junge Pfosten, dass heisst in
die stärkeren Hauptpfosten, durch welche die grosse
Linienführung des Masswerks gegeben ist und die
zurücktretenden schwächeren Pfosten die die Unter-
teilungen ergeben. Diese Unterscheidung beginnt
aber erst in Höhe der Bogenanfänger der unteren
Arkatur. Dagegen zeigen die blinden Masswerke an
der Westseite, welche keine Unterteilungen enthalten.,
nur sogenannte alte Pfosten. Während nun an den
Stellen bei I, II, III und IV (Abb. 16) die sämtlichen
mittleren Rundstäbe bereits in Höhe der untern
Arkadenreihe je ein Kapital zeigen, trotzdem die-
selben auch in Höhe des Masswerkanfanges mit
einem solchen endigen müssen, ist an den übrigen
Stellen in konsequenter Befolgung des Stilprinzips
ein unteres Kapital nur bei den jungen Pfosten an-
geordnet, weil hier der vordere Rundstab infolge
Zurücktretens des Profils
aufhören muss, während
die Rundstäbe der alten
Pfosten glatt nach oben
weiter laufen und erst bei
Beginn des Masswerks
durch ein solches unter-
brochen worden. (Abb. 18
und 19).
Die grössere Folge-
richtigkeit und geringere
Naivität bei der Ausbildung
dieser letzteren Arkatur-
teile gegenüber den anderen
Stellen in Verbindung mit
der mehr schablonenhaften,
nüchterneren Behandlung
des Ornaments dürfen als
überzeugender Beweis da-
für angesehen werden, dass
dieselben einer jüngeren
Zeit angehören, eine An-
sicht die eine weitere Be-
stätigung in dem nahe-
liegenden Umstande finden
dürfte, dass der grössere
Reichtum für die Zeit des
Beginns, der Freude und
der Begeisterung für die neue grosse Sache vor-
ausgesetzt werden darf.
Übrigens weist auch der andersartige Fugen-
schnitt (Abb. 18 und 19) deutlich auf die Ausführung
in verschiedenen Zeiten hin, und zwar muss mit
Notwendigkeit ein wesentlicher Zeitunterschied
für die Entstehung dieses Wechsels in der stilistischen
Ausbildung ein und desselben Architekturmotivs
vorausgesetzt werden. Anderseits ist der formale
Unterschied nicht so bedeutend, dass daraus auf
einen Wechsel in der Bauleitung geschlossen werden
müsste.
Einige Unterschiede in der Behandlung der
Einzelheiten finden sich auch im Ausseren an den
Strebepfeilern. So sind die unteren Masswerk-
bildungen sowohl wie auch die der dazu gehörigen
Wimperge, desgleichen auch die Profilverschnei-
dungen dieser letzteren an den beiden Strebepfeilern