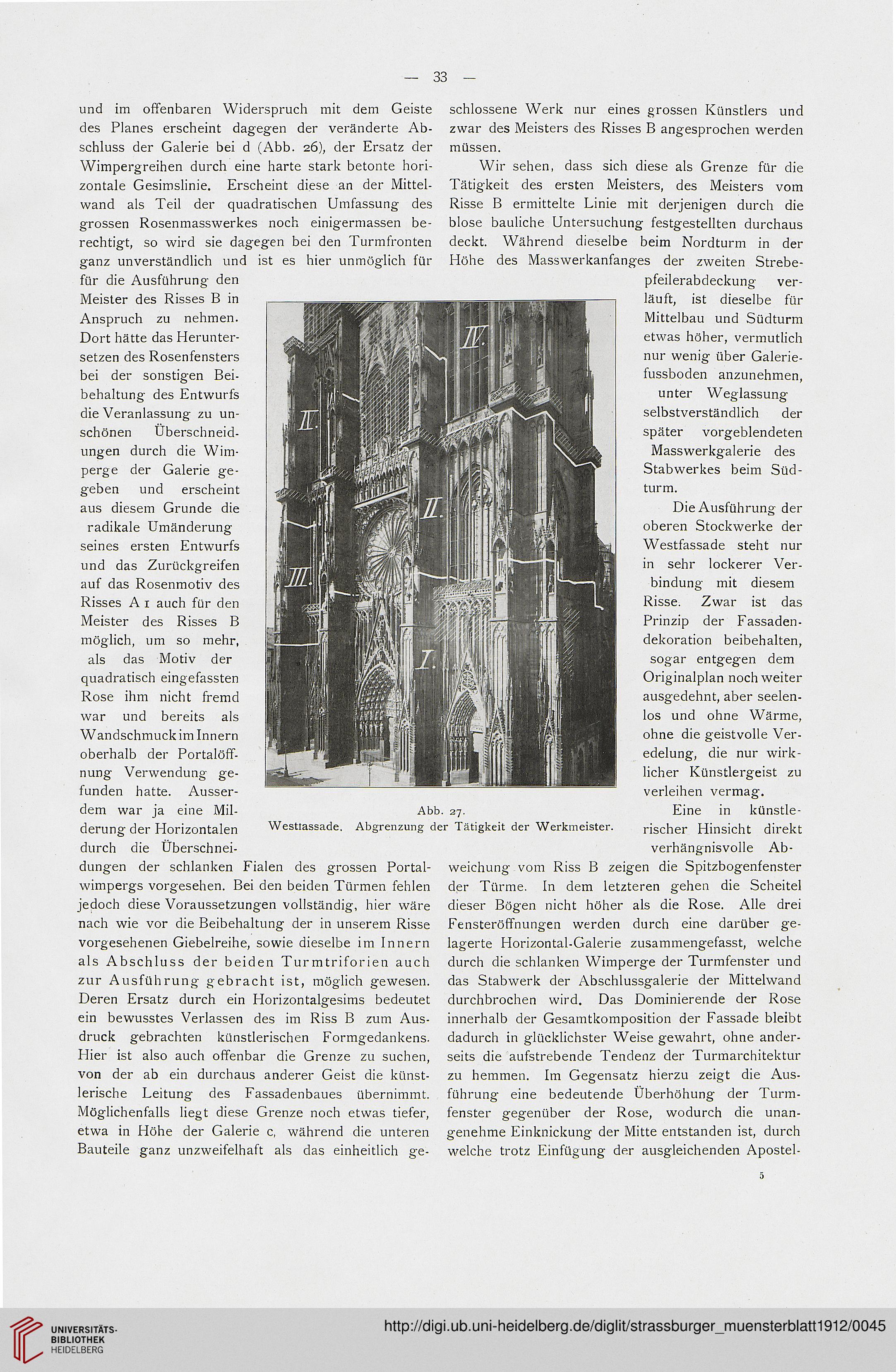33
und im offenbaren Widerspruch mit dem Geiste
des Planes erscheint dagegen der veränderte Ab-
schluss der Galerie bei d (Abb. 26), der Ersatz der
Wimpergreihen durch eine harte stark betonte hori-
zontale Gesimslinie. Erscheint diese an der Mittel-
wand als Teil der quadratischen Umfassung des
grossen Rosenmasswerkes noch einigermassen be-
rechtigt, so wird sie dagegen bei den Turmfronten
ganz unverständlich und ist es hier unmöglich für
für die Ausführung den
Meister des Risses B in
Anspruch zu nehmen.
Dort hätte das Herunter-
setzen des Rosenfensters
bei der sonstigen Bei-
behaltung des Entwurfs
die Veranlassung zu un-
schönen Überschneid-
ungen durch die Wim-
perge der Galerie ge-
geben und erscheint
aus diesem Grunde die
radikale Umänderung
seines ersten Entwurfs
und das Zurückgreifen
auf das Rosenmotiv des
Risses A 1 auch für den
Meister des Risses B
möglich, um so mehr,
als das Motiv der
quadratisch eingefassten
Rose ihm nicht fremd
war und bereits als
Wandschmuck im Innern
oberhalb der Portalöff-
nung Verwendung ge-
funden hatte. Ausser-
dem war ja eine Mil-
derung der Horizontalen
durch die Überschnei-
dungen der schlanken Fialen des grossen Portal-
wimpergs vorgesehen. Bei den beiden Türmen fehlen
jedoch diese Voraussetzungen vollständig, hier wäre
nach wie vor die Beibehaltung der in unserem Risse
vorgesehenen Giebelreihe, sowie dieselbe im Innern
als Abschluss der beiden Turmtriforien auch
zur Ausführung gebracht ist, möglich gewesen.
Deren Ersatz durch ein Horizontalgesims bedeutet
ein bewusstes Verlassen des im Riss B zum Aus-
druck gebrachten künstlerischen Formgedankens.
Hier ist also auch offenbar die Grenze zu suchen,
von der ab ein durchaus anderer Geist die künst-
lerische Leitung des Fassadenbaues übernimmt.
Möglichenfalls liegt diese Grenze noch etwas tiefer,
etwa in Höhe der Galerie c, während die unteren
Bauteile ganz unzweifelhaft als das einheitlich ge-
schlossene Werk nur eines grossen Künstlers und
zwar des Meisters des Risses B angesprochen werden
müssen.
Wir sehen, dass sich diese als Grenze für die
Tätigkeit des ersten Meisters, des Meisters vom
Risse B ermittelte Linie mit derjenigen durch die
blose bauliche Untersuchung festgestellten durchaus
deckt. Während dieselbe beim Nordturm in der
Höhe des Masswerkanfanges der zweiten Strebe-
pfeilerabdeckung ver-
läuft, ist dieselbe für
Mittelbau und Südturm
etwas höher, vermutlich
nur wenig über Galerie-
fussboden anzunehmen,
unter Weglassung
selbstverständlich der
später vorgeblendeten
Masswerkgalerie des
Stabwerkes beim Süd-
turm.
Die Ausführung der
oberen Stockwerke der
Westfassade steht nur
in sehr lockerer Ver-
bindung mit diesem
Risse. Zwar ist das
Prinzip der Fassaden-
dekoration beibehalten,
sogar entgegen dem
Originalplan noch weiter
ausgedehnt, aber seelen-
los und ohne Wärme,
ohne die geistvolle Ver-
edelung, die nur wirk-
licher Künstlergeist zu
verleihen vermag.
Eine in künstle-
rischer Hinsicht direkt
verhängnisvolle Ab-
weichung vom Riss B zeigen die Spitzbogenfenster
der Türme. In dem letzteren gehen die Scheitel
dieser Bögen nicht höher als die Rose. Alle drei
Fensteröffnungen werden durch eine darüber ge-
lagerte Horizontal-Galerie zusammengefasst, welche
durch die schlanken Wimperge der Turmfenster und
das Stabwerk der Abschlussgalerie der Mittelwand
durchbrochen wird. Das Dominierende der Rose
innerhalb der Gesamtkomposition der Fassade bleibt
dadurch in glücklichster Weise gewahrt, ohne ander-
seits die aufstrebende Tendenz der Turmarchitektur
zu hemmen. Im Gegensatz hierzu zeigt die Aus-
führung eine bedeutende Überhöhung der Turm-
fenster gegenüber der Rose, wodurch die unan-
genehme Einknickung der Mitte entstanden ist, durch
welche trotz Einfügung der ausgleichenden Apostel-
Abb. 27.
Westtassade. Abgrenzung der Tätigkeit der Werkmeister.
und im offenbaren Widerspruch mit dem Geiste
des Planes erscheint dagegen der veränderte Ab-
schluss der Galerie bei d (Abb. 26), der Ersatz der
Wimpergreihen durch eine harte stark betonte hori-
zontale Gesimslinie. Erscheint diese an der Mittel-
wand als Teil der quadratischen Umfassung des
grossen Rosenmasswerkes noch einigermassen be-
rechtigt, so wird sie dagegen bei den Turmfronten
ganz unverständlich und ist es hier unmöglich für
für die Ausführung den
Meister des Risses B in
Anspruch zu nehmen.
Dort hätte das Herunter-
setzen des Rosenfensters
bei der sonstigen Bei-
behaltung des Entwurfs
die Veranlassung zu un-
schönen Überschneid-
ungen durch die Wim-
perge der Galerie ge-
geben und erscheint
aus diesem Grunde die
radikale Umänderung
seines ersten Entwurfs
und das Zurückgreifen
auf das Rosenmotiv des
Risses A 1 auch für den
Meister des Risses B
möglich, um so mehr,
als das Motiv der
quadratisch eingefassten
Rose ihm nicht fremd
war und bereits als
Wandschmuck im Innern
oberhalb der Portalöff-
nung Verwendung ge-
funden hatte. Ausser-
dem war ja eine Mil-
derung der Horizontalen
durch die Überschnei-
dungen der schlanken Fialen des grossen Portal-
wimpergs vorgesehen. Bei den beiden Türmen fehlen
jedoch diese Voraussetzungen vollständig, hier wäre
nach wie vor die Beibehaltung der in unserem Risse
vorgesehenen Giebelreihe, sowie dieselbe im Innern
als Abschluss der beiden Turmtriforien auch
zur Ausführung gebracht ist, möglich gewesen.
Deren Ersatz durch ein Horizontalgesims bedeutet
ein bewusstes Verlassen des im Riss B zum Aus-
druck gebrachten künstlerischen Formgedankens.
Hier ist also auch offenbar die Grenze zu suchen,
von der ab ein durchaus anderer Geist die künst-
lerische Leitung des Fassadenbaues übernimmt.
Möglichenfalls liegt diese Grenze noch etwas tiefer,
etwa in Höhe der Galerie c, während die unteren
Bauteile ganz unzweifelhaft als das einheitlich ge-
schlossene Werk nur eines grossen Künstlers und
zwar des Meisters des Risses B angesprochen werden
müssen.
Wir sehen, dass sich diese als Grenze für die
Tätigkeit des ersten Meisters, des Meisters vom
Risse B ermittelte Linie mit derjenigen durch die
blose bauliche Untersuchung festgestellten durchaus
deckt. Während dieselbe beim Nordturm in der
Höhe des Masswerkanfanges der zweiten Strebe-
pfeilerabdeckung ver-
läuft, ist dieselbe für
Mittelbau und Südturm
etwas höher, vermutlich
nur wenig über Galerie-
fussboden anzunehmen,
unter Weglassung
selbstverständlich der
später vorgeblendeten
Masswerkgalerie des
Stabwerkes beim Süd-
turm.
Die Ausführung der
oberen Stockwerke der
Westfassade steht nur
in sehr lockerer Ver-
bindung mit diesem
Risse. Zwar ist das
Prinzip der Fassaden-
dekoration beibehalten,
sogar entgegen dem
Originalplan noch weiter
ausgedehnt, aber seelen-
los und ohne Wärme,
ohne die geistvolle Ver-
edelung, die nur wirk-
licher Künstlergeist zu
verleihen vermag.
Eine in künstle-
rischer Hinsicht direkt
verhängnisvolle Ab-
weichung vom Riss B zeigen die Spitzbogenfenster
der Türme. In dem letzteren gehen die Scheitel
dieser Bögen nicht höher als die Rose. Alle drei
Fensteröffnungen werden durch eine darüber ge-
lagerte Horizontal-Galerie zusammengefasst, welche
durch die schlanken Wimperge der Turmfenster und
das Stabwerk der Abschlussgalerie der Mittelwand
durchbrochen wird. Das Dominierende der Rose
innerhalb der Gesamtkomposition der Fassade bleibt
dadurch in glücklichster Weise gewahrt, ohne ander-
seits die aufstrebende Tendenz der Turmarchitektur
zu hemmen. Im Gegensatz hierzu zeigt die Aus-
führung eine bedeutende Überhöhung der Turm-
fenster gegenüber der Rose, wodurch die unan-
genehme Einknickung der Mitte entstanden ist, durch
welche trotz Einfügung der ausgleichenden Apostel-
Abb. 27.
Westtassade. Abgrenzung der Tätigkeit der Werkmeister.