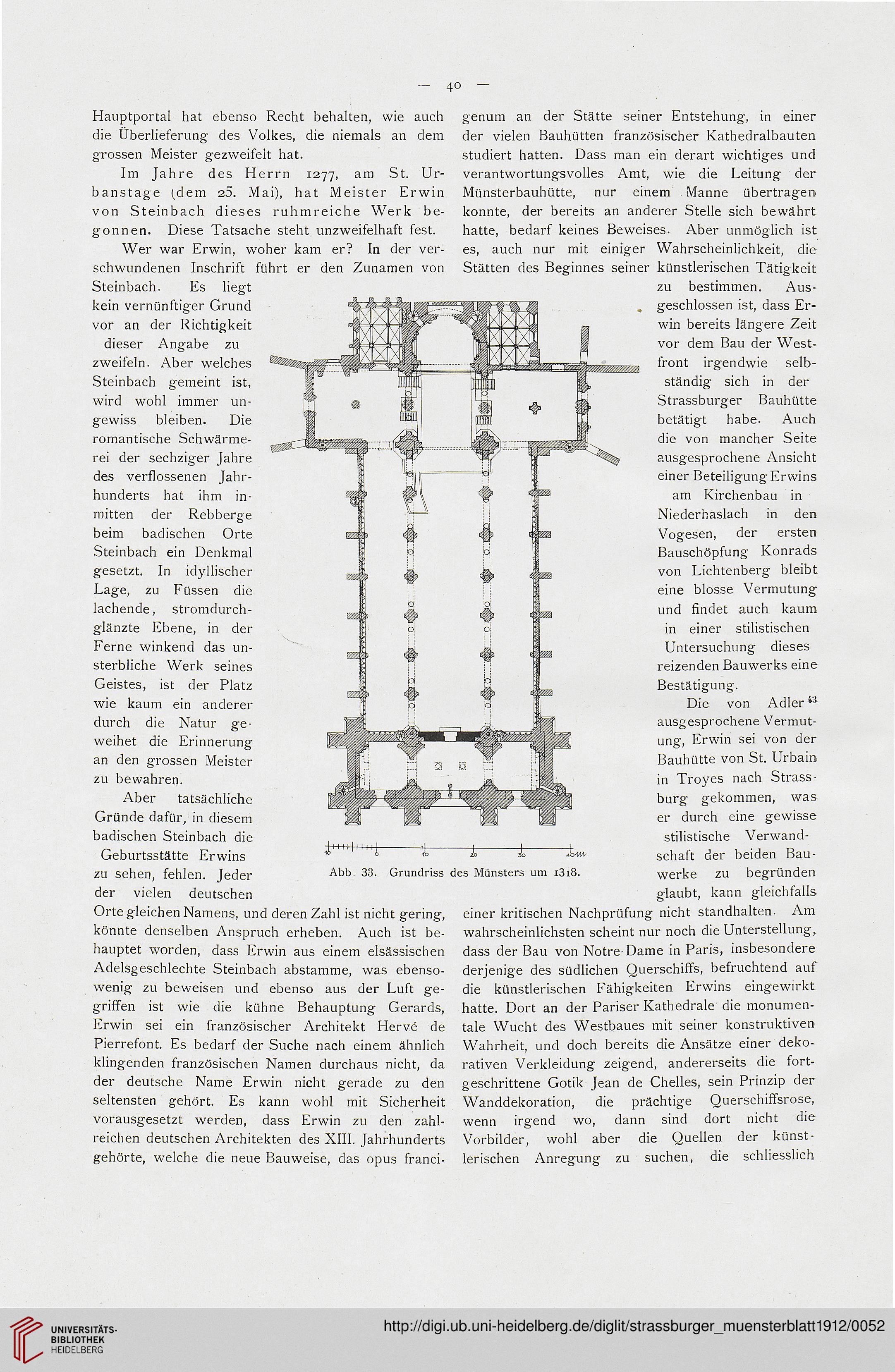4o
Hauptportal hat ebenso Recht behalten, wie auch
die Überlieferung des Volkes, die niemals an dem
grossen Meister gezweifelt hat.
Im Jahre des Herrn 1277, am St. Ur-
banstage ^dem 25. Mai), hat Meister Erwin
von Steinbach dieses ruhmreiche Werk be-
gonnen. Diese Tatsache steht unzweifelhaft fest.
Wer war Erwin, woher kam er? In der ver-
schwundenen Inschrift führt er den Zunamen von
Steinbach. Es liegt
kein vernünftiger Grund
vor an der Richtigkeit
dieser Angabe zu
zweifeln. Aber welches
Steinbach gemeint ist,
wird wohl immer un-
gewiss bleiben. Die
romantische Schwärme-
rei der sechziger Jahre
des verflossenen Jahr-
hunderts hat ihm in-
mitten der Rebberge
beim badischen Orte
Steinbach ein Denkmal
gesetzt. In idyllischer
Lage, zu Füssen die
lachende, stromdurch-
glänzte Ebene, in der
Ferne winkend das un-
sterbliche Werk seines
Geistes, ist der Platz
wie kaum ein anderer
durch die Natur ge-
weihet die Erinnerung
an den grossen Meister
zu bewahren.
Aber tatsächliche
Gründe dafür, in diesem
badischen Steinbach die
Geburtsstätte Erwins
zu sehen, fehlen. Jeder
der vielen deutschen
Orte gleichen Namens, und deren Zahl ist nicht gering,
könnte denselben Anspruch erheben. Auch ist be-
hauptet worden, dass Erwin aus einem elsässischen
Adelsgeschlechte Steinbach abstamme, was ebenso-
wenig zu beweisen und ebenso aus der Luft ge-
griffen ist wie die kühne Behauptung Gerards,
Erwin sei ein französischer Architekt Herve de
Pierrefont. Es bedarf der Suche nach einem ähnlich
klingenden französischen Namen durchaus nicht, da
der deutsche Name Erwin nicht gerade zu den
seltensten gehört. Es kann wohl mit Sicherheit
vorausgesetzt werden, dass Erwin zu den zahl-
reichen deutschen Architekten des XIII. Jahrhunderts
gehörte, welche die neue Bauweise, das opus franci-
Abb. 33. Grundriss des Münsters um i3i8.
genum an der Stätte seiner Entstehung, in einer
der vielen Bauhütten französischer Kathedralbauten
studiert hatten. Dass man ein derart wichtiges und
verantwortungsvolles Amt, wie die Leitung der
Münsterbauhütte, nur einem Manne übertragen
konnte, der bereits an anderer Stelle sich bewährt
hatte, bedarf keines Beweises. Aber unmöglich ist
es, auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit, die
Stätten des Beginnes seiner künstlerischen Tätigkeit
zu bestimmen. Aus-
geschlossen ist, dass Er-
win bereits längere Zeit
vor dem Bau der West-
front irgendwie selb-
ständig sich in der
Strassburger Bauhütte
betätigt habe. Auch
die von mancher Seite
ausgesprochene Ansicht
einer Beteiligung Erwins
am Kirchenbau in
Niederhaslach in den
Vogesen, der ersten
Bauschöpfung Konrads
von Lichtenberg bleibt
eine blosse Vermutung
und findet auch kaum
in einer stilistischen
Untersuchung dieses
reizenden Bauwerks eine
Bestätigung.
Die von Adler4;J
ausgesprochene Vermut-
ung, Erwin sei von der
Bauhütte von St. Urbain
in Troyes nach Strass-
burg gekommen, was
er durch eine gewisse
stilistische Verwand-
schaft der beiden Bau-
werke zu begründen
glaubt, kann gleichfalls
einer kritischen Nachprüfung nicht standhalten. Am
wahrscheinlichsten scheint nur noch die Unterstellung,
dass der Bau von Notre-Dame in Paris, insbesondere
derjenige des südlichen Querschiffs, befruchtend auf
die künstlerischen Fähigkeiten Erwins eingewirkt
hatte. Dort an der Pariser Kathedrale die monumen-
tale Wucht des Westbaues mit seiner konstruktiven
Wahrheit, und doch bereits die Ansätze einer deko-
rativen Verkleidung zeigend, andererseits die fort-
geschrittene Gotik Jean de Chelles, sein Prinzip der
Wanddekoration, die prächtige Querschiffsrose,
wenn irgend wo, dann sind dort nicht die
Vorbilder, wohl aber die Quellen der künst-
lerischen Anregung zu suchen, die schliesslich
ir
Hauptportal hat ebenso Recht behalten, wie auch
die Überlieferung des Volkes, die niemals an dem
grossen Meister gezweifelt hat.
Im Jahre des Herrn 1277, am St. Ur-
banstage ^dem 25. Mai), hat Meister Erwin
von Steinbach dieses ruhmreiche Werk be-
gonnen. Diese Tatsache steht unzweifelhaft fest.
Wer war Erwin, woher kam er? In der ver-
schwundenen Inschrift führt er den Zunamen von
Steinbach. Es liegt
kein vernünftiger Grund
vor an der Richtigkeit
dieser Angabe zu
zweifeln. Aber welches
Steinbach gemeint ist,
wird wohl immer un-
gewiss bleiben. Die
romantische Schwärme-
rei der sechziger Jahre
des verflossenen Jahr-
hunderts hat ihm in-
mitten der Rebberge
beim badischen Orte
Steinbach ein Denkmal
gesetzt. In idyllischer
Lage, zu Füssen die
lachende, stromdurch-
glänzte Ebene, in der
Ferne winkend das un-
sterbliche Werk seines
Geistes, ist der Platz
wie kaum ein anderer
durch die Natur ge-
weihet die Erinnerung
an den grossen Meister
zu bewahren.
Aber tatsächliche
Gründe dafür, in diesem
badischen Steinbach die
Geburtsstätte Erwins
zu sehen, fehlen. Jeder
der vielen deutschen
Orte gleichen Namens, und deren Zahl ist nicht gering,
könnte denselben Anspruch erheben. Auch ist be-
hauptet worden, dass Erwin aus einem elsässischen
Adelsgeschlechte Steinbach abstamme, was ebenso-
wenig zu beweisen und ebenso aus der Luft ge-
griffen ist wie die kühne Behauptung Gerards,
Erwin sei ein französischer Architekt Herve de
Pierrefont. Es bedarf der Suche nach einem ähnlich
klingenden französischen Namen durchaus nicht, da
der deutsche Name Erwin nicht gerade zu den
seltensten gehört. Es kann wohl mit Sicherheit
vorausgesetzt werden, dass Erwin zu den zahl-
reichen deutschen Architekten des XIII. Jahrhunderts
gehörte, welche die neue Bauweise, das opus franci-
Abb. 33. Grundriss des Münsters um i3i8.
genum an der Stätte seiner Entstehung, in einer
der vielen Bauhütten französischer Kathedralbauten
studiert hatten. Dass man ein derart wichtiges und
verantwortungsvolles Amt, wie die Leitung der
Münsterbauhütte, nur einem Manne übertragen
konnte, der bereits an anderer Stelle sich bewährt
hatte, bedarf keines Beweises. Aber unmöglich ist
es, auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit, die
Stätten des Beginnes seiner künstlerischen Tätigkeit
zu bestimmen. Aus-
geschlossen ist, dass Er-
win bereits längere Zeit
vor dem Bau der West-
front irgendwie selb-
ständig sich in der
Strassburger Bauhütte
betätigt habe. Auch
die von mancher Seite
ausgesprochene Ansicht
einer Beteiligung Erwins
am Kirchenbau in
Niederhaslach in den
Vogesen, der ersten
Bauschöpfung Konrads
von Lichtenberg bleibt
eine blosse Vermutung
und findet auch kaum
in einer stilistischen
Untersuchung dieses
reizenden Bauwerks eine
Bestätigung.
Die von Adler4;J
ausgesprochene Vermut-
ung, Erwin sei von der
Bauhütte von St. Urbain
in Troyes nach Strass-
burg gekommen, was
er durch eine gewisse
stilistische Verwand-
schaft der beiden Bau-
werke zu begründen
glaubt, kann gleichfalls
einer kritischen Nachprüfung nicht standhalten. Am
wahrscheinlichsten scheint nur noch die Unterstellung,
dass der Bau von Notre-Dame in Paris, insbesondere
derjenige des südlichen Querschiffs, befruchtend auf
die künstlerischen Fähigkeiten Erwins eingewirkt
hatte. Dort an der Pariser Kathedrale die monumen-
tale Wucht des Westbaues mit seiner konstruktiven
Wahrheit, und doch bereits die Ansätze einer deko-
rativen Verkleidung zeigend, andererseits die fort-
geschrittene Gotik Jean de Chelles, sein Prinzip der
Wanddekoration, die prächtige Querschiffsrose,
wenn irgend wo, dann sind dort nicht die
Vorbilder, wohl aber die Quellen der künst-
lerischen Anregung zu suchen, die schliesslich
ir