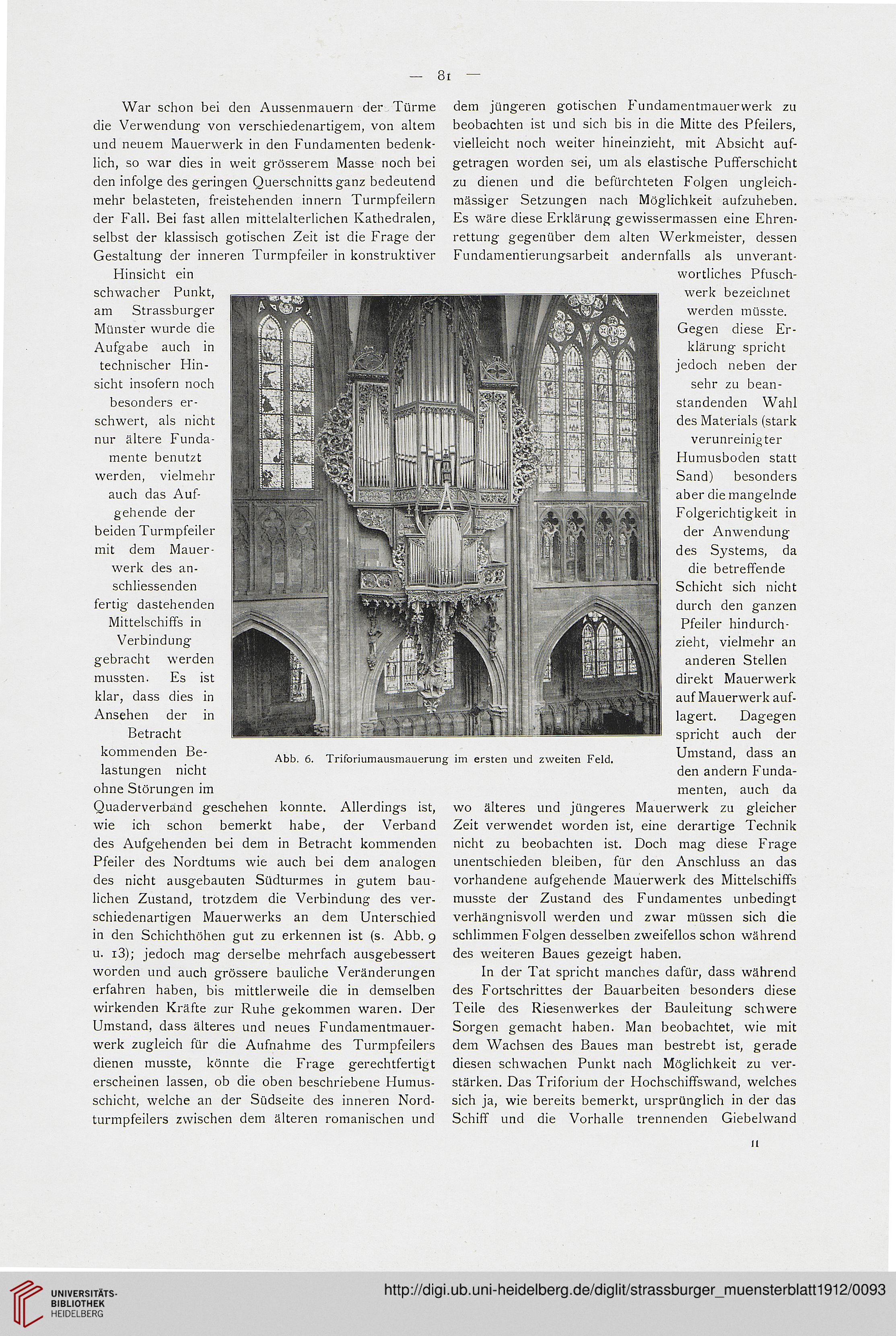Si
War schon bei den Aussenmauern der Türme
die Verwendung von verschiedenartigem, von altem
und neuem Mauerwerk in den Fundamenten bedenk-
lich, so war dies in weit grösserem Masse noch bei
den infolge des geringen Querschnitts ganz bedeutend
mehr belasteten, freistehenden innern Turmpfeilern
der Fall. Bei fast allen mittelalterlichen Kathedralen,
selbst der klassisch gotischen Zeit ist die Frage der
Gestaltung der inneren Turmpfeiler in konstruktiver
Hinsicht ein
schwacher Punkt,
am Strassburger
Münster wurde die
Aufgabe auch in
technischer Hin-
sicht insofern noch
besonders er-
schwert, als nicht
nur ältere Funda-
mente benutzt
werden, vielmehr
auch das Auf-
gehende der
beiden Turmpfeiler
mit dem Mauer -
werk des an-
schliessenden
fertig dastehenden
Mittelschiffs in
Verbindung
gebracht werden
mussten. Es ist
klar, dass dies in
Ansehen der in
Betracht
kommenden Be-
lastungen nicht
ohne Störungen im
Quaderverband geschehen konnte. Allerdings ist,
wie ich schon bemerkt habe, der Verband
des Aufgehenden bei dem in Betracht kommenden
Pfeiler des Nordtums wie auch bei dem analogen
des nicht ausgebauten Südturmes in gutem bau-
lichen Zustand, trotzdem die Verbindung des ver-
schiedenartigen Mauerwerks an dem Unterschied
in den Schichthöhen gut zu erkennen ist (s. Abb. 9
u. i3); jedoch mag derselbe mehrfach ausgebessert
worden und auch grössere bauliche Veränderungen
erfahren haben, bis mittlerweile die in demselben
wirkenden Kräfte zur Ruhe gekommen waren. Der
Umstand, dass älteres und neues Fundamentmauer-
werk zugleich für die Aufnahme des Turmpfeilers
dienen musste, könnte die Frage gerechtfertigt
erscheinen lassen, ob die oben beschriebene Plumus-
schicht, welche an der Südseite des inneren Nord-
turmpfeilers zwischen dem älteren romanischen und
dem jüngeren gotischen Fundamentmauerwerk zu
beobachten ist und sich bis in die Mitte des Pfeilers,
vielleicht noch weiter hineinzieht, mit Absicht auf-
getragen worden sei, um als elastische Pufferschicht
zu dienen und die befürchteten Folgen ungleich-
mässiger Setzungen nach Möglichkeit aufzuheben.
Es wäre diese Erklärung gewissermassen eine Ehren-
rettung gegenüber dem alten Werkmeister, dessen
Fundamentierungsarbeit andernfalls als unverant-
wortliches Pfusch-
werk bezeichnet
werden müsste.
Gegen diese Er-
klärung spricht
jedoch neben der
sehr zu bean-
standenden Wahl
des Materials (stark
verunreinigter
Humusboden statt
Sand) besonders
aber die mangelnde
Folgerichtigkeit in
der Anwendung
des Systems, da
die betreffende
Schicht sich nicht
durch den ganzen
Pfeiler hindurch-
zieht, vielmehr an
anderen Stellen
direkt Mauerwerk
auf Mauerwerk auf-
lagert. Dagegen
spricht auch der
Umstand, dass an
den andern Funda-
menten, auch da
wo älteres und jüngeres Mauerwerk zu gleicher
Zeit verwendet worden ist, eine derartige Technik
nicht zu beobachten ist. Doch mag diese Frage
unentschieden bleiben, für den Anschluss an das
vorhandene aufgehende Mauerwerk des Mittelschiffs
musste der Zustand des Fundamentes unbedingt
verhängnisvoll werden und zwar müssen sich die
schlimmen Folgen desselben zweifellos schon während
des weiteren Baues gezeigt haben.
In der Tat spricht manches dafür, dass während
des Fortschrittes der Bauarbeiten besonders diese
Teile des Riesenwerkes der Bauleitung schwere
Sorgen gemacht haben. Man beobachtet, wie mit
dem Wachsen des Baues man bestrebt ist, gerade
diesen schwachen Punkt nach Möglichkeit zu ver-
stärken. Das Triforium der Hochschiffswand, welches
sich ja, wie bereits bemerkt, ursprünglich in der das
Schiff und die Vorhalle trennenden Giebelwand
Abb. 6. Triforiumausrnauerung im ersten und zweiten Feld.
11
War schon bei den Aussenmauern der Türme
die Verwendung von verschiedenartigem, von altem
und neuem Mauerwerk in den Fundamenten bedenk-
lich, so war dies in weit grösserem Masse noch bei
den infolge des geringen Querschnitts ganz bedeutend
mehr belasteten, freistehenden innern Turmpfeilern
der Fall. Bei fast allen mittelalterlichen Kathedralen,
selbst der klassisch gotischen Zeit ist die Frage der
Gestaltung der inneren Turmpfeiler in konstruktiver
Hinsicht ein
schwacher Punkt,
am Strassburger
Münster wurde die
Aufgabe auch in
technischer Hin-
sicht insofern noch
besonders er-
schwert, als nicht
nur ältere Funda-
mente benutzt
werden, vielmehr
auch das Auf-
gehende der
beiden Turmpfeiler
mit dem Mauer -
werk des an-
schliessenden
fertig dastehenden
Mittelschiffs in
Verbindung
gebracht werden
mussten. Es ist
klar, dass dies in
Ansehen der in
Betracht
kommenden Be-
lastungen nicht
ohne Störungen im
Quaderverband geschehen konnte. Allerdings ist,
wie ich schon bemerkt habe, der Verband
des Aufgehenden bei dem in Betracht kommenden
Pfeiler des Nordtums wie auch bei dem analogen
des nicht ausgebauten Südturmes in gutem bau-
lichen Zustand, trotzdem die Verbindung des ver-
schiedenartigen Mauerwerks an dem Unterschied
in den Schichthöhen gut zu erkennen ist (s. Abb. 9
u. i3); jedoch mag derselbe mehrfach ausgebessert
worden und auch grössere bauliche Veränderungen
erfahren haben, bis mittlerweile die in demselben
wirkenden Kräfte zur Ruhe gekommen waren. Der
Umstand, dass älteres und neues Fundamentmauer-
werk zugleich für die Aufnahme des Turmpfeilers
dienen musste, könnte die Frage gerechtfertigt
erscheinen lassen, ob die oben beschriebene Plumus-
schicht, welche an der Südseite des inneren Nord-
turmpfeilers zwischen dem älteren romanischen und
dem jüngeren gotischen Fundamentmauerwerk zu
beobachten ist und sich bis in die Mitte des Pfeilers,
vielleicht noch weiter hineinzieht, mit Absicht auf-
getragen worden sei, um als elastische Pufferschicht
zu dienen und die befürchteten Folgen ungleich-
mässiger Setzungen nach Möglichkeit aufzuheben.
Es wäre diese Erklärung gewissermassen eine Ehren-
rettung gegenüber dem alten Werkmeister, dessen
Fundamentierungsarbeit andernfalls als unverant-
wortliches Pfusch-
werk bezeichnet
werden müsste.
Gegen diese Er-
klärung spricht
jedoch neben der
sehr zu bean-
standenden Wahl
des Materials (stark
verunreinigter
Humusboden statt
Sand) besonders
aber die mangelnde
Folgerichtigkeit in
der Anwendung
des Systems, da
die betreffende
Schicht sich nicht
durch den ganzen
Pfeiler hindurch-
zieht, vielmehr an
anderen Stellen
direkt Mauerwerk
auf Mauerwerk auf-
lagert. Dagegen
spricht auch der
Umstand, dass an
den andern Funda-
menten, auch da
wo älteres und jüngeres Mauerwerk zu gleicher
Zeit verwendet worden ist, eine derartige Technik
nicht zu beobachten ist. Doch mag diese Frage
unentschieden bleiben, für den Anschluss an das
vorhandene aufgehende Mauerwerk des Mittelschiffs
musste der Zustand des Fundamentes unbedingt
verhängnisvoll werden und zwar müssen sich die
schlimmen Folgen desselben zweifellos schon während
des weiteren Baues gezeigt haben.
In der Tat spricht manches dafür, dass während
des Fortschrittes der Bauarbeiten besonders diese
Teile des Riesenwerkes der Bauleitung schwere
Sorgen gemacht haben. Man beobachtet, wie mit
dem Wachsen des Baues man bestrebt ist, gerade
diesen schwachen Punkt nach Möglichkeit zu ver-
stärken. Das Triforium der Hochschiffswand, welches
sich ja, wie bereits bemerkt, ursprünglich in der das
Schiff und die Vorhalle trennenden Giebelwand
Abb. 6. Triforiumausrnauerung im ersten und zweiten Feld.
11