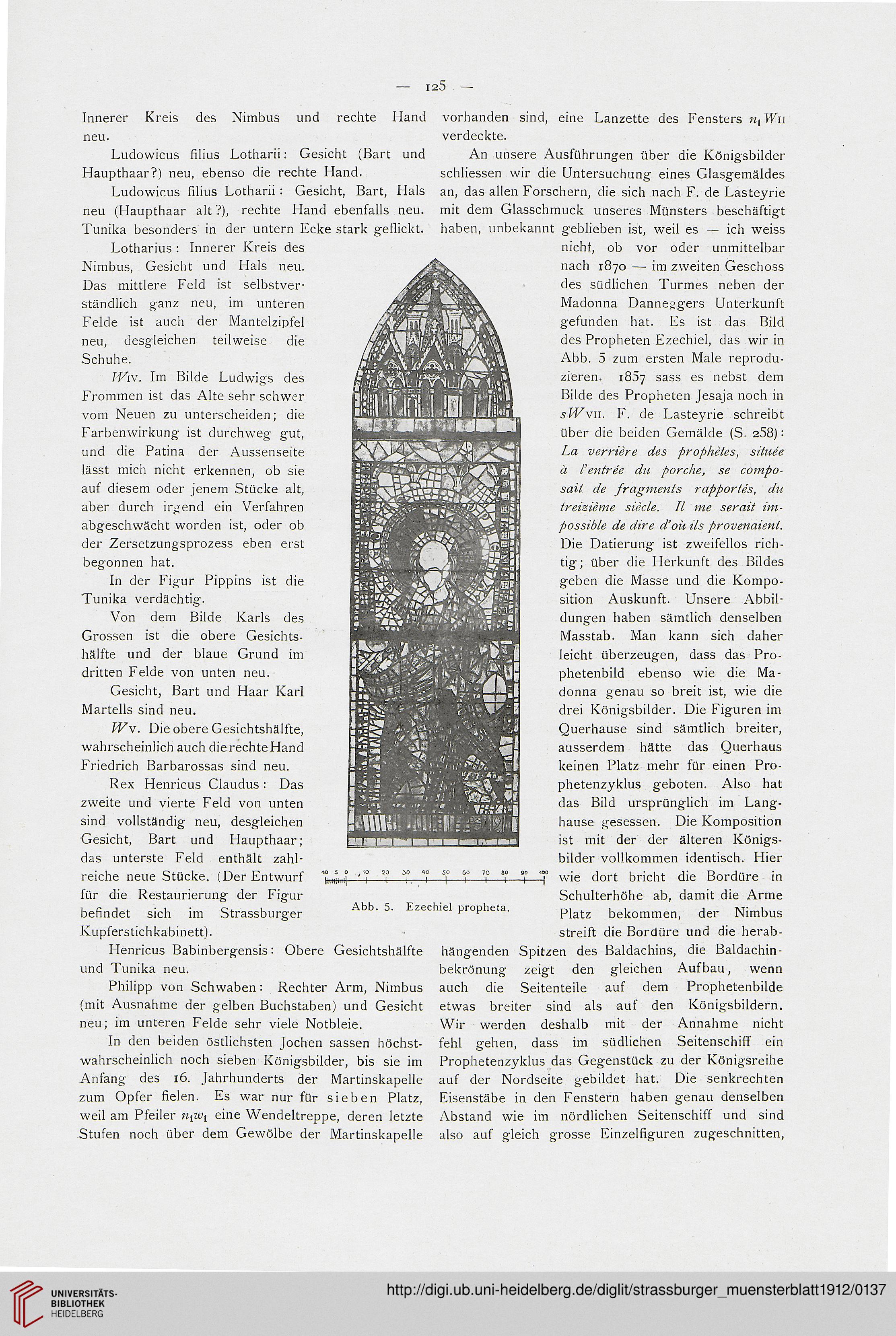— 120 —
Innerer Kreis des Nimbus und rechte Hand
neu.
Ludowicus filius Lotharii: Gesicht (Bart und
Haupthaar?) neu, ebenso die rechte Hand.
Ludowicus filius Lotharii : Gesicht, Bart, Hals
neu (Haupthaar alt ?), rechte Hand ebenfalls neu.
Tunika besonders in der untern Ecke stark geflickt.
Lotharius : Innerer Kreis des
Nimbus, Gesicht und Hals neu.
Das mittlere Feld ist selbstver-
ständlich ganz neu, im unteren
Felde ist auch der Mantelzipfel
neu, desgleichen teilweise die
Schuhe.
TViv. Im Bilde Ludwigs des
Frommen ist das Alte sehr schwer
vom Neuen zu unterscheiden; die
Farben Wirkung ist durchweg gut,
und die Patina der Aussenseite
lässt mich nicht erkennen, ob sie
auf diesem oder jenem Stücke alt,
aber durch irgend ein Verfahren
abgeschwächt worden ist, oder ob
der Zersetzungsprozess eben erst
begonnen hat.
In der Figur Pippins ist die
Tunika verdächtig.
Von dem Bilde Karls des
Grossen ist die obere Gesichts-
hälfte und der blaue Grund im
dritten Felde von unten neu.
Gesicht, Bart und Haar Karl
Martells sind neu.
Wv. Die obere Gesichtshälfte,
wahrscheinlich auch die rechte Hand
Friedrich Barbarossas sind neu.
Rex Henricus Claudus : Das
zweite und vierte Feld von unten
sind vollständig neu, desgleichen
Gesicht, Bart und Haupthaar;
das unterste Feld enthält zahl-
reiche neue Stücke. (Der Entwurf
für die Restaurierung der Figur
befindet sich im Strassburger
Kupferstichkabinett).
Henricus Babinbergensis: Obere Gesichtshälfte
und Tunika neu.
Philipp von Schwaben: Rechter Arm, Nimbus
(mit Ausnahme der gelben Buchstaben) und Gesicht
neu; im unteren Felde sehr viele Notbleie.
In den beiden östlichsten Jochen sassen höchst-
wahrscheinlich noch sieben Königsbilder, bis sie im
Anfang des 16. Jahrhunderts der Martinskapelle
zum Opfer fielen. Es war nur für sieben Platz,
weil am Pfeiler n{wt eine Wendeltreppe, deren letzte
Stufen noch über dem Gewölbe der Martinskapelle
vorhanden sind, eine Lanzette des Fensters Wu
verdeckte.
An unsere Ausführungen über die Königsbilder
schliessen wir die Untersuchung eines Glasgemäldes
an, das allen Forschern, die sich nach F. de Lasteyrie
mit dem Glasschmuck unseres Münsters beschäftigt
haben, unbekannt geblieben ist, weil es — ich weiss
nicht, ob vor oder unmittelbar
nach 1870 — im zweiten Geschoss
des südlichen Turmes neben der
Madonna Danneggers Unterkunft
gefunden hat. Es ist das Bild
des Propheten Ezechiel, das wir in
Abb. 5 zum ersten Male reprodu-
zieren. 1857 sass es nebst dem
Bilde des Propheten Jesaja noch in
slVv 11. F. de Lasteyrie schreibt
über die beiden Gemälde (S. 258):
La verriere des prophetes, situee
ä L’entree dpi porche, se compo-
sail de fragments rapportes, du
treizieme siecle. II me serait im-
possible de dire d’oü ils provenaient.
Die Datierung ist zweifellos rich-
tig; über die Herkunft des Bildes
geben die Masse und die Kompo-
sition Auskunft. Unsere Abbil-
dungen haben sämtlich denselben
Masstab. Man kann sich daher
leicht überzeugen, dass das Pro-
phetenbild ebenso wie die Ma-
donna genau so breit ist, wie die
drei Königsbilder. Die Figuren im
Querhause sind sämtlich breiter,
ausserdem hätte das Querhaus
keinen Platz mehr für einen Pro-
phetenzyklus geboten. Also hat
das Bild ursprünglich im Lang-
hause gesessen. Die Komposition
ist mit der der älteren Königs-
bilder vollkommen identisch. Hier
wie dort bricht die Bordüre in
Schulterhöhe ab, damit die Arme
Platz bekommen, der Nimbus
streift die Bordüre und die herab-
hängenden Spitzen des Baldachins, die Baldachin-
bekrönung zeigt den gleichen Aufbau, wenn
auch die Seitenteile auf dem Prophetenbilde
etwas breiter sind als auf den Königsbildern.
Wir werden deshalb mit der Annahme nicht
fehl gehen, dass im südlichen Seitenschiff ein
Prophetenzyklus das Gegenstück zu der Königsreihe
auf der Nordseite gebildet hat. Die senkrechten
Eisenstäbe in den Fenstern haben genau denselben
Abstand wie im nördlichen Seitenschiff und sind
also auf gleich grosse Einzelfiguren zugeschnitten,
Innerer Kreis des Nimbus und rechte Hand
neu.
Ludowicus filius Lotharii: Gesicht (Bart und
Haupthaar?) neu, ebenso die rechte Hand.
Ludowicus filius Lotharii : Gesicht, Bart, Hals
neu (Haupthaar alt ?), rechte Hand ebenfalls neu.
Tunika besonders in der untern Ecke stark geflickt.
Lotharius : Innerer Kreis des
Nimbus, Gesicht und Hals neu.
Das mittlere Feld ist selbstver-
ständlich ganz neu, im unteren
Felde ist auch der Mantelzipfel
neu, desgleichen teilweise die
Schuhe.
TViv. Im Bilde Ludwigs des
Frommen ist das Alte sehr schwer
vom Neuen zu unterscheiden; die
Farben Wirkung ist durchweg gut,
und die Patina der Aussenseite
lässt mich nicht erkennen, ob sie
auf diesem oder jenem Stücke alt,
aber durch irgend ein Verfahren
abgeschwächt worden ist, oder ob
der Zersetzungsprozess eben erst
begonnen hat.
In der Figur Pippins ist die
Tunika verdächtig.
Von dem Bilde Karls des
Grossen ist die obere Gesichts-
hälfte und der blaue Grund im
dritten Felde von unten neu.
Gesicht, Bart und Haar Karl
Martells sind neu.
Wv. Die obere Gesichtshälfte,
wahrscheinlich auch die rechte Hand
Friedrich Barbarossas sind neu.
Rex Henricus Claudus : Das
zweite und vierte Feld von unten
sind vollständig neu, desgleichen
Gesicht, Bart und Haupthaar;
das unterste Feld enthält zahl-
reiche neue Stücke. (Der Entwurf
für die Restaurierung der Figur
befindet sich im Strassburger
Kupferstichkabinett).
Henricus Babinbergensis: Obere Gesichtshälfte
und Tunika neu.
Philipp von Schwaben: Rechter Arm, Nimbus
(mit Ausnahme der gelben Buchstaben) und Gesicht
neu; im unteren Felde sehr viele Notbleie.
In den beiden östlichsten Jochen sassen höchst-
wahrscheinlich noch sieben Königsbilder, bis sie im
Anfang des 16. Jahrhunderts der Martinskapelle
zum Opfer fielen. Es war nur für sieben Platz,
weil am Pfeiler n{wt eine Wendeltreppe, deren letzte
Stufen noch über dem Gewölbe der Martinskapelle
vorhanden sind, eine Lanzette des Fensters Wu
verdeckte.
An unsere Ausführungen über die Königsbilder
schliessen wir die Untersuchung eines Glasgemäldes
an, das allen Forschern, die sich nach F. de Lasteyrie
mit dem Glasschmuck unseres Münsters beschäftigt
haben, unbekannt geblieben ist, weil es — ich weiss
nicht, ob vor oder unmittelbar
nach 1870 — im zweiten Geschoss
des südlichen Turmes neben der
Madonna Danneggers Unterkunft
gefunden hat. Es ist das Bild
des Propheten Ezechiel, das wir in
Abb. 5 zum ersten Male reprodu-
zieren. 1857 sass es nebst dem
Bilde des Propheten Jesaja noch in
slVv 11. F. de Lasteyrie schreibt
über die beiden Gemälde (S. 258):
La verriere des prophetes, situee
ä L’entree dpi porche, se compo-
sail de fragments rapportes, du
treizieme siecle. II me serait im-
possible de dire d’oü ils provenaient.
Die Datierung ist zweifellos rich-
tig; über die Herkunft des Bildes
geben die Masse und die Kompo-
sition Auskunft. Unsere Abbil-
dungen haben sämtlich denselben
Masstab. Man kann sich daher
leicht überzeugen, dass das Pro-
phetenbild ebenso wie die Ma-
donna genau so breit ist, wie die
drei Königsbilder. Die Figuren im
Querhause sind sämtlich breiter,
ausserdem hätte das Querhaus
keinen Platz mehr für einen Pro-
phetenzyklus geboten. Also hat
das Bild ursprünglich im Lang-
hause gesessen. Die Komposition
ist mit der der älteren Königs-
bilder vollkommen identisch. Hier
wie dort bricht die Bordüre in
Schulterhöhe ab, damit die Arme
Platz bekommen, der Nimbus
streift die Bordüre und die herab-
hängenden Spitzen des Baldachins, die Baldachin-
bekrönung zeigt den gleichen Aufbau, wenn
auch die Seitenteile auf dem Prophetenbilde
etwas breiter sind als auf den Königsbildern.
Wir werden deshalb mit der Annahme nicht
fehl gehen, dass im südlichen Seitenschiff ein
Prophetenzyklus das Gegenstück zu der Königsreihe
auf der Nordseite gebildet hat. Die senkrechten
Eisenstäbe in den Fenstern haben genau denselben
Abstand wie im nördlichen Seitenschiff und sind
also auf gleich grosse Einzelfiguren zugeschnitten,