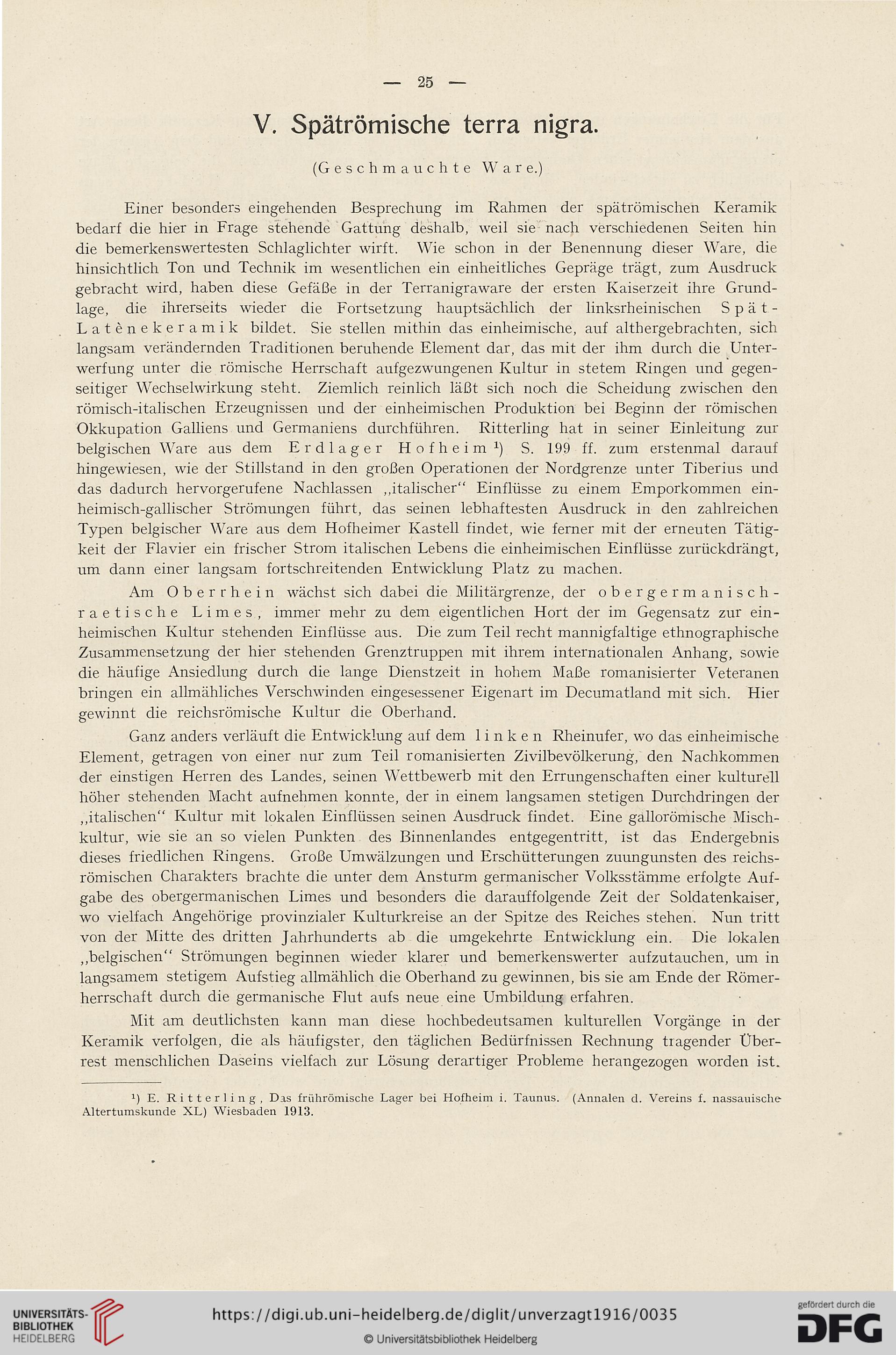25
V. Spätrömische terra nigra.
(Geschmauchte Ware.)
Einer besonders eingehenden Besprechung im Rahmen der spätrömischen Keramik
bedarf die hier in Frage stehende Gattung deshalb, weil sie nach verschiedenen Seiten hin
die bemerkenswertesten Schlaglichter wirft. Wie schon in der Benennung dieser Ware, die
hinsichtlich Ton und Technik im wesentlichen ein einheitliches Gepräge trägt, zum Ausdruck
gebracht wird, haben diese Gefäße in der Terranigraware der ersten Kaiserzeit ihre Grund-
lage, die ihrerseits wieder die Fortsetzung hauptsächlich der linksrheinischen S p ä t -
Latenekeramik bildet. Sie stellen mithin das einheimische, auf althergebrachten, sich
langsam verändernden Traditionen beruhende Element dar, das mit der ihm durch die Unter-
werfung unter die römische Herrschaft aufgezwungenen Kultur in stetem Ringen und gegen-
seitiger Wechselwirkung steht. Ziemlich reinlich läßt sich noch die Scheidung zwischen den
römisch-italischen Erzeugnissen und der einheimischen Produktion bei Beginn der römischen
Okkupation Galliens und Germaniens durchführen. Ritterling hat in seiner Einleitung zur
belgischen Ware aus dem Erdlager Hofheim1) S. 199 ff. zum erstenmal darauf
hingewiesen, wie der Stillstand in den großen Operationen der Nordgrenze unter Tiberius und
das dadurch hervorgerufene Nachlassen „italischer“ Einflüsse zu einem Emporkommen ein-
heimisch-gallischer Strömungen führt, das seinen lebhaftesten Ausdruck in den zahlreichen
Typen belgischer Ware aus dem Hofheimer Kastell findet, wie ferner mit der erneuten Tätig-
keit der Flavier ein frischer Strom italischen Lebens die einheimischen Einflüsse zurückdrängt,
um dann einer langsam fortschreitenden Entwicklung Platz zu machen.
Am Oberrhein wächst sich dabei die Militärgrenze, der obergerm anisch -
raetische Limes, immer mehr zu dem eigentlichen Hort der im Gegensatz zur ein-
heimischen Kultur stehenden Einflüsse aus. Die zum Teil recht mannigfaltige ethnographische
Zusammensetzung der hier stehenden Grenztruppen mit ihrem internationalen Anhang, sowie
die häufige Ansiedlung durch die lange Dienstzeit in hohem Maße romanisierter Veteranen
bringen ein allmähliches Verschwinden eingesessener Eigenart im Decumatland mit sich. Hier
gewinnt die reichsrömische Kultur die Oberhand.
Ganz anders verläuft die Entwicklung auf dem linken Rheinufer, wo das einheimische
Element, getragen von einer nur zum Teil romanisierten Zivilbevölkerung, den Nachkommen
der einstigen Herren des Landes, seinen Wettbewerb mit den Errungenschaften einer kulturell
höher stehenden Macht aufnehmen konnte, der in einem langsamen stetigen Durchdringen der
„italischen“ Kultur mit lokalen Einflüssen seinen Ausdruck findet. Eine gallorömische Misch-
kultur, wie sie an so vielen Punkten des Binnenlandes entgegentritt, ist das Endergebnis
dieses friedlichen Ringens. Große Umwälzungen und Erschütterungen zuungunsten des reichs-
römischen Charakters brachte die unter dem Ansturm germanischer Volksstämme erfolgte Auf-
gabe des obergermanischen Limes und besonders die darauffolgende Zeit der Soldatenkaiser,
wo vielfach Angehörige provinzialer Kulturkreise an der Spitze des Reiches stehen. Nun tritt
von der Mitte des dritten Jahrhunderts ab die umgekehrte Entwicklung ein. Die lokalen
„belgischen“ Strömungen beginnen wieder klarer und bemerkenswerter aufzutauchen, um in
langsamem stetigem Aufstieg allmählich die Oberhand zu gewinnen, bis sie am Ende der Römer-
herrschaft durch die germanische Flut aufs neue eine Umbildung erfahren.
Mit am deutlichsten kann man diese hochbedeutsamen kulturellen Vorgänge in der
Keramik verfolgen, die als häufigster, den täglichen Bedürfnissen Rechnung tragender Über-
rest menschlichen Daseins vielfach zur Lösung derartiger Probleme herangezogen worden ist.
') E. Ritterling, Dis frührömische Lager bei Hofheim i. Taunus. (Annalen d. Vereins f. nassauische
Altertumskunde XL) Wiesbaden 1913.
V. Spätrömische terra nigra.
(Geschmauchte Ware.)
Einer besonders eingehenden Besprechung im Rahmen der spätrömischen Keramik
bedarf die hier in Frage stehende Gattung deshalb, weil sie nach verschiedenen Seiten hin
die bemerkenswertesten Schlaglichter wirft. Wie schon in der Benennung dieser Ware, die
hinsichtlich Ton und Technik im wesentlichen ein einheitliches Gepräge trägt, zum Ausdruck
gebracht wird, haben diese Gefäße in der Terranigraware der ersten Kaiserzeit ihre Grund-
lage, die ihrerseits wieder die Fortsetzung hauptsächlich der linksrheinischen S p ä t -
Latenekeramik bildet. Sie stellen mithin das einheimische, auf althergebrachten, sich
langsam verändernden Traditionen beruhende Element dar, das mit der ihm durch die Unter-
werfung unter die römische Herrschaft aufgezwungenen Kultur in stetem Ringen und gegen-
seitiger Wechselwirkung steht. Ziemlich reinlich läßt sich noch die Scheidung zwischen den
römisch-italischen Erzeugnissen und der einheimischen Produktion bei Beginn der römischen
Okkupation Galliens und Germaniens durchführen. Ritterling hat in seiner Einleitung zur
belgischen Ware aus dem Erdlager Hofheim1) S. 199 ff. zum erstenmal darauf
hingewiesen, wie der Stillstand in den großen Operationen der Nordgrenze unter Tiberius und
das dadurch hervorgerufene Nachlassen „italischer“ Einflüsse zu einem Emporkommen ein-
heimisch-gallischer Strömungen führt, das seinen lebhaftesten Ausdruck in den zahlreichen
Typen belgischer Ware aus dem Hofheimer Kastell findet, wie ferner mit der erneuten Tätig-
keit der Flavier ein frischer Strom italischen Lebens die einheimischen Einflüsse zurückdrängt,
um dann einer langsam fortschreitenden Entwicklung Platz zu machen.
Am Oberrhein wächst sich dabei die Militärgrenze, der obergerm anisch -
raetische Limes, immer mehr zu dem eigentlichen Hort der im Gegensatz zur ein-
heimischen Kultur stehenden Einflüsse aus. Die zum Teil recht mannigfaltige ethnographische
Zusammensetzung der hier stehenden Grenztruppen mit ihrem internationalen Anhang, sowie
die häufige Ansiedlung durch die lange Dienstzeit in hohem Maße romanisierter Veteranen
bringen ein allmähliches Verschwinden eingesessener Eigenart im Decumatland mit sich. Hier
gewinnt die reichsrömische Kultur die Oberhand.
Ganz anders verläuft die Entwicklung auf dem linken Rheinufer, wo das einheimische
Element, getragen von einer nur zum Teil romanisierten Zivilbevölkerung, den Nachkommen
der einstigen Herren des Landes, seinen Wettbewerb mit den Errungenschaften einer kulturell
höher stehenden Macht aufnehmen konnte, der in einem langsamen stetigen Durchdringen der
„italischen“ Kultur mit lokalen Einflüssen seinen Ausdruck findet. Eine gallorömische Misch-
kultur, wie sie an so vielen Punkten des Binnenlandes entgegentritt, ist das Endergebnis
dieses friedlichen Ringens. Große Umwälzungen und Erschütterungen zuungunsten des reichs-
römischen Charakters brachte die unter dem Ansturm germanischer Volksstämme erfolgte Auf-
gabe des obergermanischen Limes und besonders die darauffolgende Zeit der Soldatenkaiser,
wo vielfach Angehörige provinzialer Kulturkreise an der Spitze des Reiches stehen. Nun tritt
von der Mitte des dritten Jahrhunderts ab die umgekehrte Entwicklung ein. Die lokalen
„belgischen“ Strömungen beginnen wieder klarer und bemerkenswerter aufzutauchen, um in
langsamem stetigem Aufstieg allmählich die Oberhand zu gewinnen, bis sie am Ende der Römer-
herrschaft durch die germanische Flut aufs neue eine Umbildung erfahren.
Mit am deutlichsten kann man diese hochbedeutsamen kulturellen Vorgänge in der
Keramik verfolgen, die als häufigster, den täglichen Bedürfnissen Rechnung tragender Über-
rest menschlichen Daseins vielfach zur Lösung derartiger Probleme herangezogen worden ist.
') E. Ritterling, Dis frührömische Lager bei Hofheim i. Taunus. (Annalen d. Vereins f. nassauische
Altertumskunde XL) Wiesbaden 1913.