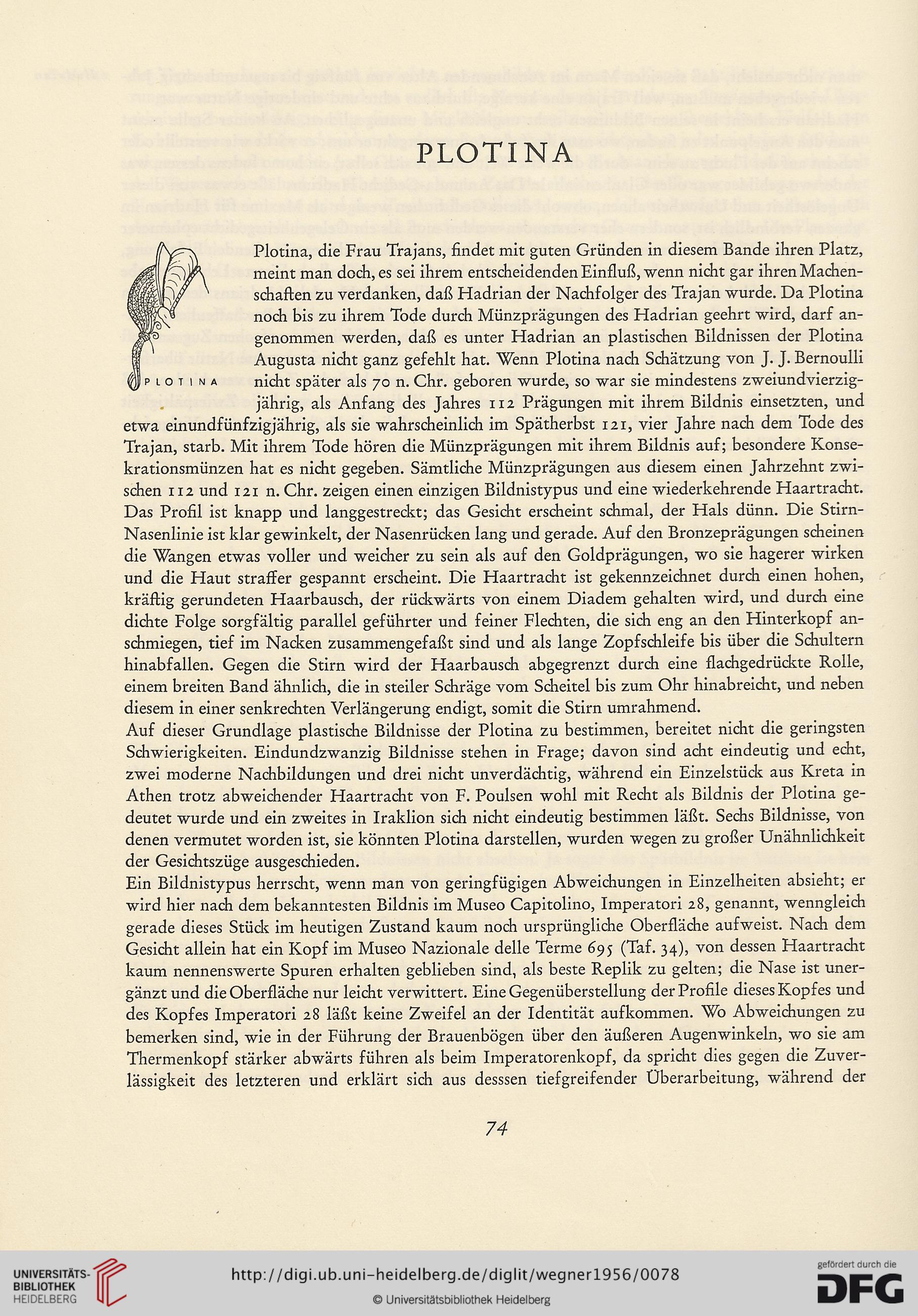PLOTINA
Plotina, die Frau Trajans, findet mit guten Gründen in diesem Bande ihren Platz,
meint man doch, es sei ihrem entscheidenden Einfluß, wenn nicht gar ihren Machen-
schaften zu verdanken, daß Hadrian der Nachfolger des Trajan wurde. Da Plotina
noch bis zu ihrem Tode durch Münzprägungen des Hadrian geehrt wird, darf an-
genommen werden, daß es unter Hadrian an plastischen Bildnissen der Plotina
Augusta nicht ganz gefehlt hat. Wenn Plotina nach Schätzung von J. J. Bernoulli
nicht später als 70 n. Chr. geboren wurde, so war sie mindestens zweiundvierzig-
jährig, als Anfang des Jahres 112 Prägungen mit ihrem Bildnis einsetzten, und
etwa einundfünfzigjährig, als sie wahrscheinlich im Spätherbst 121, vier Jahre nach dem Tode des
Trajan, starb. Mit ihrem Tode hören die Münzprägungen mit ihrem Bildnis auf; besondere Konse-
krationsmünzen hat es nicht gegeben. Sämtliche Münzprägungen aus diesem einen Jahrzehnt zwi-
schen 112 und 121 n. Chr. zeigen einen einzigen Bildnistypus und eine wiederkehrende Haartracht.
Das Profil ist knapp und langgestreckt; das Gesicht erscheint schmal, der Hals dünn. Die Stirn-
Nasenlinie ist klar gewinkelt, der Nasenrücken lang und gerade. Auf den Bronzeprägungen scheinen
die Wangen etwas voller und weicher zu sein als auf den Goldprägungen, wo sie hagerer wirken
und die Haut straffer gespannt erscheint. Die Haartracht ist gekennzeichnet durch einen hohen,
kräftig gerundeten Haarbausch, der rückwärts von einem Diadem gehalten wird, und durch eine
dichte Folge sorgfältig parallel geführter und feiner Flechten, die sich eng an den Hinterkopf an-
schmiegen, tief im Nacken zusammengefaßt sind und als lange Zopfschleife bis über die Schultern
hinabfallen. Gegen die Stirn wird der Haarbausch abgegrenzt durch eine flachgedrückte Rolle,
einem breiten Band ähnlich, die in steiler Schräge vom Scheitel bis zum Ohr hinabreicht, und neben
diesem in einer senkrechten Verlängerung endigt, somit die Stirn umrahmend.
Auf dieser Grundlage plastische Bildnisse der Plotina zu bestimmen, bereitet nicht die geringsten
Schwierigkeiten. Eindundzwanzig Bildnisse stehen in Frage; davon sind acht eindeutig und echt,
zwei moderne Nachbildungen und drei nicht unverdächtig, während ein Einzelstück aus Kreta in
Athen trotz abweichender Haartracht von F. Poulsen wohl mit Recht als Bildnis der Plotina ge-
deutet wurde und ein zweites in Iraklion sich nicht eindeutig bestimmen läßt. Sechs Bildnisse, von
denen vermutet worden ist, sie könnten Plotina darstellen, wurden wegen zu großer Unähnlichkeit
der Gesichtszüge ausgeschieden.
Ein Bildnistypus herrscht, wenn man von geringfügigen Abweichungen in Einzelheiten absieht; er
wird hier nach dem bekanntesten Bildnis im Museo Capitolino, Imperator! 28, genannt, wenngleich
gerade dieses Stück im heutigen Zustand kaum noch ursprüngliche Oberfläche aufweist. Nach dem
Gesicht allein hat ein Kopf im Museo Nazionale delle Terme 695 (Taf. 34), von dessen Haartracht
kaum nennenswerte Spuren erhalten geblieben sind, als beste Replik zu gelten; die Nase ist uner-
gänzt und die Oberfläche nur leicht verwittert. Eine Gegenüberstellung der Profile dieses Kopfes und
des Kopfes Imperatori 28 läßt keine Zweifel an der Identität aufkommen. Wo Abweichungen zu
bemerken sind, wie in der Führung der Brauenbögen über den äußeren Augenwinkeln, wo sie am
Thermenkopf stärker abwärts führen als beim Imperatorenkopf, da spricht dies gegen die Zuver-
lässigkeit des letzteren und erklärt sich aus desssen tiefgreifender Überarbeitung, während der
74
Plotina, die Frau Trajans, findet mit guten Gründen in diesem Bande ihren Platz,
meint man doch, es sei ihrem entscheidenden Einfluß, wenn nicht gar ihren Machen-
schaften zu verdanken, daß Hadrian der Nachfolger des Trajan wurde. Da Plotina
noch bis zu ihrem Tode durch Münzprägungen des Hadrian geehrt wird, darf an-
genommen werden, daß es unter Hadrian an plastischen Bildnissen der Plotina
Augusta nicht ganz gefehlt hat. Wenn Plotina nach Schätzung von J. J. Bernoulli
nicht später als 70 n. Chr. geboren wurde, so war sie mindestens zweiundvierzig-
jährig, als Anfang des Jahres 112 Prägungen mit ihrem Bildnis einsetzten, und
etwa einundfünfzigjährig, als sie wahrscheinlich im Spätherbst 121, vier Jahre nach dem Tode des
Trajan, starb. Mit ihrem Tode hören die Münzprägungen mit ihrem Bildnis auf; besondere Konse-
krationsmünzen hat es nicht gegeben. Sämtliche Münzprägungen aus diesem einen Jahrzehnt zwi-
schen 112 und 121 n. Chr. zeigen einen einzigen Bildnistypus und eine wiederkehrende Haartracht.
Das Profil ist knapp und langgestreckt; das Gesicht erscheint schmal, der Hals dünn. Die Stirn-
Nasenlinie ist klar gewinkelt, der Nasenrücken lang und gerade. Auf den Bronzeprägungen scheinen
die Wangen etwas voller und weicher zu sein als auf den Goldprägungen, wo sie hagerer wirken
und die Haut straffer gespannt erscheint. Die Haartracht ist gekennzeichnet durch einen hohen,
kräftig gerundeten Haarbausch, der rückwärts von einem Diadem gehalten wird, und durch eine
dichte Folge sorgfältig parallel geführter und feiner Flechten, die sich eng an den Hinterkopf an-
schmiegen, tief im Nacken zusammengefaßt sind und als lange Zopfschleife bis über die Schultern
hinabfallen. Gegen die Stirn wird der Haarbausch abgegrenzt durch eine flachgedrückte Rolle,
einem breiten Band ähnlich, die in steiler Schräge vom Scheitel bis zum Ohr hinabreicht, und neben
diesem in einer senkrechten Verlängerung endigt, somit die Stirn umrahmend.
Auf dieser Grundlage plastische Bildnisse der Plotina zu bestimmen, bereitet nicht die geringsten
Schwierigkeiten. Eindundzwanzig Bildnisse stehen in Frage; davon sind acht eindeutig und echt,
zwei moderne Nachbildungen und drei nicht unverdächtig, während ein Einzelstück aus Kreta in
Athen trotz abweichender Haartracht von F. Poulsen wohl mit Recht als Bildnis der Plotina ge-
deutet wurde und ein zweites in Iraklion sich nicht eindeutig bestimmen läßt. Sechs Bildnisse, von
denen vermutet worden ist, sie könnten Plotina darstellen, wurden wegen zu großer Unähnlichkeit
der Gesichtszüge ausgeschieden.
Ein Bildnistypus herrscht, wenn man von geringfügigen Abweichungen in Einzelheiten absieht; er
wird hier nach dem bekanntesten Bildnis im Museo Capitolino, Imperator! 28, genannt, wenngleich
gerade dieses Stück im heutigen Zustand kaum noch ursprüngliche Oberfläche aufweist. Nach dem
Gesicht allein hat ein Kopf im Museo Nazionale delle Terme 695 (Taf. 34), von dessen Haartracht
kaum nennenswerte Spuren erhalten geblieben sind, als beste Replik zu gelten; die Nase ist uner-
gänzt und die Oberfläche nur leicht verwittert. Eine Gegenüberstellung der Profile dieses Kopfes und
des Kopfes Imperatori 28 läßt keine Zweifel an der Identität aufkommen. Wo Abweichungen zu
bemerken sind, wie in der Führung der Brauenbögen über den äußeren Augenwinkeln, wo sie am
Thermenkopf stärker abwärts führen als beim Imperatorenkopf, da spricht dies gegen die Zuver-
lässigkeit des letzteren und erklärt sich aus desssen tiefgreifender Überarbeitung, während der
74