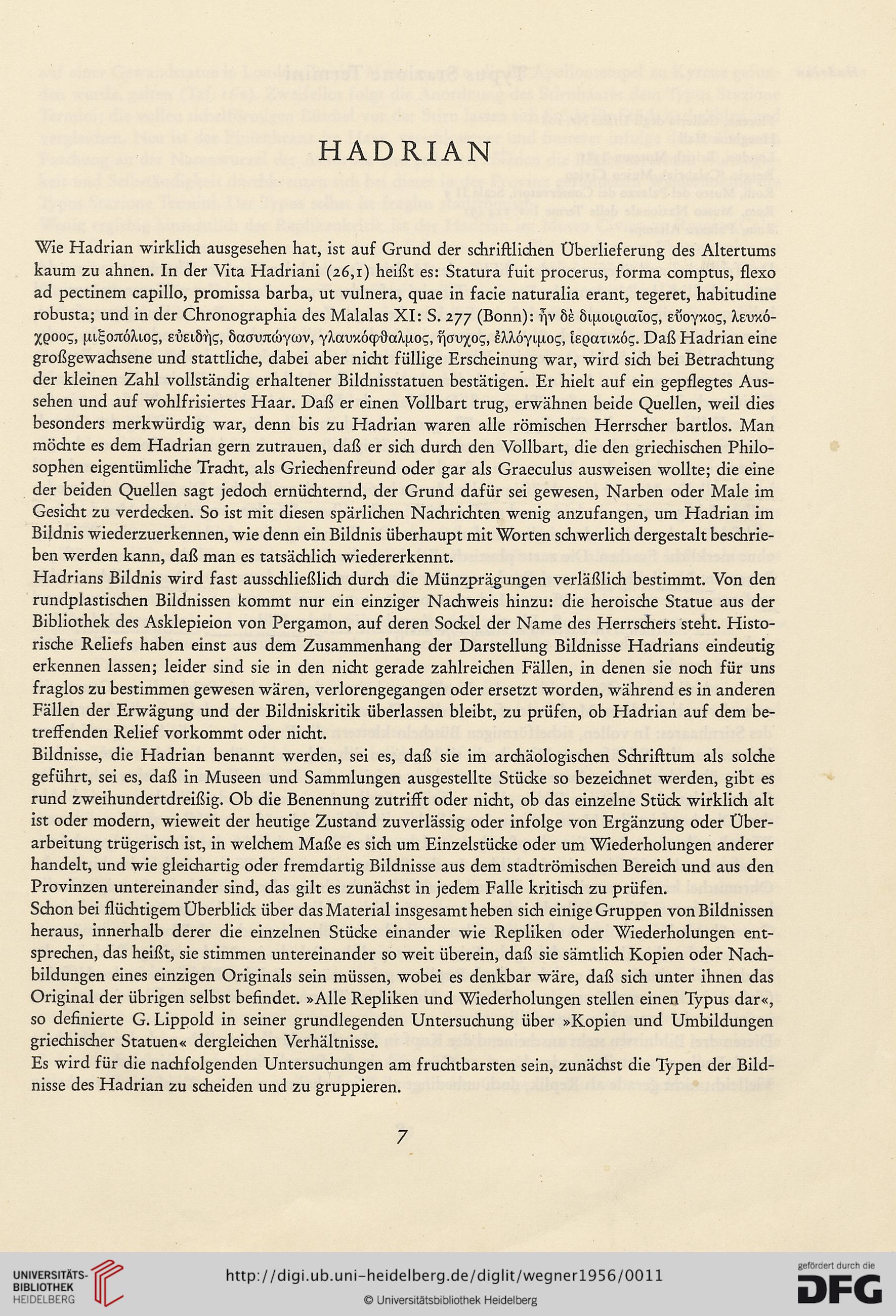HADRIAN
Wie Hadrian wirklich ausgesehen hat, ist auf Grund der schriftlichen Überlieferung des Altertums
kaum zu ahnen. In der Vita Hadriani (26,1) heißt es: Statura fuit procerus, forma comptus, flexo
ad pectinem capillo, promissa barba, ut vulnera, quae in facie naturalia erant, tegeret, habitudine
robusta; und in der Chronographia des Malalas XI: S. 277 (Bonn): f)v öe öqtoipiaiog, evoyxog, Xsuxo-
XQoog, piljojtoXiog, £U£i5f|g, öaaujKÖywv, YXauxocpdaXpog, fjauyog, EiJ.oyipog, lEQatixog. Daß Hadrian eine
großgewachsene und stattliche, dabei aber nicht füllige Erscheinung war, wird sich bei Betrachtung
der kleinen Zahl vollständig erhaltener Bildnisstatuen bestätigen. Er hielt auf ein gepflegtes Aus-
sehen und auf wohlfrisiertes Haar. Daß er einen Vollbart trug, erwähnen beide Quellen, weil dies
besonders merkwürdig war, denn bis zu Hadrian waren alle römischen Herrscher bartlos. Man
möchte es dem Hadrian gern Zutrauen, daß er sich durch den Vollbart, die den griechischen Philo-
sophen eigentümliche Tracht, als Griechenfreund oder gar als Graeculus ausweisen wollte; die eine
der beiden Quellen sagt jedoch ernüchternd, der Grund dafür sei gewesen, Narben oder Male im
Gesicht zu verdecken. So ist mit diesen spärlichen Nachrichten wenig anzufangen, um Hadrian im
Bildnis wiederzuerkennen, wie denn ein Bildnis überhaupt mit Worten schwerlich dergestalt beschrie-
ben werden kann, daß man es tatsächlich wiedererkennt.
Hadrians Bildnis wird fast ausschließlich durch die Münzprägungen verläßlich bestimmt. Von den
rundplastischen Bildnissen kommt nur ein einziger Nachweis hinzu: die heroische Statue aus der
Bibliothek des Asklepieion von Pergamon, auf deren Sockel der Name des Herrschers steht. Histo-
rische Reliefs haben einst aus dem Zusammenhang der Darstellung Bildnisse Hadrians eindeutig
erkennen lassen; leider sind sie in den nicht gerade zahlreichen Fällen, in denen sie noch für uns
fraglos zu bestimmen gewesen wären, verlorengegangen oder ersetzt worden, während es in anderen
Fällen der Erwägung und der Bildniskritik überlassen bleibt, zu prüfen, ob Hadrian auf dem be-
treffenden Relief vorkommt oder nicht.
Bildnisse, die Hadrian benannt werden, sei es, daß sie im archäologischen Schrifttum als solche
geführt, sei es, daß in Museen und Sammlungen ausgestellte Stücke so bezeichnet werden, gibt es
rund zweihundertdreißig. Ob die Benennung zutrifft oder nicht, ob das einzelne Stück wirklich alt
ist oder modern, wieweit der heutige Zustand zuverlässig oder infolge von Ergänzung oder Über-
arbeitung trügerisch ist, in welchem Maße es sich um Einzelstücke oder um Wiederholungen anderer
handelt, und wie gleichartig oder fremdartig Bildnisse aus dem stadtrömischen Bereich und aus den
Provinzen untereinander sind, das gilt es zunächst in jedem Falle kritisch zu prüfen.
Schon bei flüchtigem Überblick über das Material insgesamt heben sich einige Gruppen von Bildnissen
heraus, innerhalb derer die einzelnen Stücke einander wie Repliken oder Wiederholungen ent-
sprechen, das heißt, sie stimmen untereinander so weit überein, daß sie sämtlich Kopien oder Nach-
bildungen eines einzigen Originals sein müssen, wobei es denkbar wäre, daß sich unter ihnen das
Original der übrigen selbst befindet. »Alle Repliken und Wiederholungen stellen einen Typus dar«,
so definierte G. Lippold in seiner grundlegenden Untersuchung über »Kopien und Umbildungen
griechischer Statuen« dergleichen Verhältnisse.
Es wird für die nachfolgenden Untersuchungen am fruchtbarsten sein, zunächst die Typen der Bild-
nisse des Hadrian zu scheiden und zu gruppieren.
7
Wie Hadrian wirklich ausgesehen hat, ist auf Grund der schriftlichen Überlieferung des Altertums
kaum zu ahnen. In der Vita Hadriani (26,1) heißt es: Statura fuit procerus, forma comptus, flexo
ad pectinem capillo, promissa barba, ut vulnera, quae in facie naturalia erant, tegeret, habitudine
robusta; und in der Chronographia des Malalas XI: S. 277 (Bonn): f)v öe öqtoipiaiog, evoyxog, Xsuxo-
XQoog, piljojtoXiog, £U£i5f|g, öaaujKÖywv, YXauxocpdaXpog, fjauyog, EiJ.oyipog, lEQatixog. Daß Hadrian eine
großgewachsene und stattliche, dabei aber nicht füllige Erscheinung war, wird sich bei Betrachtung
der kleinen Zahl vollständig erhaltener Bildnisstatuen bestätigen. Er hielt auf ein gepflegtes Aus-
sehen und auf wohlfrisiertes Haar. Daß er einen Vollbart trug, erwähnen beide Quellen, weil dies
besonders merkwürdig war, denn bis zu Hadrian waren alle römischen Herrscher bartlos. Man
möchte es dem Hadrian gern Zutrauen, daß er sich durch den Vollbart, die den griechischen Philo-
sophen eigentümliche Tracht, als Griechenfreund oder gar als Graeculus ausweisen wollte; die eine
der beiden Quellen sagt jedoch ernüchternd, der Grund dafür sei gewesen, Narben oder Male im
Gesicht zu verdecken. So ist mit diesen spärlichen Nachrichten wenig anzufangen, um Hadrian im
Bildnis wiederzuerkennen, wie denn ein Bildnis überhaupt mit Worten schwerlich dergestalt beschrie-
ben werden kann, daß man es tatsächlich wiedererkennt.
Hadrians Bildnis wird fast ausschließlich durch die Münzprägungen verläßlich bestimmt. Von den
rundplastischen Bildnissen kommt nur ein einziger Nachweis hinzu: die heroische Statue aus der
Bibliothek des Asklepieion von Pergamon, auf deren Sockel der Name des Herrschers steht. Histo-
rische Reliefs haben einst aus dem Zusammenhang der Darstellung Bildnisse Hadrians eindeutig
erkennen lassen; leider sind sie in den nicht gerade zahlreichen Fällen, in denen sie noch für uns
fraglos zu bestimmen gewesen wären, verlorengegangen oder ersetzt worden, während es in anderen
Fällen der Erwägung und der Bildniskritik überlassen bleibt, zu prüfen, ob Hadrian auf dem be-
treffenden Relief vorkommt oder nicht.
Bildnisse, die Hadrian benannt werden, sei es, daß sie im archäologischen Schrifttum als solche
geführt, sei es, daß in Museen und Sammlungen ausgestellte Stücke so bezeichnet werden, gibt es
rund zweihundertdreißig. Ob die Benennung zutrifft oder nicht, ob das einzelne Stück wirklich alt
ist oder modern, wieweit der heutige Zustand zuverlässig oder infolge von Ergänzung oder Über-
arbeitung trügerisch ist, in welchem Maße es sich um Einzelstücke oder um Wiederholungen anderer
handelt, und wie gleichartig oder fremdartig Bildnisse aus dem stadtrömischen Bereich und aus den
Provinzen untereinander sind, das gilt es zunächst in jedem Falle kritisch zu prüfen.
Schon bei flüchtigem Überblick über das Material insgesamt heben sich einige Gruppen von Bildnissen
heraus, innerhalb derer die einzelnen Stücke einander wie Repliken oder Wiederholungen ent-
sprechen, das heißt, sie stimmen untereinander so weit überein, daß sie sämtlich Kopien oder Nach-
bildungen eines einzigen Originals sein müssen, wobei es denkbar wäre, daß sich unter ihnen das
Original der übrigen selbst befindet. »Alle Repliken und Wiederholungen stellen einen Typus dar«,
so definierte G. Lippold in seiner grundlegenden Untersuchung über »Kopien und Umbildungen
griechischer Statuen« dergleichen Verhältnisse.
Es wird für die nachfolgenden Untersuchungen am fruchtbarsten sein, zunächst die Typen der Bild-
nisse des Hadrian zu scheiden und zu gruppieren.
7