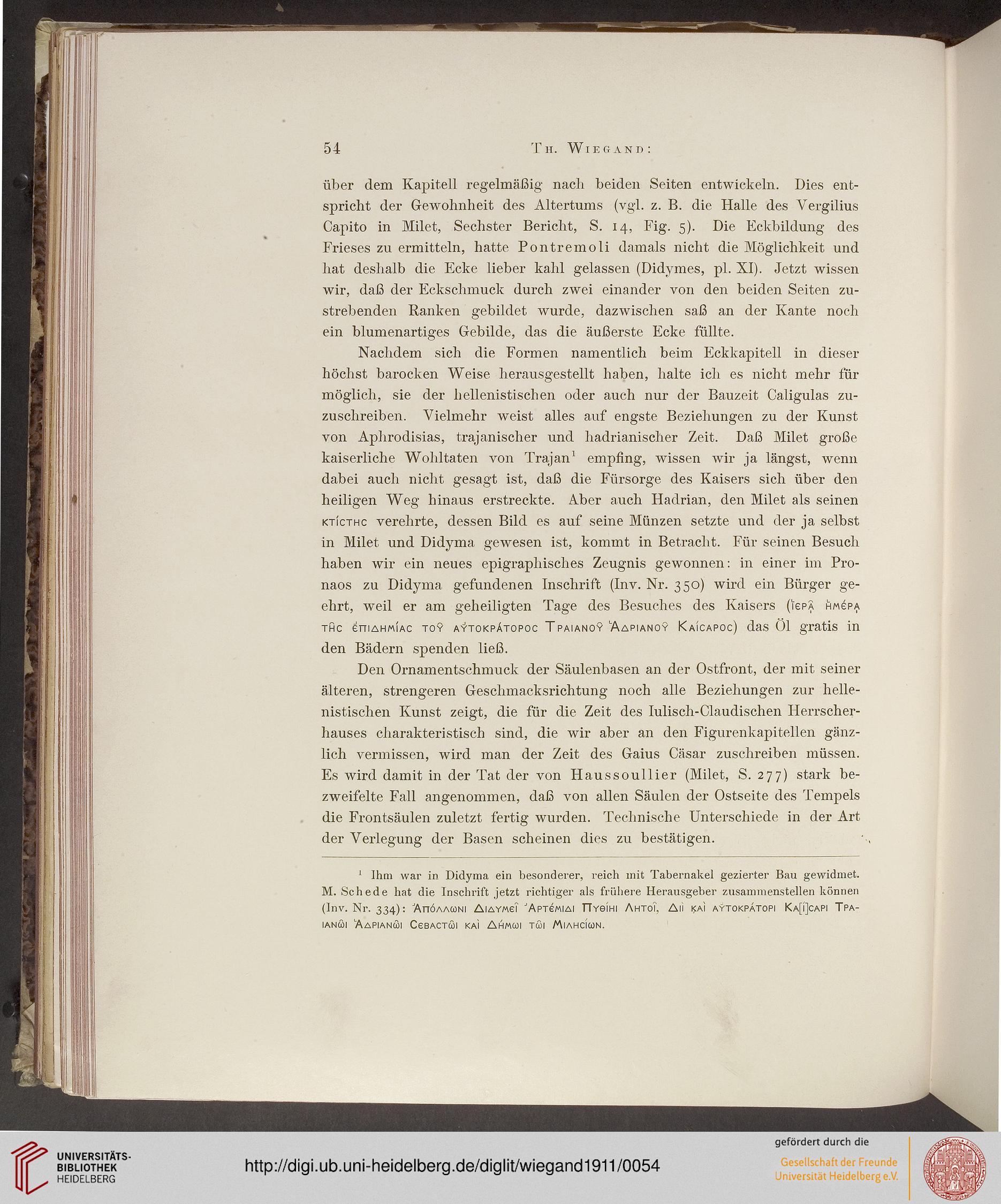54
Tu. Wieg and :
■{4 :
über dem Kapitell regelmäßig nach beiden Seiten entwickeln. Dies ent-
spricht der Gewohnheit des Altertums (vgl. z. B. die Halle des Vergilius
Capito in Milet, Sechster Bericht, S. 14, Fig. 5). Die Eckbildung des
Frieses zu ermitteln, hatte Pontremoli damals nicht die Möglichkeit und
hat deshalb die Ecke lieber kahl gelassen (Didymes, pl. XI). Jetzt wissen
wir, daß der Eckschmuck durch zwei einander von den beiden Seiten zu-
strebenden Ranken gebildet wurde, dazwischen saß an der Kante noch
ein blumenartiges Gebilde, das die äußerste Ecke füllte.
Nachdem sich die Formen namentlich beim Eckkapitell in dieser
höchst barocken Weise herausgestellt haben, halte ich es nicht mehr für
möglich, sie der hellenistischen oder auch nur der Bauzeit Caligulas zu-
zuschreiben. Vielmehr weist alles auf engste Beziehungen zu der Kunst
von Aphrodisias, trajanischer und hadrianischer Zeit. Daß Milet große
kaiserliche Wohltaten von Trajan1 empfing, wissen wir ja längst, wenn
dabei auch nicht gesagt ist, daß die Fürsorge des Kaisers sich über den
heiligen Weg hinaus erstreckte. Aber auch Hadrian, den Milet als seinen
kticthc verehrte, dessen Bild es auf seine Münzen setzte und der ja selbst
in Milet und Didyma gewesen ist, kommt in Betracht. Für seinen Besuch
haben wir ein neues epigraphisches Zeugnis gewonnen: in einer im Pro-
naos zu Didyma gefundenen Inschrift (Inv. Nr. 350) wird ein Bürger ge-
ehrt, weil er am geheiligten Tage des Besuches des Kaisers (ispa hm£pa
thc eniAHMiAc to? aytokpätopoc Tpaiano? "Aapianoy Kaicapoc) das Ol gratis in
den Bädern spenden ließ.
Den Ornamentschmuck der Säulenbasen an der Ostfront, der mit seiner
älteren, strengeren Geschmacksrichtung noch alle Beziehungen zur helle-
nistischen Kunst zeigt, die für die Zeit des Iulisch-Claudischen Herrscher-
hauses charakteristisch sind, die wir aber an den Figurenkapitellen gänz-
lich vermissen, wird man der Zeit des Gaius Cäsar zuschreiben müssen.
Es wird damit in der Tat der von Haussoullier (Milet, S. 277) stark be-
zweifelte Fall angenommen, daß von allen Säulen der Ostseite des Tempels
die Frontsäulen zuletzt fertig wurden. Technische Unterschiede in der Art
der Verlegung der Basen scheinen dies zu bestätigen.
1 Ihm war in Didyma ein besonderer, reich mit Tabernakel gezierter Bau gewidmet.
M. Schede hat die Inschrift jetzt richtiger als frühere Herausgeber zusammenstellen können
(Inv. Nr. 334): "ÄnÖAAWNi AiaymbT jApt6miai TTYeiHi AhtoT, Ali kai aytokpätopi Ka[!]capi Tpa-
IANWI ÄAPIANÖI CeBACTÖl KAI AHMWI TÖI MlAHCICON.
Ar
Tu. Wieg and :
■{4 :
über dem Kapitell regelmäßig nach beiden Seiten entwickeln. Dies ent-
spricht der Gewohnheit des Altertums (vgl. z. B. die Halle des Vergilius
Capito in Milet, Sechster Bericht, S. 14, Fig. 5). Die Eckbildung des
Frieses zu ermitteln, hatte Pontremoli damals nicht die Möglichkeit und
hat deshalb die Ecke lieber kahl gelassen (Didymes, pl. XI). Jetzt wissen
wir, daß der Eckschmuck durch zwei einander von den beiden Seiten zu-
strebenden Ranken gebildet wurde, dazwischen saß an der Kante noch
ein blumenartiges Gebilde, das die äußerste Ecke füllte.
Nachdem sich die Formen namentlich beim Eckkapitell in dieser
höchst barocken Weise herausgestellt haben, halte ich es nicht mehr für
möglich, sie der hellenistischen oder auch nur der Bauzeit Caligulas zu-
zuschreiben. Vielmehr weist alles auf engste Beziehungen zu der Kunst
von Aphrodisias, trajanischer und hadrianischer Zeit. Daß Milet große
kaiserliche Wohltaten von Trajan1 empfing, wissen wir ja längst, wenn
dabei auch nicht gesagt ist, daß die Fürsorge des Kaisers sich über den
heiligen Weg hinaus erstreckte. Aber auch Hadrian, den Milet als seinen
kticthc verehrte, dessen Bild es auf seine Münzen setzte und der ja selbst
in Milet und Didyma gewesen ist, kommt in Betracht. Für seinen Besuch
haben wir ein neues epigraphisches Zeugnis gewonnen: in einer im Pro-
naos zu Didyma gefundenen Inschrift (Inv. Nr. 350) wird ein Bürger ge-
ehrt, weil er am geheiligten Tage des Besuches des Kaisers (ispa hm£pa
thc eniAHMiAc to? aytokpätopoc Tpaiano? "Aapianoy Kaicapoc) das Ol gratis in
den Bädern spenden ließ.
Den Ornamentschmuck der Säulenbasen an der Ostfront, der mit seiner
älteren, strengeren Geschmacksrichtung noch alle Beziehungen zur helle-
nistischen Kunst zeigt, die für die Zeit des Iulisch-Claudischen Herrscher-
hauses charakteristisch sind, die wir aber an den Figurenkapitellen gänz-
lich vermissen, wird man der Zeit des Gaius Cäsar zuschreiben müssen.
Es wird damit in der Tat der von Haussoullier (Milet, S. 277) stark be-
zweifelte Fall angenommen, daß von allen Säulen der Ostseite des Tempels
die Frontsäulen zuletzt fertig wurden. Technische Unterschiede in der Art
der Verlegung der Basen scheinen dies zu bestätigen.
1 Ihm war in Didyma ein besonderer, reich mit Tabernakel gezierter Bau gewidmet.
M. Schede hat die Inschrift jetzt richtiger als frühere Herausgeber zusammenstellen können
(Inv. Nr. 334): "ÄnÖAAWNi AiaymbT jApt6miai TTYeiHi AhtoT, Ali kai aytokpätopi Ka[!]capi Tpa-
IANWI ÄAPIANÖI CeBACTÖl KAI AHMWI TÖI MlAHCICON.
Ar