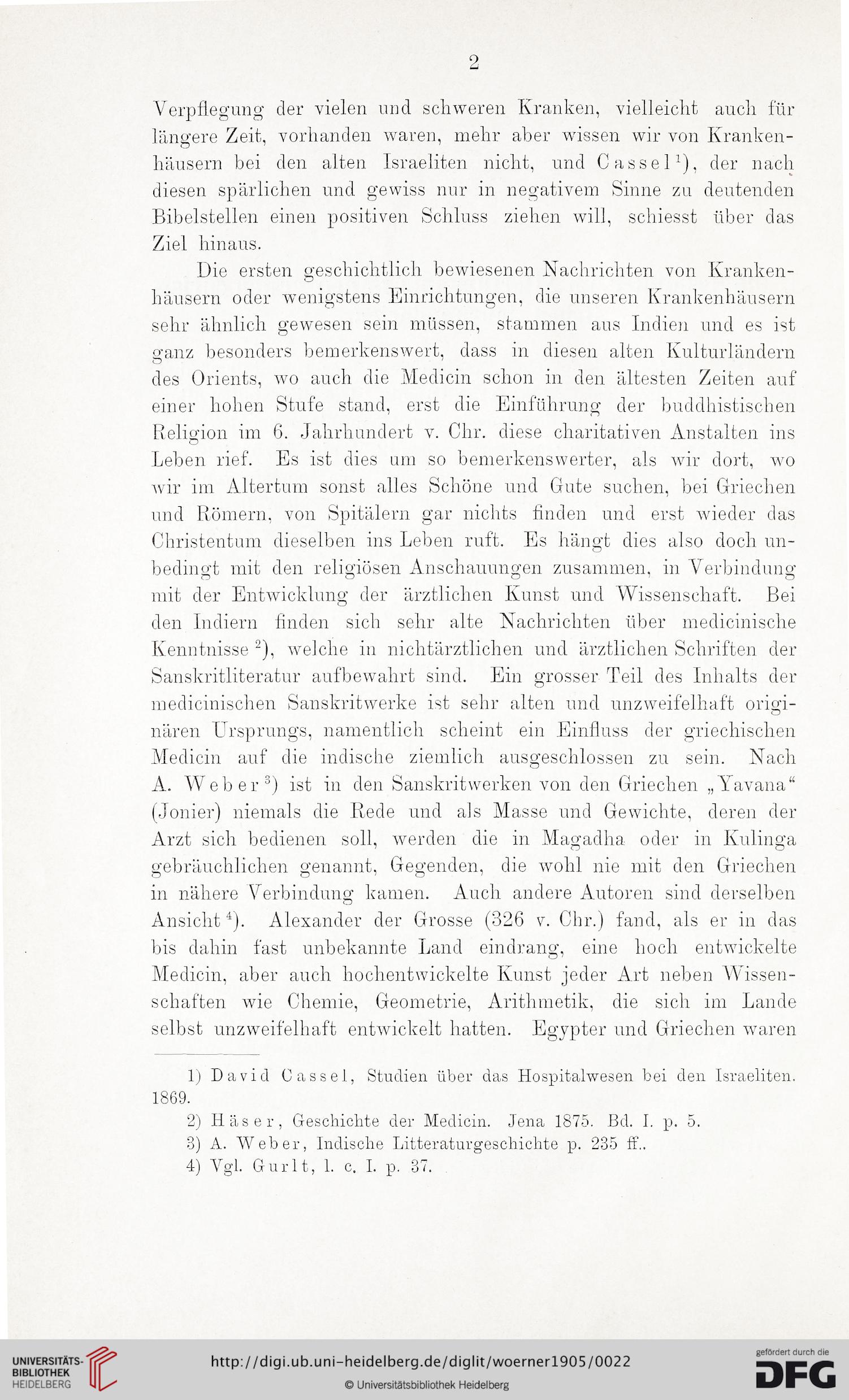2
Yerpflegung der vielen und schweren Kranken, vielleicht aucli für
längere Zeit, vorhanden waren, mehr aber wissen wir von Kranken-
häusern bei den alten Israeliten nicht, und Cassel 1), der nach
diesen spärlichen und gewiss nur in negativem Sinne zu deutenden
Bibelstellen einen positiven Schluss zielren will, schiesst über das
Ziel hinaus.
Die ersten gesclrichtlich bewiesenen Nachrichten von Kranken-
häusern oder wenigstens Einrichtungen, die unseren Krankenhäusern
sehr älmlich gewesen sein müssen, stammen aus Indien und es ist
ganz besonders bemerkenswert, dass in diesen alten Kulturländern
des Orients, wo auch die Medicin schon in den ältesten Zeiten auf
einer hohen Stufe stand, erst die Einführung der buddhistisclren
Religion im 6. Jahrhundert v. Chr. diese charitativen Anstalten ins
Leben rief. Es ist dies um so bemerkenswerter, als wir dort, wo
wir im Altertum sonst alies Schöne und Gute suchen, bei Griechen
und Römern, von Spitälern gar nichts finden und erst wieder das
Christentum dieselben ins Leben ruft. Es hängt dies also docli un-
bedingt mit den religiösen Anschauungen zusammen, in Yerbindung
mit der Entwicklung der ärztlichen Kunst und Wissenschaft. Bei
den Indiern finden sich sehr alte Nachrichten über medicinische
Kenntnisse 2), welche in nichtärztlichen und ärztlichen Schriften der
Sanskritliteratur aufbewahrt sind. Ein grosser Teil des Inhalts der
medicinischen Sanskritwerke ist sehr alten und unzweifelhaft origi-
nären Ursprungs, namentlich scheint ein Einfluss der griechischen
Medicin auf die indische ziemlich ausgeschlossen zu sein. Nach
A. Weber 3) ist in den Sanskritwerken von den Griechen „Yavana“
(Jonier) niemals die Rede und als Masse und Gewichte, deren der
Arzt sich bedienen soll, werden die in Magadha oder in Ivulinga
gebräuchlichen genannt, Gegenden, die wolil nie mit den Griechen
in näliere Yerbindung kamen. Auclr andere Autoren sind derselben
Ansicht 4). Alexander der Grosse (326 v. Chr.) fand, als er in das
bis dahin fast unbekannte Land eindrang, eine hocli entwickelte
Medicin, aber auch hochentwickelte Kunst jeder Art neben Wissen-
schaften wie Chernie, Geometrie, Arithmetik, die sich im Lande
selbst unzweifelhaft entwickelt hatten. Egypter und Griechen waren
1) David Cassel, Studien tiber das Hospitalwesen bei den Israeliten.
1869.
2) Häser, Geschichte der Medicin. Jena 1875. Bd. 1. p. 5.
3) A. Weber, Indische Litteraturgeschichte p. 235 ff..
4) Ygl. Gurlt, 1. c. I. p. 37.
Yerpflegung der vielen und schweren Kranken, vielleicht aucli für
längere Zeit, vorhanden waren, mehr aber wissen wir von Kranken-
häusern bei den alten Israeliten nicht, und Cassel 1), der nach
diesen spärlichen und gewiss nur in negativem Sinne zu deutenden
Bibelstellen einen positiven Schluss zielren will, schiesst über das
Ziel hinaus.
Die ersten gesclrichtlich bewiesenen Nachrichten von Kranken-
häusern oder wenigstens Einrichtungen, die unseren Krankenhäusern
sehr älmlich gewesen sein müssen, stammen aus Indien und es ist
ganz besonders bemerkenswert, dass in diesen alten Kulturländern
des Orients, wo auch die Medicin schon in den ältesten Zeiten auf
einer hohen Stufe stand, erst die Einführung der buddhistisclren
Religion im 6. Jahrhundert v. Chr. diese charitativen Anstalten ins
Leben rief. Es ist dies um so bemerkenswerter, als wir dort, wo
wir im Altertum sonst alies Schöne und Gute suchen, bei Griechen
und Römern, von Spitälern gar nichts finden und erst wieder das
Christentum dieselben ins Leben ruft. Es hängt dies also docli un-
bedingt mit den religiösen Anschauungen zusammen, in Yerbindung
mit der Entwicklung der ärztlichen Kunst und Wissenschaft. Bei
den Indiern finden sich sehr alte Nachrichten über medicinische
Kenntnisse 2), welche in nichtärztlichen und ärztlichen Schriften der
Sanskritliteratur aufbewahrt sind. Ein grosser Teil des Inhalts der
medicinischen Sanskritwerke ist sehr alten und unzweifelhaft origi-
nären Ursprungs, namentlich scheint ein Einfluss der griechischen
Medicin auf die indische ziemlich ausgeschlossen zu sein. Nach
A. Weber 3) ist in den Sanskritwerken von den Griechen „Yavana“
(Jonier) niemals die Rede und als Masse und Gewichte, deren der
Arzt sich bedienen soll, werden die in Magadha oder in Ivulinga
gebräuchlichen genannt, Gegenden, die wolil nie mit den Griechen
in näliere Yerbindung kamen. Auclr andere Autoren sind derselben
Ansicht 4). Alexander der Grosse (326 v. Chr.) fand, als er in das
bis dahin fast unbekannte Land eindrang, eine hocli entwickelte
Medicin, aber auch hochentwickelte Kunst jeder Art neben Wissen-
schaften wie Chernie, Geometrie, Arithmetik, die sich im Lande
selbst unzweifelhaft entwickelt hatten. Egypter und Griechen waren
1) David Cassel, Studien tiber das Hospitalwesen bei den Israeliten.
1869.
2) Häser, Geschichte der Medicin. Jena 1875. Bd. 1. p. 5.
3) A. Weber, Indische Litteraturgeschichte p. 235 ff..
4) Ygl. Gurlt, 1. c. I. p. 37.