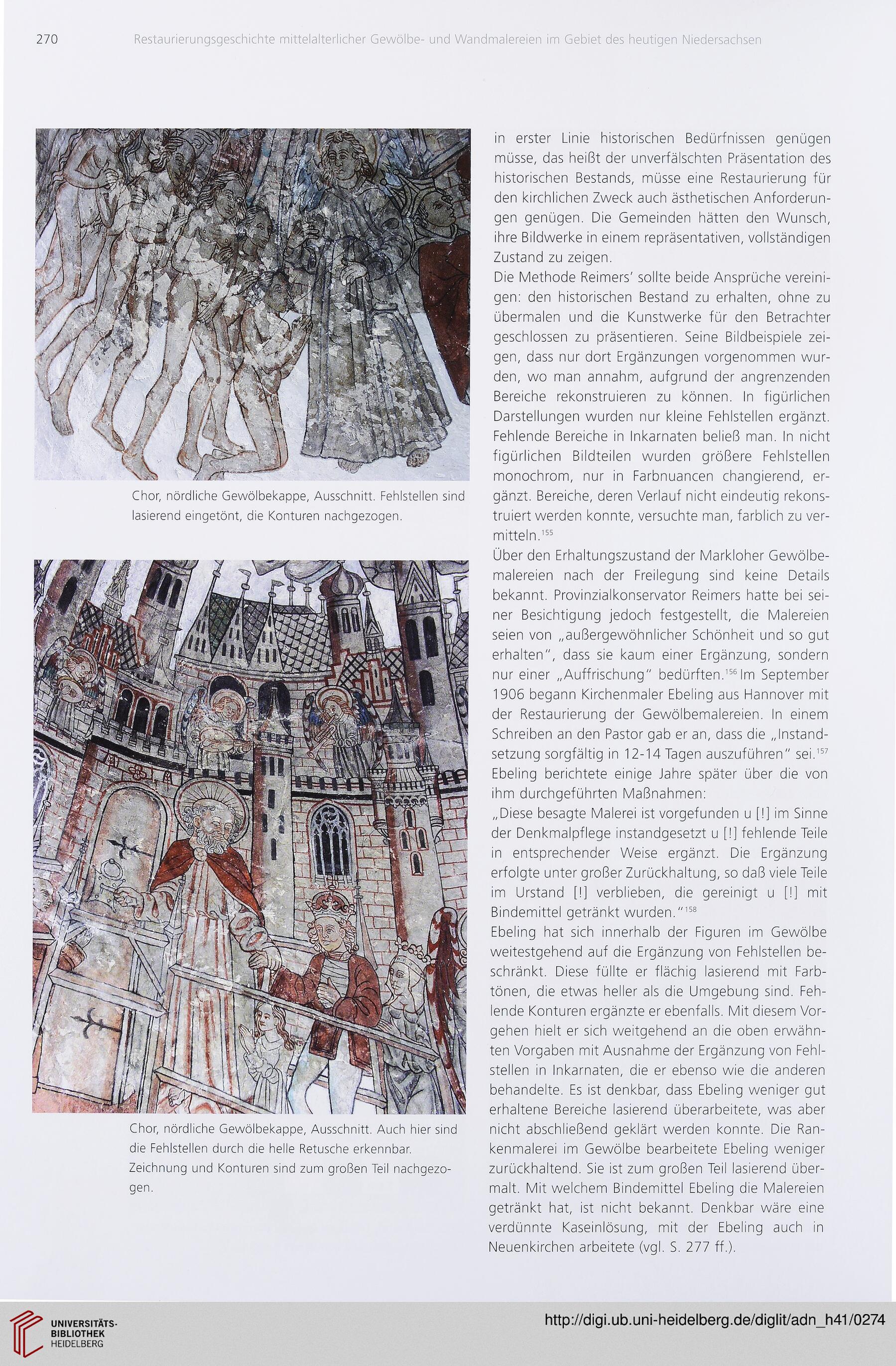270
Restaurierungsgeschichte mittelalterlicher Gewölbe- und Wandmalereien im Gebiet des heutigen Niedersachsen
Chor, nördliche Gewölbekappe, Ausschnitt. Fehlstellen sind
lasierend eingetönt, die Konturen nachgezogen.
Chor, nördliche Gewölbekappe, Ausschnitt. Auch hier sind
die Fehlstellen durch die helle Retusche erkennbar.
Zeichnung und Konturen sind zum großen Teil nachgezo-
gen.
in erster Linie historischen Bedürfnissen genügen
müsse, das heißt der unverfälschten Präsentation des
historischen Bestands, müsse eine Restaurierung für
den kirchlichen Zweck auch ästhetischen Anforderun-
gen genügen. Die Gemeinden hätten den Wunsch,
ihre Bildwerke in einem repräsentativen, vollständigen
Zustand zu zeigen.
Die Methode Reimers' sollte beide Ansprüche vereini-
gen: den historischen Bestand zu erhalten, ohne zu
übermalen und die Kunstwerke für den Betrachter
geschlossen zu präsentieren. Seine Bildbeispiele zei-
gen, dass nur dort Ergänzungen vorgenommen wur-
den, wo man annahm, aufgrund der angrenzenden
Bereiche rekonstruieren zu können. In figürlichen
Darstellungen wurden nur kleine Fehlstellen ergänzt.
Fehlende Bereiche in Inkarnaten beließ man. In nicht
figürlichen Bildteilen wurden größere Fehlstellen
monochrom, nur in Farbnuancen changierend, er-
gänzt. Bereiche, deren Verlauf nicht eindeutig rekons-
truiert werden konnte, versuchte man, farblich zu ver-
mitteln.155
Über den Erhaltungszustand der Markloher Gewölbe-
malereien nach der Freilegung sind keine Details
bekannt. Provinzialkonservator Reimers hatte bei sei-
ner Besichtigung jedoch festgestellt, die Malereien
seien von „außergewöhnlicher Schönheit und so gut
erhalten", dass sie kaum einer Ergänzung, sondern
nur einer „Auffrischung" bedürften.156Im September
1906 begann Kirchenmaler Ebeling aus Hannover mit
der Restaurierung der Gewölbemalereien. In einem
Schreiben an den Pastor gab er an, dass die „Instand-
setzung sorgfältig in 12-14 Tagen auszuführen" sei.157
Ebeling berichtete einige Jahre später über die von
ihm durchgeführten Maßnahmen:
„Diese besagte Malerei ist vorgefunden u [I] im Sinne
der Denkmalpflege instandgesetzt u [I] fehlende Teile
in entsprechender Weise ergänzt. Die Ergänzung
erfolgte unter großer Zurückhaltung, so daß viele Teile
im Urstand [I] verblieben, die gereinigt u [I] mit
Bindemittel getränkt wurden."158
Ebeling hat sich innerhalb der Figuren im Gewölbe
weitestgehend auf die Ergänzung von Fehlstellen be-
schränkt. Diese füllte er flächig lasierend mit Farb-
tönen, die etwas heller als die Umgebung sind. Feh-
lende Konturen ergänzte er ebenfalls. Mit diesem Vor-
gehen hielt er sich weitgehend an die oben erwähn-
ten Vorgaben mit Ausnahme der Ergänzung von Fehl-
stellen in Inkarnaten, die er ebenso wie die anderen
behandelte. Es ist denkbar, dass Ebeling weniger gut
erhaltene Bereiche lasierend überarbeitete, was aber
nicht abschließend geklärt werden konnte. Die Ran-
kenmalerei im Gewölbe bearbeitete Ebeling weniger
zurückhaltend. Sie ist zum großen Teil lasierend über-
malt. Mit welchem Bindemittel Ebeling die Malereien
getränkt hat, ist nicht bekannt. Denkbar wäre eine
verdünnte Kaseinlösung, mit der Ebeling auch in
Neuenkirchen arbeitete (vgl. S. 277 ff.).
Restaurierungsgeschichte mittelalterlicher Gewölbe- und Wandmalereien im Gebiet des heutigen Niedersachsen
Chor, nördliche Gewölbekappe, Ausschnitt. Fehlstellen sind
lasierend eingetönt, die Konturen nachgezogen.
Chor, nördliche Gewölbekappe, Ausschnitt. Auch hier sind
die Fehlstellen durch die helle Retusche erkennbar.
Zeichnung und Konturen sind zum großen Teil nachgezo-
gen.
in erster Linie historischen Bedürfnissen genügen
müsse, das heißt der unverfälschten Präsentation des
historischen Bestands, müsse eine Restaurierung für
den kirchlichen Zweck auch ästhetischen Anforderun-
gen genügen. Die Gemeinden hätten den Wunsch,
ihre Bildwerke in einem repräsentativen, vollständigen
Zustand zu zeigen.
Die Methode Reimers' sollte beide Ansprüche vereini-
gen: den historischen Bestand zu erhalten, ohne zu
übermalen und die Kunstwerke für den Betrachter
geschlossen zu präsentieren. Seine Bildbeispiele zei-
gen, dass nur dort Ergänzungen vorgenommen wur-
den, wo man annahm, aufgrund der angrenzenden
Bereiche rekonstruieren zu können. In figürlichen
Darstellungen wurden nur kleine Fehlstellen ergänzt.
Fehlende Bereiche in Inkarnaten beließ man. In nicht
figürlichen Bildteilen wurden größere Fehlstellen
monochrom, nur in Farbnuancen changierend, er-
gänzt. Bereiche, deren Verlauf nicht eindeutig rekons-
truiert werden konnte, versuchte man, farblich zu ver-
mitteln.155
Über den Erhaltungszustand der Markloher Gewölbe-
malereien nach der Freilegung sind keine Details
bekannt. Provinzialkonservator Reimers hatte bei sei-
ner Besichtigung jedoch festgestellt, die Malereien
seien von „außergewöhnlicher Schönheit und so gut
erhalten", dass sie kaum einer Ergänzung, sondern
nur einer „Auffrischung" bedürften.156Im September
1906 begann Kirchenmaler Ebeling aus Hannover mit
der Restaurierung der Gewölbemalereien. In einem
Schreiben an den Pastor gab er an, dass die „Instand-
setzung sorgfältig in 12-14 Tagen auszuführen" sei.157
Ebeling berichtete einige Jahre später über die von
ihm durchgeführten Maßnahmen:
„Diese besagte Malerei ist vorgefunden u [I] im Sinne
der Denkmalpflege instandgesetzt u [I] fehlende Teile
in entsprechender Weise ergänzt. Die Ergänzung
erfolgte unter großer Zurückhaltung, so daß viele Teile
im Urstand [I] verblieben, die gereinigt u [I] mit
Bindemittel getränkt wurden."158
Ebeling hat sich innerhalb der Figuren im Gewölbe
weitestgehend auf die Ergänzung von Fehlstellen be-
schränkt. Diese füllte er flächig lasierend mit Farb-
tönen, die etwas heller als die Umgebung sind. Feh-
lende Konturen ergänzte er ebenfalls. Mit diesem Vor-
gehen hielt er sich weitgehend an die oben erwähn-
ten Vorgaben mit Ausnahme der Ergänzung von Fehl-
stellen in Inkarnaten, die er ebenso wie die anderen
behandelte. Es ist denkbar, dass Ebeling weniger gut
erhaltene Bereiche lasierend überarbeitete, was aber
nicht abschließend geklärt werden konnte. Die Ran-
kenmalerei im Gewölbe bearbeitete Ebeling weniger
zurückhaltend. Sie ist zum großen Teil lasierend über-
malt. Mit welchem Bindemittel Ebeling die Malereien
getränkt hat, ist nicht bekannt. Denkbar wäre eine
verdünnte Kaseinlösung, mit der Ebeling auch in
Neuenkirchen arbeitete (vgl. S. 277 ff.).