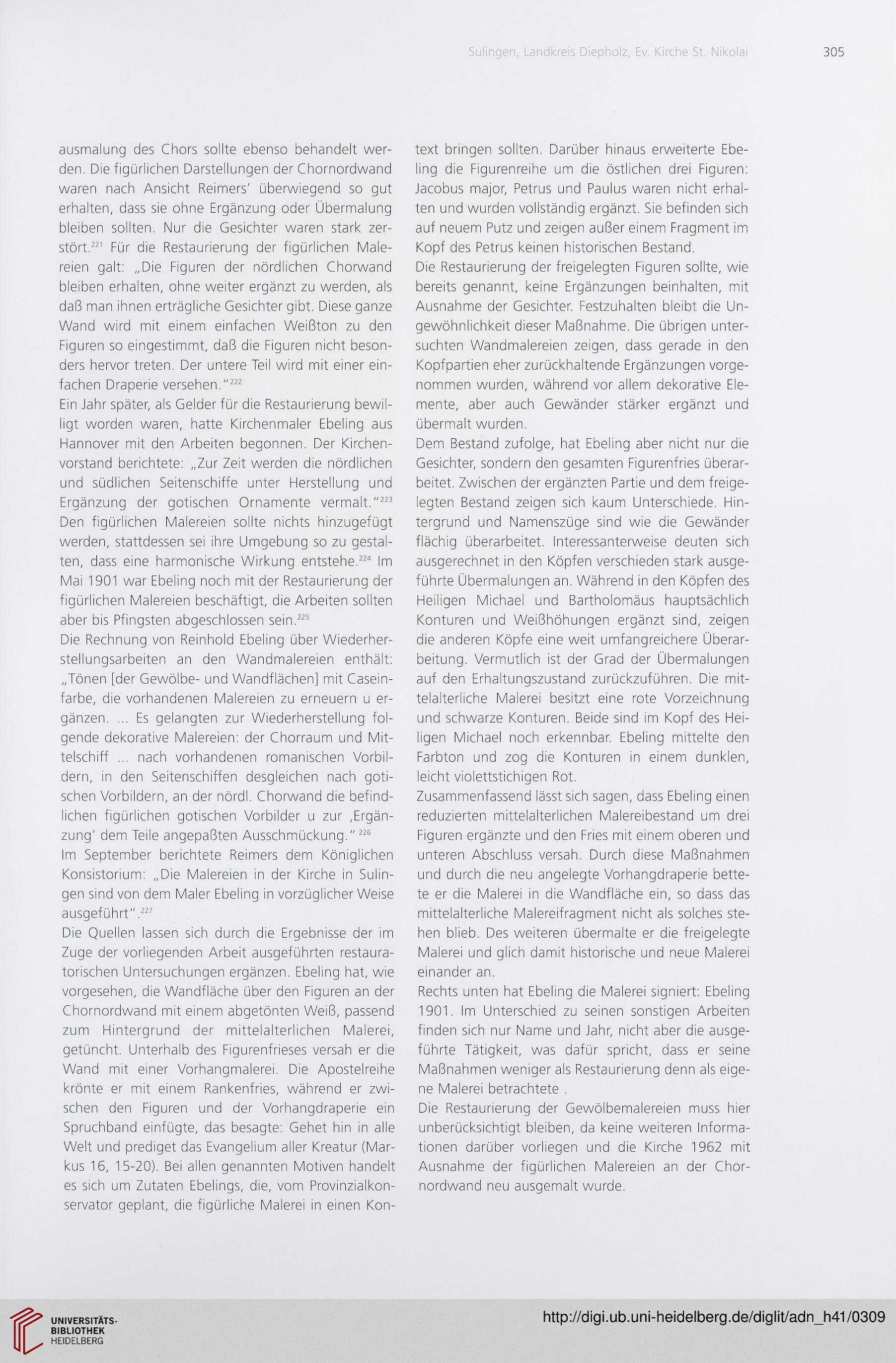Sulingen, Landkreis Diepholz, Ev. Kirche St. Nikolai
305
ausmalung des Chors sollte ebenso behandelt wer-
den. Die figürlichen Darstellungen der Chornordwand
waren nach Ansicht Reimers' überwiegend so gut
erhalten, dass sie ohne Ergänzung oder Übermalung
bleiben sollten. Nur die Gesichter waren stark zer-
stört.221 Für die Restaurierung der figürlichen Male-
reien galt: „Die Figuren der nördlichen Chorwand
bleiben erhalten, ohne weiter ergänzt zu werden, als
daß man ihnen erträgliche Gesichter gibt. Diese ganze
Wand wird mit einem einfachen Weißton zu den
Figuren so eingestimmt, daß die Figuren nicht beson-
ders hervor treten. Der untere Teil wird mit einer ein-
fachen Draperie versehen."222
Ein Jahr später, als Gelder für die Restaurierung bewil-
ligt worden waren, hatte Kirchenmaler Ebeling aus
Hannover mit den Arbeiten begonnen. Der Kirchen-
vorstand berichtete: „Zur Zeit werden die nördlichen
und südlichen Seitenschiffe unter Herstellung und
Ergänzung der gotischen Ornamente vermalt."223
Den figürlichen Malereien sollte nichts hinzugefügt
werden, stattdessen sei ihre Umgebung so zu gestal-
ten, dass eine harmonische Wirkung entstehe.224 Im
Mai 1901 war Ebeling noch mit der Restaurierung der
figürlichen Malereien beschäftigt, die Arbeiten sollten
aber bis Pfingsten abgeschlossen sein.225
Die Rechnung von Reinhold Ebeling über Wiederher-
stellungsarbeiten an den Wandmalereien enthält:
„Tönen [der Gewölbe- und Wandflächen] mit Casein-
farbe, die vorhandenen Malereien zu erneuern u er-
gänzen. ... Es gelangten zur Wiederherstellung fol-
gende dekorative Malereien: der Chorraum und Mit-
telschiff ... nach vorhandenen romanischen Vorbil-
dern, in den Seitenschiffen desgleichen nach goti-
schen Vorbildern, an der nördl. Chorwand die befind-
lichen figürlichen gotischen Vorbilder u zur Ergän-
zung' dem Teile angepaßten Ausschmückung."225
Im September berichtete Reimers dem Königlichen
Konsistorium: „Die Malereien in der Kirche in Sulin-
gen sind von dem Maler Ebeling in vorzüglicherWeise
ausgeführt".227
Die Quellen lassen sich durch die Ergebnisse der im
Zuge der vorliegenden Arbeit ausgeführten restaura-
torischen Untersuchungen ergänzen. Ebeling hat, wie
vorgesehen, die Wandfläche über den Figuren an der
Chornordwand mit einem abgetönten Weiß, passend
zum Hintergrund der mittelalterlichen Malerei,
getüncht. Unterhalb des Figurenfrieses versah er die
Wand mit einer Vorhangmalerei. Die Apostelreihe
krönte er mit einem Rankenfries, während er zwi-
schen den Figuren und der Vorhangdraperie ein
Spruchband einfügte, das besagte: Gehet hin in alle
Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur (Mar-
kus 16, 15-20). Bei allen genannten Motiven handelt
es sich um Zutaten Ebelings, die, vom Provinzialkon-
servator geplant, die figürliche Malerei in einen Kon-
text bringen sollten. Darüber hinaus erweiterte Ebe-
ling die Figurenreihe um die östlichen drei Figuren:
Jacobus major, Petrus und Paulus waren nicht erhal-
ten und wurden vollständig ergänzt. Sie befinden sich
auf neuem Putz und zeigen außer einem Fragment im
Kopf des Petrus keinen historischen Bestand.
Die Restaurierung der freigelegten Figuren sollte, wie
bereits genannt, keine Ergänzungen beinhalten, mit
Ausnahme der Gesichter. Festzuhalten bleibt die Un-
gewöhnlichkeit dieser Maßnahme. Die übrigen unter-
suchten Wandmalereien zeigen, dass gerade in den
Kopfpartien eher zurückhaltende Ergänzungen vorge-
nommen wurden, während vor allem dekorative Ele-
mente, aber auch Gewänder stärker ergänzt und
übermalt wurden.
Dem Bestand zufolge, hat Ebeling aber nicht nur die
Gesichter, sondern den gesamten Figurenfries überar-
beitet. Zwischen der ergänzten Partie und dem freige-
legten Bestand zeigen sich kaum Unterschiede. Hin-
tergrund und Namenszüge sind wie die Gewänder
flächig überarbeitet. Interessanterweise deuten sich
ausgerechnet in den Köpfen verschieden stark ausge-
führte Übermalungen an. Während in den Köpfen des
Heiligen Michael und Bartholomäus hauptsächlich
Konturen und Weißhöhungen ergänzt sind, zeigen
die anderen Köpfe eine weit umfangreichere Überar-
beitung. Vermutlich ist der Grad der Übermalungen
auf den Erhaltungszustand zurückzuführen. Die mit-
telalterliche Malerei besitzt eine rote Vorzeichnung
und schwarze Konturen. Beide sind im Kopf des Hei-
ligen Michael noch erkennbar. Ebeling mittelte den
Farbton und zog die Konturen in einem dunklen,
leicht violettstichigen Rot.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ebeling einen
reduzierten mittelalterlichen Malereibestand um drei
Figuren ergänzte und den Fries mit einem oberen und
unteren Abschluss versah. Durch diese Maßnahmen
und durch die neu angelegte Vorhangdraperie bette-
te er die Malerei in die Wandfläche ein, so dass das
mittelalterliche Malereifragment nicht als solches ste-
hen blieb. Des weiteren übermalte er die freigelegte
Malerei und glich damit historische und neue Malerei
einander an.
Rechts unten hat Ebeling die Malerei signiert: Ebeling
1901. Im Unterschied zu seinen sonstigen Arbeiten
finden sich nur Name und Jahr, nicht aber die ausge-
führte Tätigkeit, was dafür spricht, dass er seine
Maßnahmen weniger als Restaurierung denn als eige-
ne Malerei betrachtete .
Die Restaurierung der Gewölbemalereien muss hier
unberücksichtigt bleiben, da keine weiteren Informa-
tionen darüber vorliegen und die Kirche 1962 mit
Ausnahme der figürlichen Malereien an der Chor-
nordwand neu ausgemalt wurde.
305
ausmalung des Chors sollte ebenso behandelt wer-
den. Die figürlichen Darstellungen der Chornordwand
waren nach Ansicht Reimers' überwiegend so gut
erhalten, dass sie ohne Ergänzung oder Übermalung
bleiben sollten. Nur die Gesichter waren stark zer-
stört.221 Für die Restaurierung der figürlichen Male-
reien galt: „Die Figuren der nördlichen Chorwand
bleiben erhalten, ohne weiter ergänzt zu werden, als
daß man ihnen erträgliche Gesichter gibt. Diese ganze
Wand wird mit einem einfachen Weißton zu den
Figuren so eingestimmt, daß die Figuren nicht beson-
ders hervor treten. Der untere Teil wird mit einer ein-
fachen Draperie versehen."222
Ein Jahr später, als Gelder für die Restaurierung bewil-
ligt worden waren, hatte Kirchenmaler Ebeling aus
Hannover mit den Arbeiten begonnen. Der Kirchen-
vorstand berichtete: „Zur Zeit werden die nördlichen
und südlichen Seitenschiffe unter Herstellung und
Ergänzung der gotischen Ornamente vermalt."223
Den figürlichen Malereien sollte nichts hinzugefügt
werden, stattdessen sei ihre Umgebung so zu gestal-
ten, dass eine harmonische Wirkung entstehe.224 Im
Mai 1901 war Ebeling noch mit der Restaurierung der
figürlichen Malereien beschäftigt, die Arbeiten sollten
aber bis Pfingsten abgeschlossen sein.225
Die Rechnung von Reinhold Ebeling über Wiederher-
stellungsarbeiten an den Wandmalereien enthält:
„Tönen [der Gewölbe- und Wandflächen] mit Casein-
farbe, die vorhandenen Malereien zu erneuern u er-
gänzen. ... Es gelangten zur Wiederherstellung fol-
gende dekorative Malereien: der Chorraum und Mit-
telschiff ... nach vorhandenen romanischen Vorbil-
dern, in den Seitenschiffen desgleichen nach goti-
schen Vorbildern, an der nördl. Chorwand die befind-
lichen figürlichen gotischen Vorbilder u zur Ergän-
zung' dem Teile angepaßten Ausschmückung."225
Im September berichtete Reimers dem Königlichen
Konsistorium: „Die Malereien in der Kirche in Sulin-
gen sind von dem Maler Ebeling in vorzüglicherWeise
ausgeführt".227
Die Quellen lassen sich durch die Ergebnisse der im
Zuge der vorliegenden Arbeit ausgeführten restaura-
torischen Untersuchungen ergänzen. Ebeling hat, wie
vorgesehen, die Wandfläche über den Figuren an der
Chornordwand mit einem abgetönten Weiß, passend
zum Hintergrund der mittelalterlichen Malerei,
getüncht. Unterhalb des Figurenfrieses versah er die
Wand mit einer Vorhangmalerei. Die Apostelreihe
krönte er mit einem Rankenfries, während er zwi-
schen den Figuren und der Vorhangdraperie ein
Spruchband einfügte, das besagte: Gehet hin in alle
Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur (Mar-
kus 16, 15-20). Bei allen genannten Motiven handelt
es sich um Zutaten Ebelings, die, vom Provinzialkon-
servator geplant, die figürliche Malerei in einen Kon-
text bringen sollten. Darüber hinaus erweiterte Ebe-
ling die Figurenreihe um die östlichen drei Figuren:
Jacobus major, Petrus und Paulus waren nicht erhal-
ten und wurden vollständig ergänzt. Sie befinden sich
auf neuem Putz und zeigen außer einem Fragment im
Kopf des Petrus keinen historischen Bestand.
Die Restaurierung der freigelegten Figuren sollte, wie
bereits genannt, keine Ergänzungen beinhalten, mit
Ausnahme der Gesichter. Festzuhalten bleibt die Un-
gewöhnlichkeit dieser Maßnahme. Die übrigen unter-
suchten Wandmalereien zeigen, dass gerade in den
Kopfpartien eher zurückhaltende Ergänzungen vorge-
nommen wurden, während vor allem dekorative Ele-
mente, aber auch Gewänder stärker ergänzt und
übermalt wurden.
Dem Bestand zufolge, hat Ebeling aber nicht nur die
Gesichter, sondern den gesamten Figurenfries überar-
beitet. Zwischen der ergänzten Partie und dem freige-
legten Bestand zeigen sich kaum Unterschiede. Hin-
tergrund und Namenszüge sind wie die Gewänder
flächig überarbeitet. Interessanterweise deuten sich
ausgerechnet in den Köpfen verschieden stark ausge-
führte Übermalungen an. Während in den Köpfen des
Heiligen Michael und Bartholomäus hauptsächlich
Konturen und Weißhöhungen ergänzt sind, zeigen
die anderen Köpfe eine weit umfangreichere Überar-
beitung. Vermutlich ist der Grad der Übermalungen
auf den Erhaltungszustand zurückzuführen. Die mit-
telalterliche Malerei besitzt eine rote Vorzeichnung
und schwarze Konturen. Beide sind im Kopf des Hei-
ligen Michael noch erkennbar. Ebeling mittelte den
Farbton und zog die Konturen in einem dunklen,
leicht violettstichigen Rot.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ebeling einen
reduzierten mittelalterlichen Malereibestand um drei
Figuren ergänzte und den Fries mit einem oberen und
unteren Abschluss versah. Durch diese Maßnahmen
und durch die neu angelegte Vorhangdraperie bette-
te er die Malerei in die Wandfläche ein, so dass das
mittelalterliche Malereifragment nicht als solches ste-
hen blieb. Des weiteren übermalte er die freigelegte
Malerei und glich damit historische und neue Malerei
einander an.
Rechts unten hat Ebeling die Malerei signiert: Ebeling
1901. Im Unterschied zu seinen sonstigen Arbeiten
finden sich nur Name und Jahr, nicht aber die ausge-
führte Tätigkeit, was dafür spricht, dass er seine
Maßnahmen weniger als Restaurierung denn als eige-
ne Malerei betrachtete .
Die Restaurierung der Gewölbemalereien muss hier
unberücksichtigt bleiben, da keine weiteren Informa-
tionen darüber vorliegen und die Kirche 1962 mit
Ausnahme der figürlichen Malereien an der Chor-
nordwand neu ausgemalt wurde.