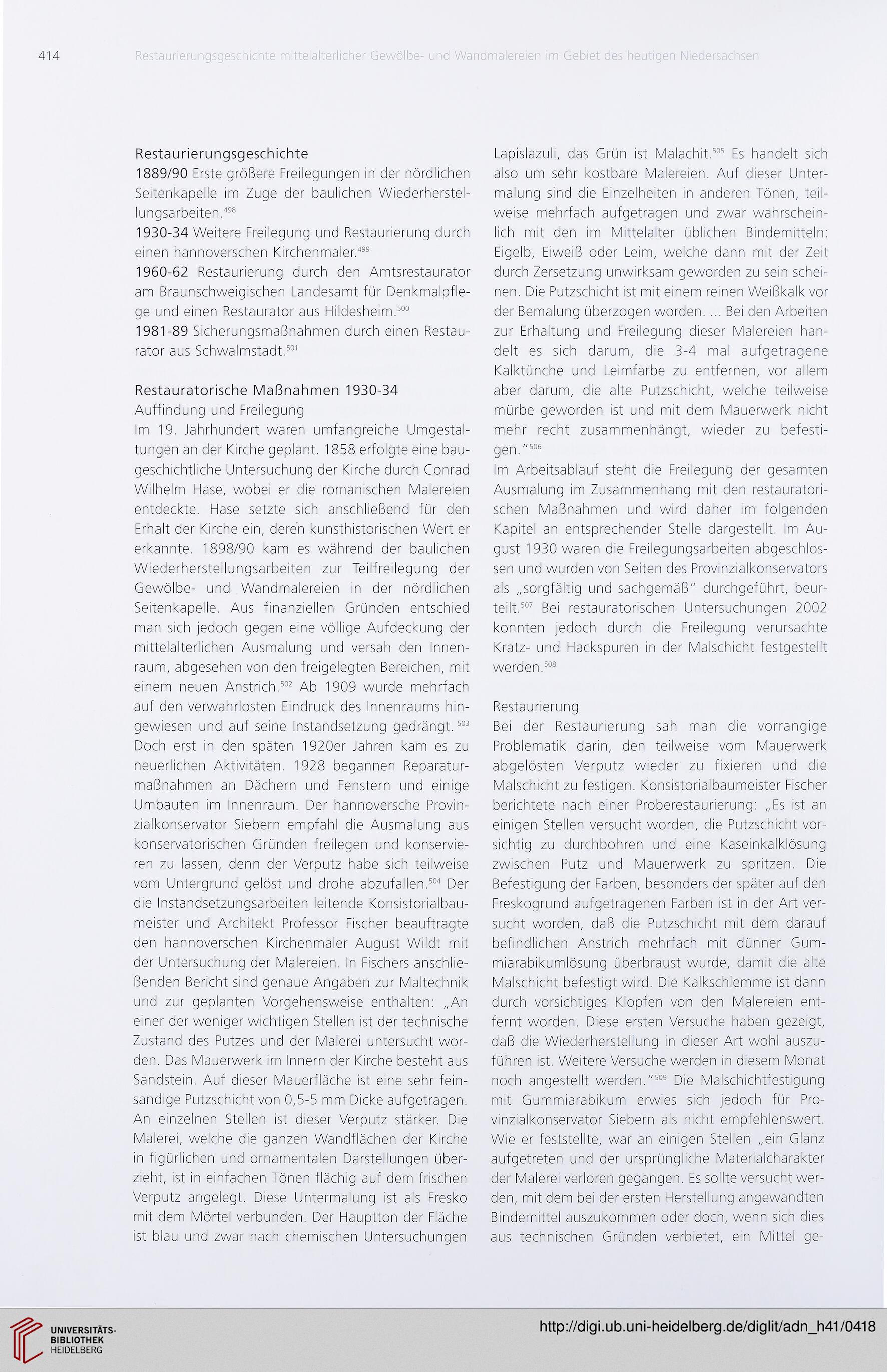414
Restaurierungsgeschichte mittelalterlicher Gewölbe- und Wandmalereien im Gebiet des heutigen Niedersachsen
Restaurierungsgeschichte
1889/90 Erste größere Freilegungen in der nördlichen
Seitenkapelle im Zuge der baulichen Wiederherstel-
lungsarbeiten.498
1930-34 Weitere Freilegung und Restaurierung durch
einen hannoverschen Kirchenmaler.499
1960-62 Restaurierung durch den Amtsrestaurator
am Braunschweigischen Landesamt für Denkmalpfle-
ge und einen Restaurator aus Hildesheim.500
1981-89 Sicherungsmaßnahmen durch einen Restau-
rator aus Schwalmstadt.501
Restauratorische Maßnahmen 1930-34
Auffindung und Freilegung
Im 19. Jahrhundert waren umfangreiche Umgestal-
tungen an der Kirche geplant. 1858 erfolgte eine bau-
geschichtliche Untersuchung der Kirche durch Conrad
Wilhelm Hase, wobei er die romanischen Malereien
entdeckte. Hase setzte sich anschließend für den
Erhalt der Kirche ein, deren kunsthistorischen Wert er
erkannte. 1898/90 kam es während der baulichen
Wiederherstellungsarbeiten zur Teilfreilegung der
Gewölbe- und Wandmalereien in der nördlichen
Seitenkapelle. Aus finanziellen Gründen entschied
man sich jedoch gegen eine völlige Aufdeckung der
mittelalterlichen Ausmalung und versah den Innen-
raum, abgesehen von den freigelegten Bereichen, mit
einem neuen Anstrich.502 Ab 1909 wurde mehrfach
auf den verwahrlosten Eindruck des Innenraums hin-
gewiesen und auf seine Instandsetzung gedrängt.503
Doch erst in den späten 1920er Jahren kam es zu
neuerlichen Aktivitäten. 1928 begannen Reparatur-
maßnahmen an Dächern und Fenstern und einige
Umbauten im Innenraum. Der hannoversche Provin-
zialkonservator Siebern empfahl die Ausmalung aus
konservatorischen Gründen freilegen und konservie-
ren zu lassen, denn der Verputz habe sich teilweise
vom Untergrund gelöst und drohe abzufallen.504 Der
die Instandsetzungsarbeiten leitende Konsistorialbau-
meister und Architekt Professor Fischer beauftragte
den hannoverschen Kirchenmaler August Wildt mit
der Untersuchung der Malereien. In Fischers anschlie-
ßenden Bericht sind genaue Angaben zur Maltechnik
und zur geplanten Vorgehensweise enthalten: „An
einer der weniger wichtigen Stellen ist der technische
Zustand des Putzes und der Malerei untersucht wor-
den. Das Mauerwerk im Innern der Kirche besteht aus
Sandstein. Auf dieser Mauerfläche ist eine sehr fein-
sandige Putzschicht von 0,5-5 mm Dicke aufgetragen.
An einzelnen Stellen ist dieser Verputz stärker. Die
Malerei, welche die ganzen Wandflächen der Kirche
in figürlichen und ornamentalen Darstellungen über-
zieht, ist in einfachen Tönen flächig auf dem frischen
Verputz angelegt. Diese Untermalung ist als Fresko
mit dem Mörtel verbunden. Der Hauptton der Fläche
ist blau und zwar nach chemischen Untersuchungen
Lapislazuli, das Grün ist Malachit.505 Es handelt sich
also um sehr kostbare Malereien. Auf dieser Unter-
malung sind die Einzelheiten in anderen Tönen, teil-
weise mehrfach aufgetragen und zwar wahrschein-
lich mit den im Mittelalter üblichen Bindemitteln:
Eigelb, Eiweiß oder Leim, welche dann mit der Zeit
durch Zersetzung unwirksam geworden zu sein schei-
nen. Die Putzschicht ist mit einem reinen Weißkalk vor
der Bemalung überzogen worden. ... Bei den Arbeiten
zur Erhaltung und Freilegung dieser Malereien han-
delt es sich darum, die 3-4 mal aufgetragene
Kalktünche und Leimfarbe zu entfernen, vor allem
aber darum, die alte Putzschicht, welche teilweise
mürbe geworden ist und mit dem Mauerwerk nicht
mehr recht zusammenhängt, wieder zu befesti-
gen."506
Im Arbeitsablauf steht die Freilegung der gesamten
Ausmalung im Zusammenhang mit den restauratori-
schen Maßnahmen und wird daher im folgenden
Kapitel an entsprechender Stelle dargestellt. Im Au-
gust 1930 waren die Freilegungsarbeiten abgeschlos-
sen und wurden von Seiten des Provinzialkonservators
als „sorgfältig und sachgemäß" durchgeführt, beur-
teilt.507 Bei restauratorischen Untersuchungen 2002
konnten jedoch durch die Freilegung verursachte
Kratz- und Hackspuren in der Malschicht festgestellt
werden.508
Restaurierung
Bei der Restaurierung sah man die vorrangige
Problematik darin, den teilweise vom Mauerwerk
abgelösten Verputz wieder zu fixieren und die
Malschicht zu festigen. Konsistorialbaumeister Fischer
berichtete nach einer Proberestaurierung: „Es ist an
einigen Stellen versucht worden, die Putzschicht vor-
sichtig zu durchbohren und eine Kaseinkalklösung
zwischen Putz und Mauerwerk zu spritzen. Die
Befestigung der Farben, besonders der später auf den
Freskogrund aufgetragenen Farben ist in der Art ver-
sucht worden, daß die Putzschicht mit dem darauf
befindlichen Anstrich mehrfach mit dünner Gum-
miarabikumlösung überbraust wurde, damit die alte
Malschicht befestigt wird. Die Kalkschlemme ist dann
durch vorsichtiges Klopfen von den Malereien ent-
fernt worden. Diese ersten Versuche haben gezeigt,
daß die Wiederherstellung in dieser Art wohl auszu-
führen ist. Weitere Versuche werden in diesem Monat
noch angestellt werden."509 Die Malschichtfestigung
mit Gummiarabikum erwies sich jedoch für Pro-
vinzialkonservator Siebern als nicht empfehlenswert.
Wie er feststellte, war an einigen Stellen „ein Glanz
aufgetreten und der ursprüngliche Materialcharakter
der Malerei verloren gegangen. Es sollte versucht wer-
den, mit dem bei der ersten Herstellung angewandten
Bindemittel auszukommen oder doch, wenn sich dies
aus technischen Gründen verbietet, ein Mittel ge-
Restaurierungsgeschichte mittelalterlicher Gewölbe- und Wandmalereien im Gebiet des heutigen Niedersachsen
Restaurierungsgeschichte
1889/90 Erste größere Freilegungen in der nördlichen
Seitenkapelle im Zuge der baulichen Wiederherstel-
lungsarbeiten.498
1930-34 Weitere Freilegung und Restaurierung durch
einen hannoverschen Kirchenmaler.499
1960-62 Restaurierung durch den Amtsrestaurator
am Braunschweigischen Landesamt für Denkmalpfle-
ge und einen Restaurator aus Hildesheim.500
1981-89 Sicherungsmaßnahmen durch einen Restau-
rator aus Schwalmstadt.501
Restauratorische Maßnahmen 1930-34
Auffindung und Freilegung
Im 19. Jahrhundert waren umfangreiche Umgestal-
tungen an der Kirche geplant. 1858 erfolgte eine bau-
geschichtliche Untersuchung der Kirche durch Conrad
Wilhelm Hase, wobei er die romanischen Malereien
entdeckte. Hase setzte sich anschließend für den
Erhalt der Kirche ein, deren kunsthistorischen Wert er
erkannte. 1898/90 kam es während der baulichen
Wiederherstellungsarbeiten zur Teilfreilegung der
Gewölbe- und Wandmalereien in der nördlichen
Seitenkapelle. Aus finanziellen Gründen entschied
man sich jedoch gegen eine völlige Aufdeckung der
mittelalterlichen Ausmalung und versah den Innen-
raum, abgesehen von den freigelegten Bereichen, mit
einem neuen Anstrich.502 Ab 1909 wurde mehrfach
auf den verwahrlosten Eindruck des Innenraums hin-
gewiesen und auf seine Instandsetzung gedrängt.503
Doch erst in den späten 1920er Jahren kam es zu
neuerlichen Aktivitäten. 1928 begannen Reparatur-
maßnahmen an Dächern und Fenstern und einige
Umbauten im Innenraum. Der hannoversche Provin-
zialkonservator Siebern empfahl die Ausmalung aus
konservatorischen Gründen freilegen und konservie-
ren zu lassen, denn der Verputz habe sich teilweise
vom Untergrund gelöst und drohe abzufallen.504 Der
die Instandsetzungsarbeiten leitende Konsistorialbau-
meister und Architekt Professor Fischer beauftragte
den hannoverschen Kirchenmaler August Wildt mit
der Untersuchung der Malereien. In Fischers anschlie-
ßenden Bericht sind genaue Angaben zur Maltechnik
und zur geplanten Vorgehensweise enthalten: „An
einer der weniger wichtigen Stellen ist der technische
Zustand des Putzes und der Malerei untersucht wor-
den. Das Mauerwerk im Innern der Kirche besteht aus
Sandstein. Auf dieser Mauerfläche ist eine sehr fein-
sandige Putzschicht von 0,5-5 mm Dicke aufgetragen.
An einzelnen Stellen ist dieser Verputz stärker. Die
Malerei, welche die ganzen Wandflächen der Kirche
in figürlichen und ornamentalen Darstellungen über-
zieht, ist in einfachen Tönen flächig auf dem frischen
Verputz angelegt. Diese Untermalung ist als Fresko
mit dem Mörtel verbunden. Der Hauptton der Fläche
ist blau und zwar nach chemischen Untersuchungen
Lapislazuli, das Grün ist Malachit.505 Es handelt sich
also um sehr kostbare Malereien. Auf dieser Unter-
malung sind die Einzelheiten in anderen Tönen, teil-
weise mehrfach aufgetragen und zwar wahrschein-
lich mit den im Mittelalter üblichen Bindemitteln:
Eigelb, Eiweiß oder Leim, welche dann mit der Zeit
durch Zersetzung unwirksam geworden zu sein schei-
nen. Die Putzschicht ist mit einem reinen Weißkalk vor
der Bemalung überzogen worden. ... Bei den Arbeiten
zur Erhaltung und Freilegung dieser Malereien han-
delt es sich darum, die 3-4 mal aufgetragene
Kalktünche und Leimfarbe zu entfernen, vor allem
aber darum, die alte Putzschicht, welche teilweise
mürbe geworden ist und mit dem Mauerwerk nicht
mehr recht zusammenhängt, wieder zu befesti-
gen."506
Im Arbeitsablauf steht die Freilegung der gesamten
Ausmalung im Zusammenhang mit den restauratori-
schen Maßnahmen und wird daher im folgenden
Kapitel an entsprechender Stelle dargestellt. Im Au-
gust 1930 waren die Freilegungsarbeiten abgeschlos-
sen und wurden von Seiten des Provinzialkonservators
als „sorgfältig und sachgemäß" durchgeführt, beur-
teilt.507 Bei restauratorischen Untersuchungen 2002
konnten jedoch durch die Freilegung verursachte
Kratz- und Hackspuren in der Malschicht festgestellt
werden.508
Restaurierung
Bei der Restaurierung sah man die vorrangige
Problematik darin, den teilweise vom Mauerwerk
abgelösten Verputz wieder zu fixieren und die
Malschicht zu festigen. Konsistorialbaumeister Fischer
berichtete nach einer Proberestaurierung: „Es ist an
einigen Stellen versucht worden, die Putzschicht vor-
sichtig zu durchbohren und eine Kaseinkalklösung
zwischen Putz und Mauerwerk zu spritzen. Die
Befestigung der Farben, besonders der später auf den
Freskogrund aufgetragenen Farben ist in der Art ver-
sucht worden, daß die Putzschicht mit dem darauf
befindlichen Anstrich mehrfach mit dünner Gum-
miarabikumlösung überbraust wurde, damit die alte
Malschicht befestigt wird. Die Kalkschlemme ist dann
durch vorsichtiges Klopfen von den Malereien ent-
fernt worden. Diese ersten Versuche haben gezeigt,
daß die Wiederherstellung in dieser Art wohl auszu-
führen ist. Weitere Versuche werden in diesem Monat
noch angestellt werden."509 Die Malschichtfestigung
mit Gummiarabikum erwies sich jedoch für Pro-
vinzialkonservator Siebern als nicht empfehlenswert.
Wie er feststellte, war an einigen Stellen „ein Glanz
aufgetreten und der ursprüngliche Materialcharakter
der Malerei verloren gegangen. Es sollte versucht wer-
den, mit dem bei der ersten Herstellung angewandten
Bindemittel auszukommen oder doch, wenn sich dies
aus technischen Gründen verbietet, ein Mittel ge-