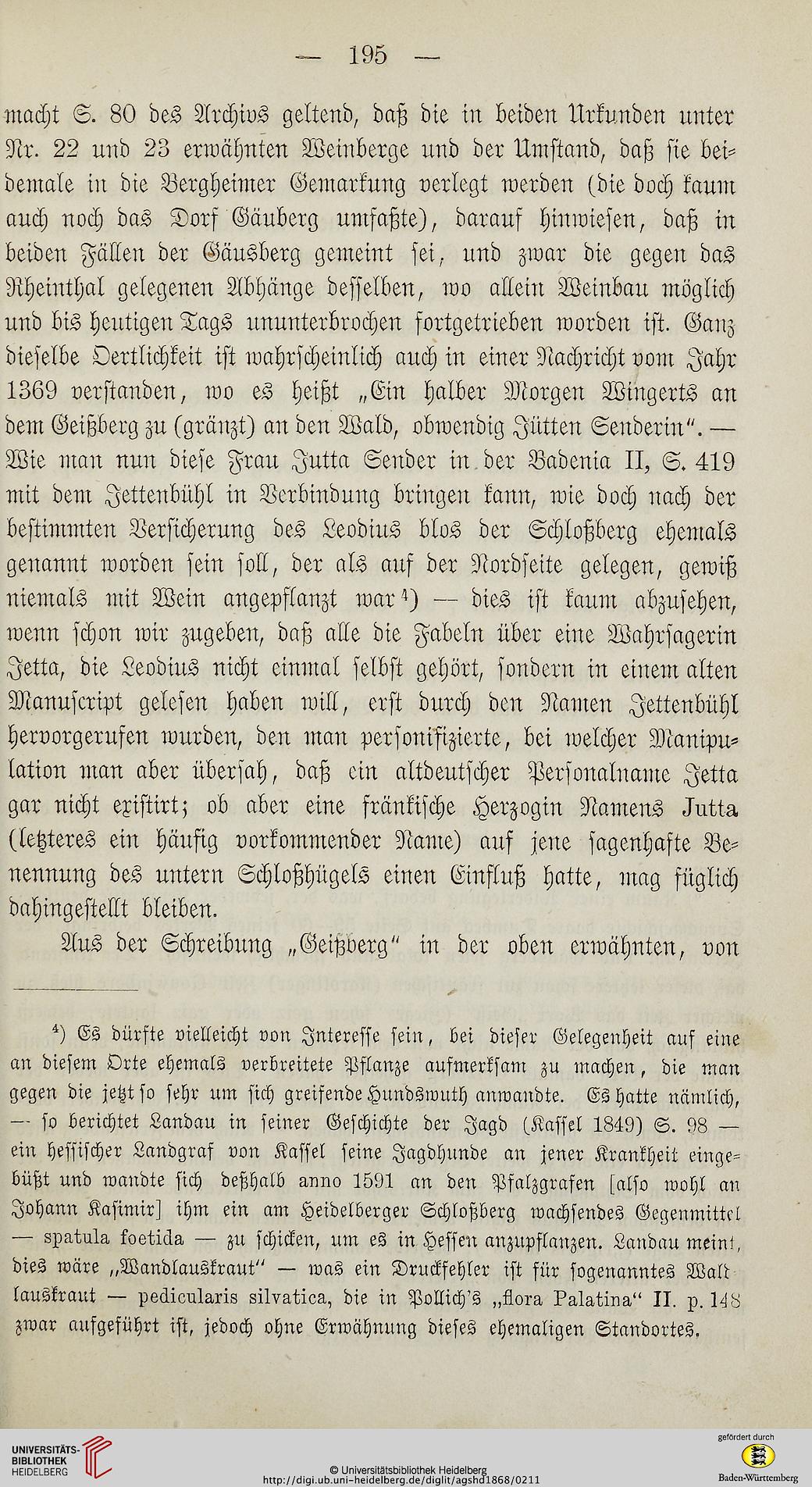195
macht S. 80 des Archivs geltend, daß die in beiden Urkunden unter
Nr. 22 und 23 ermähnten Weinberge und der Umstand, daß sie bei-
demale in die Bergheimer Gemarkung verlegt werden (die doch kaum
auch noch das Dors Gäuberg umfaßte), darauf hinmiesen, daß in
beiden Fällen der Gäusberg gemeint sei, und zwar die gegen das
Rheinthal gelegenen Abhänge desselben, mo allein Weinbau möglich
und bis heutigen Tags ununterbrochen fortgetrieben worden ist. Ganz
dieselbe Oertlichkeit ist wahrscheinlich auch in einer Nachricht vom Jahr
1369 verstanden, wo es heißt „Ein halber Morgen Wingerts an
dem Geißberg zu (gränzt) an den Wald, obwendig Jütten Senderin". —
Wie man nun diese Frau Jutta Sender in der Badenia II, S. 419
mit dem Jettenbühl in Verbindung bringen kann, wie doch nach der
bestimmten Versicherung des Leodius blos der Schloßberg ehemals
genannt worden sein soll, der als auf der Nordseite gelegen, gewiß
niemals mit Wein angepflanzt war J — dies ist kaum abzusehen,
wenn schon wir zugeben, daß alle die Fabeln über eine Wahrsagerin
Jetta, die Leodius nicht einmal selbst gehört, sondern in einen: alten
Manuscript gelesen haben will, erst durch den Namen Jettenbühl
hervorgerufen wurden, den man personifizierte, bei welcher Manipu-
lation man aber übersah, daß ein altdeutscher Personalname Jetta
gar nicht existirt; ob aber eine fränkische Herzogin Namens lluttu
(letzteres ein häufig vorkommender Name) auf jene sagenhafte Be-
nennung des untern Schloßhügels einen Einfluß hatte, mag füglich
dahingestellt bleiben.
Aus der Schreibung „Geitzverg" in der oben erwähnten, von
0 Es dürfte vielleicht von Interesse sein, bei dieser Gelegenheit auf eine
an diesem Orte ehemals verbreitete Pflanze aufmerksam zu machen, die man
gegen die jetzt so sehr um sich greifende Hundswuth anwandte. Es hatte nämlich,
— so berichtet Landau in seiner Geschichte der Jagd (Kassel 1849) S. 98 —
ein hessischer Landgraf von Kassel seine Jagdhunde an jener Krankheit einge-
büßt und wandte sich deßhalb anno 1591 an den Pfalzgrasen salso wohl an
Johann Kasimirs ihm ein am Heidelberger Schloßberg wachsendes Gegenmittel
— sxatula koottäa — zu schicken, um es in Hessen anzupflanzen. Landau mein!,
dies wäre „Wandlauskraut" — was ein Druckfehler ist fiir sogenanntes Walt
lauskraut — xoätoularis silvatioa, die in Pollich's „üora ttalatina" II. x. 148
zwar aufgeführt ist, jedoch ohne Erwähnung dieses ehemaligen Standortes.
macht S. 80 des Archivs geltend, daß die in beiden Urkunden unter
Nr. 22 und 23 ermähnten Weinberge und der Umstand, daß sie bei-
demale in die Bergheimer Gemarkung verlegt werden (die doch kaum
auch noch das Dors Gäuberg umfaßte), darauf hinmiesen, daß in
beiden Fällen der Gäusberg gemeint sei, und zwar die gegen das
Rheinthal gelegenen Abhänge desselben, mo allein Weinbau möglich
und bis heutigen Tags ununterbrochen fortgetrieben worden ist. Ganz
dieselbe Oertlichkeit ist wahrscheinlich auch in einer Nachricht vom Jahr
1369 verstanden, wo es heißt „Ein halber Morgen Wingerts an
dem Geißberg zu (gränzt) an den Wald, obwendig Jütten Senderin". —
Wie man nun diese Frau Jutta Sender in der Badenia II, S. 419
mit dem Jettenbühl in Verbindung bringen kann, wie doch nach der
bestimmten Versicherung des Leodius blos der Schloßberg ehemals
genannt worden sein soll, der als auf der Nordseite gelegen, gewiß
niemals mit Wein angepflanzt war J — dies ist kaum abzusehen,
wenn schon wir zugeben, daß alle die Fabeln über eine Wahrsagerin
Jetta, die Leodius nicht einmal selbst gehört, sondern in einen: alten
Manuscript gelesen haben will, erst durch den Namen Jettenbühl
hervorgerufen wurden, den man personifizierte, bei welcher Manipu-
lation man aber übersah, daß ein altdeutscher Personalname Jetta
gar nicht existirt; ob aber eine fränkische Herzogin Namens lluttu
(letzteres ein häufig vorkommender Name) auf jene sagenhafte Be-
nennung des untern Schloßhügels einen Einfluß hatte, mag füglich
dahingestellt bleiben.
Aus der Schreibung „Geitzverg" in der oben erwähnten, von
0 Es dürfte vielleicht von Interesse sein, bei dieser Gelegenheit auf eine
an diesem Orte ehemals verbreitete Pflanze aufmerksam zu machen, die man
gegen die jetzt so sehr um sich greifende Hundswuth anwandte. Es hatte nämlich,
— so berichtet Landau in seiner Geschichte der Jagd (Kassel 1849) S. 98 —
ein hessischer Landgraf von Kassel seine Jagdhunde an jener Krankheit einge-
büßt und wandte sich deßhalb anno 1591 an den Pfalzgrasen salso wohl an
Johann Kasimirs ihm ein am Heidelberger Schloßberg wachsendes Gegenmittel
— sxatula koottäa — zu schicken, um es in Hessen anzupflanzen. Landau mein!,
dies wäre „Wandlauskraut" — was ein Druckfehler ist fiir sogenanntes Walt
lauskraut — xoätoularis silvatioa, die in Pollich's „üora ttalatina" II. x. 148
zwar aufgeführt ist, jedoch ohne Erwähnung dieses ehemaligen Standortes.