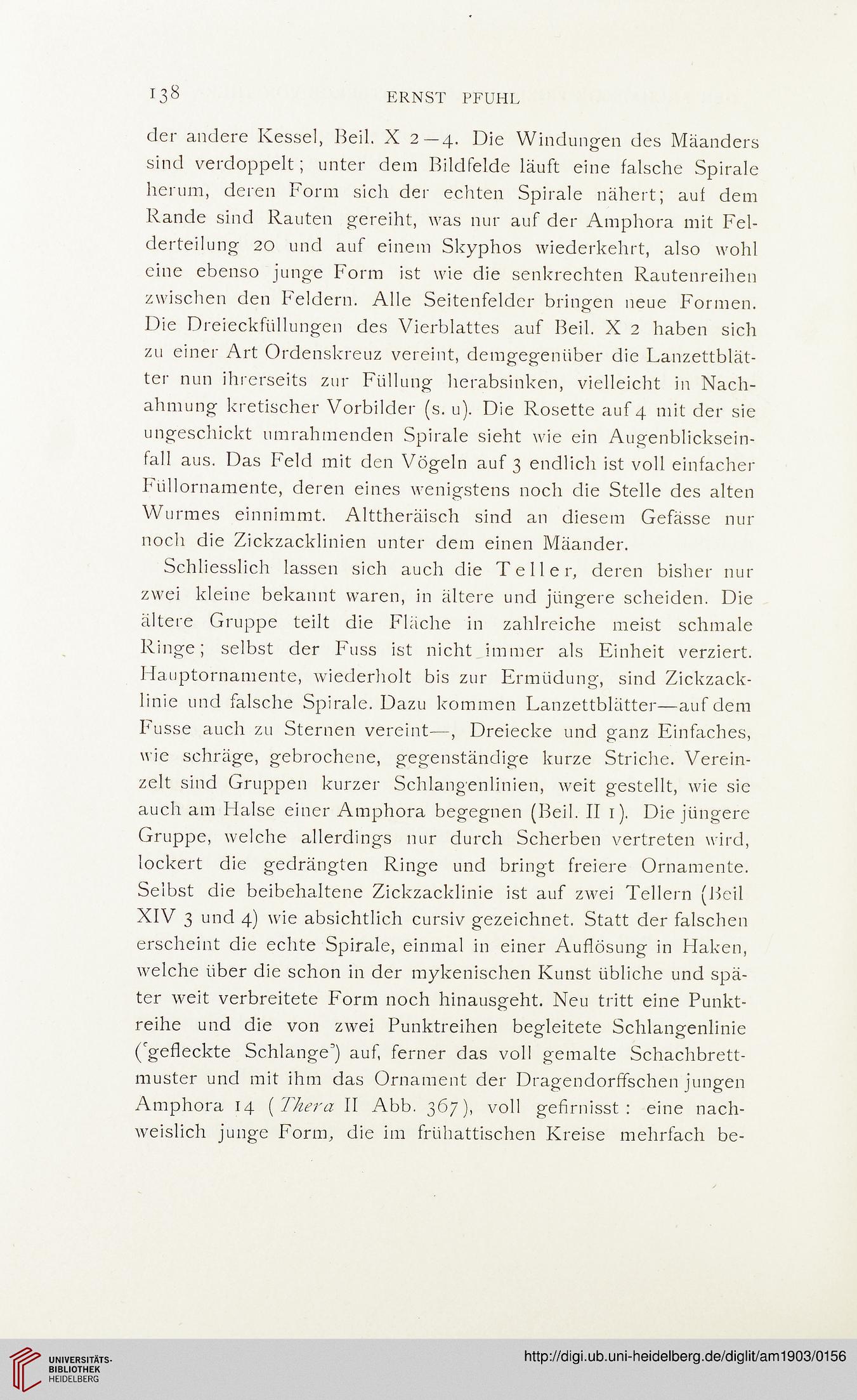ERNST PFUHL
138
der andere Kessel, Beil. X 2—4. Die Windungen des Mäanders
sind verdoppelt; unter dem Bildfelde läuft eine falsche Spirale
herum, deren Form sich der echten Spirale nähert; auf dem
Rande sind Rauten gereiht, was nur auf der Amphora mit Fel-
derteilung 20 und auf einem Skyphos wiederkehrt, also wohl
eine ebenso junge Form ist wie die senkrechten Rautenreihen
zwischen den Feldern. Alle Seitenfelder bringen neue Formen.
Die Dreieckfüllungen des Vierblattes auf Beil. X 2 haben sich
zu einer Art Ordenskreuz vereint, demgegenüber die Lanzettblät-
ter nun ihrerseits zur Füllung herabsinken, vielleicht in Nach-
ahmung kretischer Vorbilder (s. u). Die Rosette auf 4 mit der sie
ungeschickt umrahmenden Spirale sieht wie ein Augenblicksein-
fall aus. Das Feld mit den Vögeln auf 3 endlich ist voll einfacher
Füllornamente, deren eines wenigstens noch die Stelle des alten
Wurmes einnimmt. Alttheräisch sind an diesem Gefässe nur
noch die Zickzacklinien unter dem einen Mäander.
Schliesslich lassen sich auch die Teller, deren bisher nur
zwei kleine bekannt waren, in ältere und jüngere scheiden. Die
ältere Gruppe teilt die Fläche in zahlreiche meist schmale
Ringe; selbst der Fuss ist nicht immer als Einheit verziert.
Hauptornamente, wiederholt bis zur Ermüdung, sind Zickzack-
linie und falsche Spirale. Dazu kommen Lanzettblätter—auf dem
Eusse auch zu Sternen vereint—, Dreiecke und ganz Einfaches,
wie schräge, gebrochene, gegenständige kurze Striche. \^erein-
zelt sind Gruppen kurzer Schlangenlinien, weit gestellt, wie sie
auch am Halse einer Amphora begegnen (Beil. II 1). Die jüngere
Gruppe, welche allerdings nur durch Scherben vertreten wird,
lockert die gedrängten Ringe und bringt freiere Ornamente.
Selbst die beibehaltene Zickzacklinie ist auf zwei Tellern (Beil
XIV 3 und 4) wie absichtlich cursiv gezeichnet. Statt der falschen
erscheint die echte Spirale, einmal in einer Auflösung in Haken,
welche über die schon in der mykenischen Kunst übliche und spä-
ter weit verbreitete Form noch hinausgeht. Neu tritt eine Punkt-
reihe und die von zwei Punktreihen begleitete Schlangenlinie
(Cgefleckte Schlange3) auf, ferner das voll gemalte Schachbrett-
muster und mit ihm das Ornament der Dragendorffschen jungen
Amphora 14 ( Thera II Abb. 367), voll gefirnisst: eine nach-
weislich junge Form, die im frühattischen Kreise mehrfach be-
138
der andere Kessel, Beil. X 2—4. Die Windungen des Mäanders
sind verdoppelt; unter dem Bildfelde läuft eine falsche Spirale
herum, deren Form sich der echten Spirale nähert; auf dem
Rande sind Rauten gereiht, was nur auf der Amphora mit Fel-
derteilung 20 und auf einem Skyphos wiederkehrt, also wohl
eine ebenso junge Form ist wie die senkrechten Rautenreihen
zwischen den Feldern. Alle Seitenfelder bringen neue Formen.
Die Dreieckfüllungen des Vierblattes auf Beil. X 2 haben sich
zu einer Art Ordenskreuz vereint, demgegenüber die Lanzettblät-
ter nun ihrerseits zur Füllung herabsinken, vielleicht in Nach-
ahmung kretischer Vorbilder (s. u). Die Rosette auf 4 mit der sie
ungeschickt umrahmenden Spirale sieht wie ein Augenblicksein-
fall aus. Das Feld mit den Vögeln auf 3 endlich ist voll einfacher
Füllornamente, deren eines wenigstens noch die Stelle des alten
Wurmes einnimmt. Alttheräisch sind an diesem Gefässe nur
noch die Zickzacklinien unter dem einen Mäander.
Schliesslich lassen sich auch die Teller, deren bisher nur
zwei kleine bekannt waren, in ältere und jüngere scheiden. Die
ältere Gruppe teilt die Fläche in zahlreiche meist schmale
Ringe; selbst der Fuss ist nicht immer als Einheit verziert.
Hauptornamente, wiederholt bis zur Ermüdung, sind Zickzack-
linie und falsche Spirale. Dazu kommen Lanzettblätter—auf dem
Eusse auch zu Sternen vereint—, Dreiecke und ganz Einfaches,
wie schräge, gebrochene, gegenständige kurze Striche. \^erein-
zelt sind Gruppen kurzer Schlangenlinien, weit gestellt, wie sie
auch am Halse einer Amphora begegnen (Beil. II 1). Die jüngere
Gruppe, welche allerdings nur durch Scherben vertreten wird,
lockert die gedrängten Ringe und bringt freiere Ornamente.
Selbst die beibehaltene Zickzacklinie ist auf zwei Tellern (Beil
XIV 3 und 4) wie absichtlich cursiv gezeichnet. Statt der falschen
erscheint die echte Spirale, einmal in einer Auflösung in Haken,
welche über die schon in der mykenischen Kunst übliche und spä-
ter weit verbreitete Form noch hinausgeht. Neu tritt eine Punkt-
reihe und die von zwei Punktreihen begleitete Schlangenlinie
(Cgefleckte Schlange3) auf, ferner das voll gemalte Schachbrett-
muster und mit ihm das Ornament der Dragendorffschen jungen
Amphora 14 ( Thera II Abb. 367), voll gefirnisst: eine nach-
weislich junge Form, die im frühattischen Kreise mehrfach be-