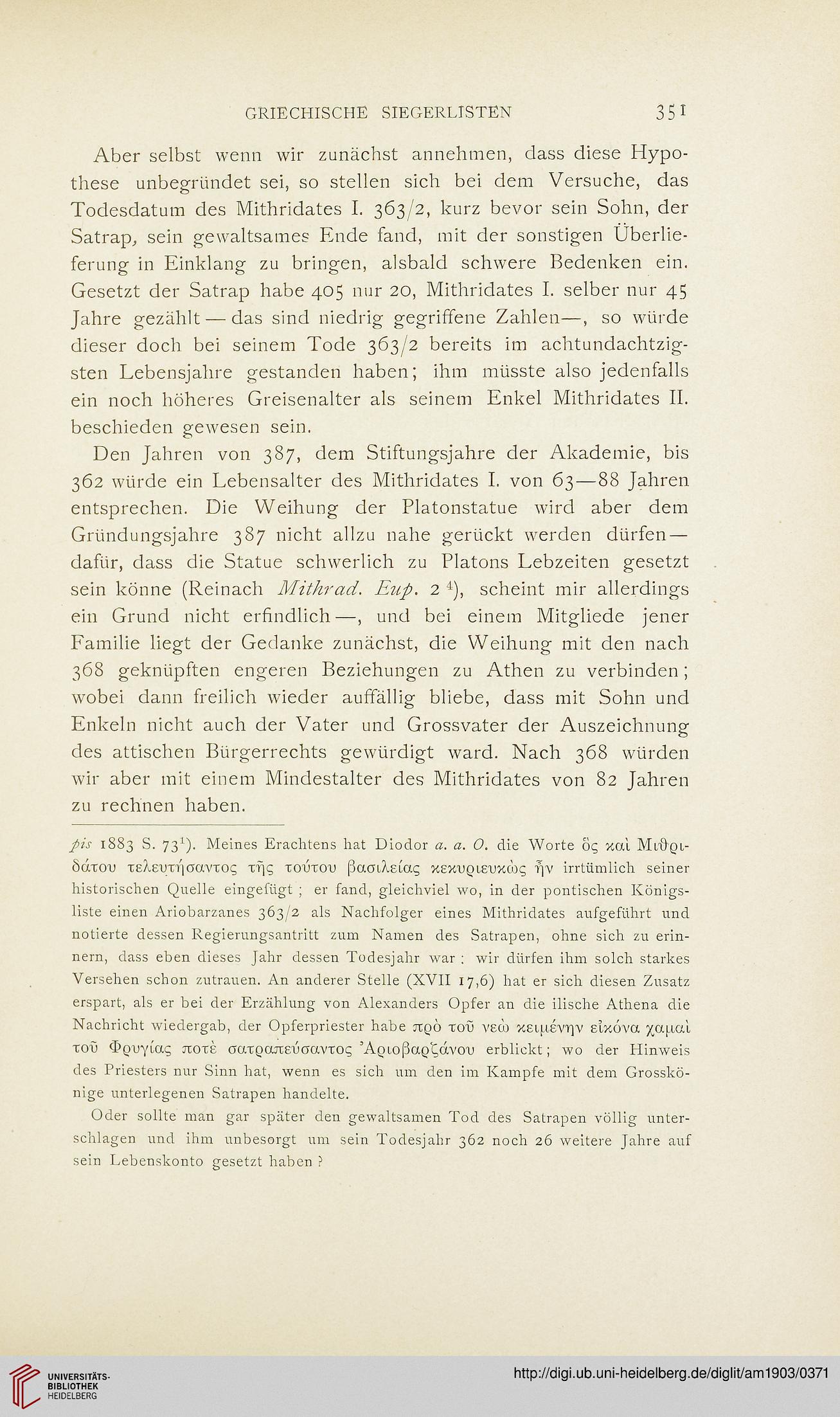GRIECHISCHE SIEGERLISTEN
351
Aber selbst wenn wir zunächst annehmen, dass diese Hypo-
these unbegründet sei, so stellen sich bei dem Versuche, das
Todesdatum des Mithridates I. 363/2, kurz bevor sein Sohn, der
Satrap, sein gewaltsames Ende fand, mit der sonstigen Überlie-
ferung in Einklang zu bringen, alsbald schwere Bedenken ein.
Gesetzt der Satrap habe 405 nur 20, Mithridates I. selber nur 45
Jahre gezählt — das sind niedrig gegriffene Zahlen—, so würde
dieser doch bei seinem Tode 363/2 bereits im achtundachtzig-
sten Lebensjahre gestanden haben; ihm müsste also jedenfalls
ein noch höheres Greisenalter als seinem Enkel Mithridates II.
beschieden gewesen sein.
Den Jahren von 387, dem Stiftungsjahre der Akademie, bis
362 würde ein Lebensalter des Mithridates I. von 63—88 Jahren
entsprechen. Die Weihung der Platonstatue wird aber dem
Gründungsjahre 387 nicht allzu nahe gerückt werden dürfen —
dafür, dass die Statue schwerlich zu Platons Lebzeiten gesetzt
sein könne (Reinach Mithrad. Eup. 2 4j, scheint mir allerdings
ein Grund nicht erfindlich—, und bei einem Mitgliede jener
Familie liegt der Gedanke zunächst, die Weihung mit den nach
368 geknüpften engeren Beziehungen zu Athen zu verbinden;
wobei dann freilich wieder auffällig bliebe, dass mit Sohn und
Enkeln nicht auch der Vater und Grossvater der Auszeichnung
des attischen Bürgerrechts gewürdigt ward. Nach 368 würden
wir aber mit einem Mindestalter des Mithridates von 82 Jahren
zu rechnen haben.
pis 1883 S. 731). Meines Erachtens hat Diodor a. a. 0. die Worte δς καί Μιθρι-
δάτου τε?ιευτήσαντος τής τοΰτου βασιλείας κεκυριευκώς ήν irrtümlich seiner
historischen Quelle eingefügt ; er fand, gleichviel wo, in der pontischen Königs-
liste einen Ariobarzanes 363/2 als Nachfolger eines Mithridates aufgeführt und
notierte dessen Regierungsantritt zum Namen des Satrapen, ohne sich zu erin-
nern, dass eben dieses Jahr dessen Todesjahr war ; wir dürfen ihm solch starkes
Versehen schon Zutrauen. An anderer Stelle (XVII 17,6) hat er sich diesen Zusatz
erspart, als er bei der Erzählung von Alexanders Opfer an die ilische Athena die
Nachricht wiedergab, der Opferpriester habe προ του νεώ κειμένην εικόνα χαμαί
τοΰ Φρυγίας ποτέ σατραπεΰσαντος Άριοβαρζάνου erblickt; wo der Hinweis
des Priesters nur Sinn hat, wenn es sich um den im Kampfe mit dem Grosskö-
nige unterlegenen Satrapen handelte.
Oder sollte man gar später den gewaltsamen Tod des Satrapen völlig unter-
schlagen und ihm unbesorgt um sein Todesjahr 362 noch 26 weitere Jahre auf
sein Lebenskonto gesetzt haben ?
351
Aber selbst wenn wir zunächst annehmen, dass diese Hypo-
these unbegründet sei, so stellen sich bei dem Versuche, das
Todesdatum des Mithridates I. 363/2, kurz bevor sein Sohn, der
Satrap, sein gewaltsames Ende fand, mit der sonstigen Überlie-
ferung in Einklang zu bringen, alsbald schwere Bedenken ein.
Gesetzt der Satrap habe 405 nur 20, Mithridates I. selber nur 45
Jahre gezählt — das sind niedrig gegriffene Zahlen—, so würde
dieser doch bei seinem Tode 363/2 bereits im achtundachtzig-
sten Lebensjahre gestanden haben; ihm müsste also jedenfalls
ein noch höheres Greisenalter als seinem Enkel Mithridates II.
beschieden gewesen sein.
Den Jahren von 387, dem Stiftungsjahre der Akademie, bis
362 würde ein Lebensalter des Mithridates I. von 63—88 Jahren
entsprechen. Die Weihung der Platonstatue wird aber dem
Gründungsjahre 387 nicht allzu nahe gerückt werden dürfen —
dafür, dass die Statue schwerlich zu Platons Lebzeiten gesetzt
sein könne (Reinach Mithrad. Eup. 2 4j, scheint mir allerdings
ein Grund nicht erfindlich—, und bei einem Mitgliede jener
Familie liegt der Gedanke zunächst, die Weihung mit den nach
368 geknüpften engeren Beziehungen zu Athen zu verbinden;
wobei dann freilich wieder auffällig bliebe, dass mit Sohn und
Enkeln nicht auch der Vater und Grossvater der Auszeichnung
des attischen Bürgerrechts gewürdigt ward. Nach 368 würden
wir aber mit einem Mindestalter des Mithridates von 82 Jahren
zu rechnen haben.
pis 1883 S. 731). Meines Erachtens hat Diodor a. a. 0. die Worte δς καί Μιθρι-
δάτου τε?ιευτήσαντος τής τοΰτου βασιλείας κεκυριευκώς ήν irrtümlich seiner
historischen Quelle eingefügt ; er fand, gleichviel wo, in der pontischen Königs-
liste einen Ariobarzanes 363/2 als Nachfolger eines Mithridates aufgeführt und
notierte dessen Regierungsantritt zum Namen des Satrapen, ohne sich zu erin-
nern, dass eben dieses Jahr dessen Todesjahr war ; wir dürfen ihm solch starkes
Versehen schon Zutrauen. An anderer Stelle (XVII 17,6) hat er sich diesen Zusatz
erspart, als er bei der Erzählung von Alexanders Opfer an die ilische Athena die
Nachricht wiedergab, der Opferpriester habe προ του νεώ κειμένην εικόνα χαμαί
τοΰ Φρυγίας ποτέ σατραπεΰσαντος Άριοβαρζάνου erblickt; wo der Hinweis
des Priesters nur Sinn hat, wenn es sich um den im Kampfe mit dem Grosskö-
nige unterlegenen Satrapen handelte.
Oder sollte man gar später den gewaltsamen Tod des Satrapen völlig unter-
schlagen und ihm unbesorgt um sein Todesjahr 362 noch 26 weitere Jahre auf
sein Lebenskonto gesetzt haben ?