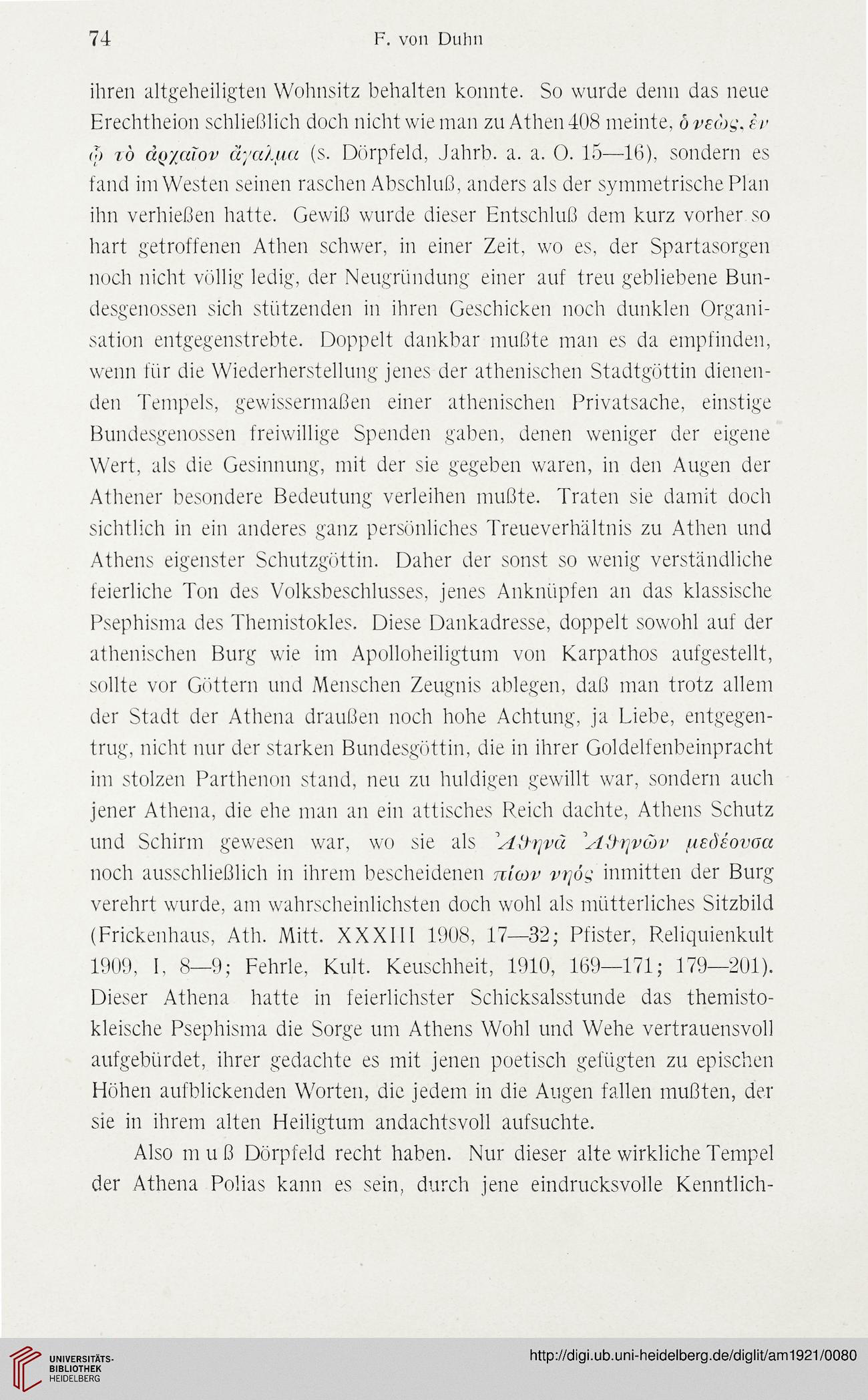74
F. von Duhn
ihren altgeheiligten Wohnsitz behalten konnte. So wurde denn das neue
Erechtheion schließlich doch nicht wie man zu Athen 408 meinte, 6 rsojg, ev
(J) xo a,Qyalov äycduu (s. Dörpfeld, Jahrb. a. a. 0. 15—16), sondern es
fand im Westen seinen raschen Abschluß, anders als der symmetrische Plan
ihn verhießen hatte. Gewiß wurde dieser Entschluß dem kurz vorher so
hart getroffenen Athen schwer, in einer Zeit, wo es, der Spartasorgen
noch nicht völlig ledig, der Neugründung einer auf treu gebliebene Bun-
desgenossen sich stützenden in ihren Geschicken noch dunklen Organi-
sation entgegenstrebte. Doppelt dankbar mußte man es da empfinden,
wenn für die Wiederherstellung jenes der athenischen Stadtgöttin dienen-
den Tempels, gewissermaßen einer athenischen Privatsache, einstige
Bundesgenossen freiwillige Spenden gaben, denen weniger der eigene
Wert, als die Gesinnung, mit der sie gegeben waren, in den Augen der
Athener besondere Bedeutung verleihen mußte. Traten sie damit doch
sichtlich in ein anderes ganz persönliches Treueverhältnis zu Athen und
Athens eigenster Schutzgöttin. Daher der sonst so wenig verständliche
feierliche Ton des Volksbeschlusses, jenes Anknüpfen an das klassische
Psephisma des Themistokles. Diese Dankadresse, doppelt sowohl auf der
athenischen Burg wie im Apolloheiligtum von Karpathos aufgestellt,
sollte vor Göttern und Menschen Zeugnis ablegen, daß man trotz allem
der Stadt der Athena draußen noch hohe Achtung, ja Liebe, entgegen-
trug, nicht nur der starken Bundesgöttin, die in ihrer Goldelfenbeinpracht
im stolzen Parthenon stand, neu zu huldigen gewillt war, sondern auch
jener Athena, die ehe man an ein attisches Reich dachte, Athens Schutz
und Schirm gewesen war, wo sie als ''Adr\vu didrjväjv /lEÖEOvoa
noch ausschließlich in ihrem bescheidenen nicov vrjög inmitten der Burg
verehrt wurde, atn wahrscheinlichsten doch wohl als mütterliches Sitzbild
(Frickenhaus, Ath. Mitt. XXXIII 1908, 17—32; Pfister, Reliquienkult
1909, I, 8—9; Fehrle, Kult. Keuschheit, 1910, 169—171; 179—201).
Dieser Athena hatte iti feierlichster Schicksalsstunde das themisto-
kleische Psephisma die Sorge um Athens Wohl und Wehe vertrauensvoll
aufgebürdet, ihrer gedachte es mit jenen poetisch gefügten zu epischen
Höhen aufblickenden Worten, die jedem in die Augen fallen mußten, der
sie in ihrem alten Heiligtum andachtsvoll aufsuchte.
Also muß Dörpfeld recht haben. Nur dieser alte wirklicheTempel
der Athena Polias kann es sein, durch jene eindrucksvolle Kenntlich-
F. von Duhn
ihren altgeheiligten Wohnsitz behalten konnte. So wurde denn das neue
Erechtheion schließlich doch nicht wie man zu Athen 408 meinte, 6 rsojg, ev
(J) xo a,Qyalov äycduu (s. Dörpfeld, Jahrb. a. a. 0. 15—16), sondern es
fand im Westen seinen raschen Abschluß, anders als der symmetrische Plan
ihn verhießen hatte. Gewiß wurde dieser Entschluß dem kurz vorher so
hart getroffenen Athen schwer, in einer Zeit, wo es, der Spartasorgen
noch nicht völlig ledig, der Neugründung einer auf treu gebliebene Bun-
desgenossen sich stützenden in ihren Geschicken noch dunklen Organi-
sation entgegenstrebte. Doppelt dankbar mußte man es da empfinden,
wenn für die Wiederherstellung jenes der athenischen Stadtgöttin dienen-
den Tempels, gewissermaßen einer athenischen Privatsache, einstige
Bundesgenossen freiwillige Spenden gaben, denen weniger der eigene
Wert, als die Gesinnung, mit der sie gegeben waren, in den Augen der
Athener besondere Bedeutung verleihen mußte. Traten sie damit doch
sichtlich in ein anderes ganz persönliches Treueverhältnis zu Athen und
Athens eigenster Schutzgöttin. Daher der sonst so wenig verständliche
feierliche Ton des Volksbeschlusses, jenes Anknüpfen an das klassische
Psephisma des Themistokles. Diese Dankadresse, doppelt sowohl auf der
athenischen Burg wie im Apolloheiligtum von Karpathos aufgestellt,
sollte vor Göttern und Menschen Zeugnis ablegen, daß man trotz allem
der Stadt der Athena draußen noch hohe Achtung, ja Liebe, entgegen-
trug, nicht nur der starken Bundesgöttin, die in ihrer Goldelfenbeinpracht
im stolzen Parthenon stand, neu zu huldigen gewillt war, sondern auch
jener Athena, die ehe man an ein attisches Reich dachte, Athens Schutz
und Schirm gewesen war, wo sie als ''Adr\vu didrjväjv /lEÖEOvoa
noch ausschließlich in ihrem bescheidenen nicov vrjög inmitten der Burg
verehrt wurde, atn wahrscheinlichsten doch wohl als mütterliches Sitzbild
(Frickenhaus, Ath. Mitt. XXXIII 1908, 17—32; Pfister, Reliquienkult
1909, I, 8—9; Fehrle, Kult. Keuschheit, 1910, 169—171; 179—201).
Dieser Athena hatte iti feierlichster Schicksalsstunde das themisto-
kleische Psephisma die Sorge um Athens Wohl und Wehe vertrauensvoll
aufgebürdet, ihrer gedachte es mit jenen poetisch gefügten zu epischen
Höhen aufblickenden Worten, die jedem in die Augen fallen mußten, der
sie in ihrem alten Heiligtum andachtsvoll aufsuchte.
Also muß Dörpfeld recht haben. Nur dieser alte wirklicheTempel
der Athena Polias kann es sein, durch jene eindrucksvolle Kenntlich-