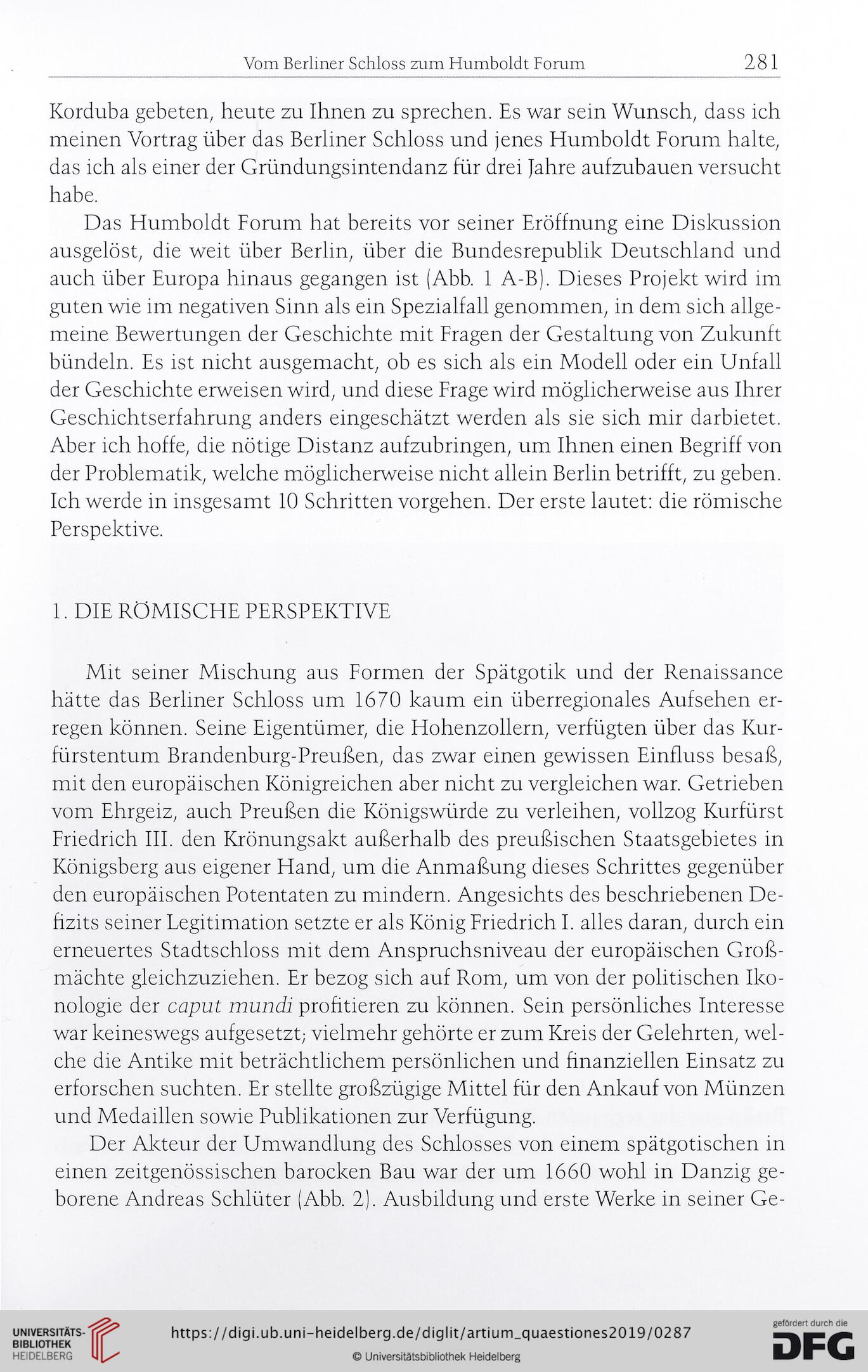Vom Berliner Schloss zum Humboldt Forum
281
Korduba gebeten, heute zu Ihnen zu sprechen. Es war sein Wunsch, dass ich
meinen Vortrag über das Berliner Schloss und jenes Humboldt Forum halte,
das ich als einer der Gründungsintendanz für drei Jahre aufzubauen versucht
habe.
Das Humboldt Forum hat bereits vor seiner Eröffnung eine Diskussion
ausgelöst, die weit über Berlin, über die Bundesrepublik Deutschland und
auch über Europa hinaus gegangen ist (Abb. 1 A-B). Dieses Projekt wird im
guten wie im negativen Sinn als ein Spezialfall genommen, in dem sich allge-
meine Bewertungen der Geschichte mit Fragen der Gestaltung von Zukunft
bündeln. Es ist nicht ausgemacht, ob es sich als ein Modell oder ein Unfall
der Geschichte erweisen wird, und diese Frage wird möglicherweise aus Ihrer
Geschichtserfahrung anders eingeschätzt werden als sie sich mir darbietet.
Aber ich hoffe, die nötige Distanz aufzubringen, um Ihnen einen Begriff von
der Problematik, welche möglicherweise nicht allein Berlin betrifft, zu geben.
Ich werde in insgesamt 10 Schritten vorgehen. Der erste lautet: die römische
Perspektive.
1. DIE RÖMISCHE PERSPEKTIVE
Mit seiner Mischung aus Formen der Spätgotik und der Renaissance
hätte das Berliner Schloss um 1670 kaum em überregionales Aufsehen er-
regen können. Seine Eigentümer, die Hohenzollern, verfügten über das Kur-
fürstentum Brandenburg-Preußen, das zwar einen gewissen Einfluss besaß,
mit den europäischen Königreichen aber nicht zu vergleichen war. Getrieben
vom Ehrgeiz, auch Preußen die Königswürde zu verleihen, vollzog Kurfürst
Friedrich III. den Krönungsakt außerhalb des preußischen Staatsgebietes in
Königsberg aus eigener Hand, um die Anmaßung dieses Schrittes gegenüber
den europäischen Potentaten zu mindern. Angesichts des beschriebenen De-
fizits seiner Legitimation setzte er als König Friedrich I. alles daran, durch ein
erneuertes Stadtschloss mit dem Anspruchsniveau der europäischen Groß-
mächte gleichzuziehen. Er bezog sich auf Rom, um von der politischen lim-
nologie der caput mundi profitieren zu können. Sein persönliches Interesse
war keineswegs aufgesetzt; vielmehr gehörte er zum Kreis der Gelehrten, wel-
che die Antike mit beträchtlichem persönlichen und finanziellen Einsatz zu
erforschen suchten. Er stellte großzügige Mittel für den Ankauf von Münzen
und Medaillen sowie Publikationen zur Verfügung.
Der Akteur der Umwandlung des Schlosses von einem spätgotischen in
einen zeitgenössischen barocken Bau war der um 1660 wohl in Danzig ge-
borene Andreas Schlüter (Abb. 2). Ausbildung und erste Werke in seiner Ge-
281
Korduba gebeten, heute zu Ihnen zu sprechen. Es war sein Wunsch, dass ich
meinen Vortrag über das Berliner Schloss und jenes Humboldt Forum halte,
das ich als einer der Gründungsintendanz für drei Jahre aufzubauen versucht
habe.
Das Humboldt Forum hat bereits vor seiner Eröffnung eine Diskussion
ausgelöst, die weit über Berlin, über die Bundesrepublik Deutschland und
auch über Europa hinaus gegangen ist (Abb. 1 A-B). Dieses Projekt wird im
guten wie im negativen Sinn als ein Spezialfall genommen, in dem sich allge-
meine Bewertungen der Geschichte mit Fragen der Gestaltung von Zukunft
bündeln. Es ist nicht ausgemacht, ob es sich als ein Modell oder ein Unfall
der Geschichte erweisen wird, und diese Frage wird möglicherweise aus Ihrer
Geschichtserfahrung anders eingeschätzt werden als sie sich mir darbietet.
Aber ich hoffe, die nötige Distanz aufzubringen, um Ihnen einen Begriff von
der Problematik, welche möglicherweise nicht allein Berlin betrifft, zu geben.
Ich werde in insgesamt 10 Schritten vorgehen. Der erste lautet: die römische
Perspektive.
1. DIE RÖMISCHE PERSPEKTIVE
Mit seiner Mischung aus Formen der Spätgotik und der Renaissance
hätte das Berliner Schloss um 1670 kaum em überregionales Aufsehen er-
regen können. Seine Eigentümer, die Hohenzollern, verfügten über das Kur-
fürstentum Brandenburg-Preußen, das zwar einen gewissen Einfluss besaß,
mit den europäischen Königreichen aber nicht zu vergleichen war. Getrieben
vom Ehrgeiz, auch Preußen die Königswürde zu verleihen, vollzog Kurfürst
Friedrich III. den Krönungsakt außerhalb des preußischen Staatsgebietes in
Königsberg aus eigener Hand, um die Anmaßung dieses Schrittes gegenüber
den europäischen Potentaten zu mindern. Angesichts des beschriebenen De-
fizits seiner Legitimation setzte er als König Friedrich I. alles daran, durch ein
erneuertes Stadtschloss mit dem Anspruchsniveau der europäischen Groß-
mächte gleichzuziehen. Er bezog sich auf Rom, um von der politischen lim-
nologie der caput mundi profitieren zu können. Sein persönliches Interesse
war keineswegs aufgesetzt; vielmehr gehörte er zum Kreis der Gelehrten, wel-
che die Antike mit beträchtlichem persönlichen und finanziellen Einsatz zu
erforschen suchten. Er stellte großzügige Mittel für den Ankauf von Münzen
und Medaillen sowie Publikationen zur Verfügung.
Der Akteur der Umwandlung des Schlosses von einem spätgotischen in
einen zeitgenössischen barocken Bau war der um 1660 wohl in Danzig ge-
borene Andreas Schlüter (Abb. 2). Ausbildung und erste Werke in seiner Ge-