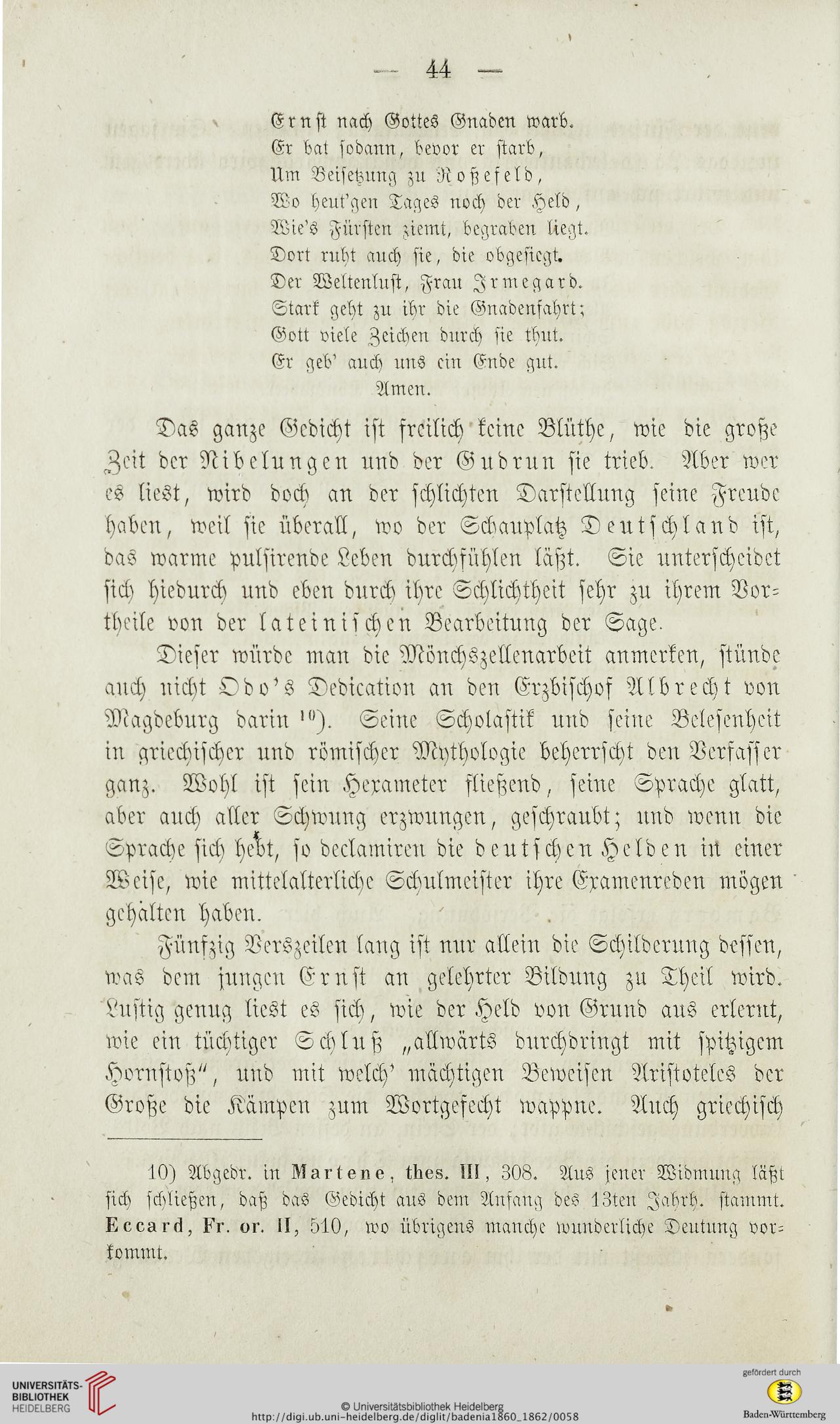44 —
Ernst nach Gottes Gnaden warb.
Er bat sodann, bevor er starb,
Um Betsetzung zu Roßefeld,
Wo heut'gen Tages noch der Held,
Wte's Fnrsten ziemt, begraben liegt.
Dort ruht auch sie, die obgesicgt.
Der Weltenlust, Frau Jrmegard.
Stark geht zu ihr die Gnadenfahrt;
Gott viele Zeichen durch sie thut.
Er geb' auch uns ein Ende gut.
Amen.
Das ganze Gedicht ist frcilich kcine Blüthe, wie die große
Zeit dcr Nibelungen und der Gudrun sie trieb. Nber wer
es liest, wird doch an der schlichten Darstellung seine Freude
haben, weil sie überall, wo der Sckauplatz Deutschland ist,
das warme pulsirende Leben durchfühlen laßt. Sie unterscheidet
sich hiedurch und eben durch ihre Schlichtheit sehr zu ihrem Vor-
theile von der lateiniichen Bearbeitnng der Sage.
Dieser würde man die Mönchszellenarbeit anmerken, stünde
auch nicht Odo's Dedication an den Erzbischof Albrecht von
Magdebnrg darin Seine Scholastik und seine Belesenheit
in griechischer und römischer Mythologie beherrscht den Verfasser
ganz. Wohl ist sein Hexameter fließend, seine Sprache glatt,
aber auch aller Schwung erzwungen, geschraubt; nnd wenn die
Sprache sich he^t, so declamiren die deutschen Helden in einer
Weise, wie mittelalterliche Schulmeister ihre Examenreden mögen
gchälten haben.
Fünszig Verszcilen lang ist nur allein die Schilderung dessen,
was dem sungen Ernst an gelehrter Bildung zu Theil wird.
Lustig genug liest es sich, wie der Held von Grund aus erlernt,
wie ein tüchtiger Schluß „allwärts durchdringt mit syitzigem
Hornstoß", und mit welclst mächtigen Beweisen Aristoteles der
Große die Kämpen zum Wortgesecht wappne. Auch griechisch
10) Abgedr. in INArto»«, tlres. M, 308. Aus jener Widmung läßt
sich schließen, daß das Gedicht aus dem Anfang des 13teu Jahrh. stammt.
kcourä, ik'r. or. II, 510, wo übrigens manche wunderliche Deutung vor-
kommt.
Ernst nach Gottes Gnaden warb.
Er bat sodann, bevor er starb,
Um Betsetzung zu Roßefeld,
Wo heut'gen Tages noch der Held,
Wte's Fnrsten ziemt, begraben liegt.
Dort ruht auch sie, die obgesicgt.
Der Weltenlust, Frau Jrmegard.
Stark geht zu ihr die Gnadenfahrt;
Gott viele Zeichen durch sie thut.
Er geb' auch uns ein Ende gut.
Amen.
Das ganze Gedicht ist frcilich kcine Blüthe, wie die große
Zeit dcr Nibelungen und der Gudrun sie trieb. Nber wer
es liest, wird doch an der schlichten Darstellung seine Freude
haben, weil sie überall, wo der Sckauplatz Deutschland ist,
das warme pulsirende Leben durchfühlen laßt. Sie unterscheidet
sich hiedurch und eben durch ihre Schlichtheit sehr zu ihrem Vor-
theile von der lateiniichen Bearbeitnng der Sage.
Dieser würde man die Mönchszellenarbeit anmerken, stünde
auch nicht Odo's Dedication an den Erzbischof Albrecht von
Magdebnrg darin Seine Scholastik und seine Belesenheit
in griechischer und römischer Mythologie beherrscht den Verfasser
ganz. Wohl ist sein Hexameter fließend, seine Sprache glatt,
aber auch aller Schwung erzwungen, geschraubt; nnd wenn die
Sprache sich he^t, so declamiren die deutschen Helden in einer
Weise, wie mittelalterliche Schulmeister ihre Examenreden mögen
gchälten haben.
Fünszig Verszcilen lang ist nur allein die Schilderung dessen,
was dem sungen Ernst an gelehrter Bildung zu Theil wird.
Lustig genug liest es sich, wie der Held von Grund aus erlernt,
wie ein tüchtiger Schluß „allwärts durchdringt mit syitzigem
Hornstoß", und mit welclst mächtigen Beweisen Aristoteles der
Große die Kämpen zum Wortgesecht wappne. Auch griechisch
10) Abgedr. in INArto»«, tlres. M, 308. Aus jener Widmung läßt
sich schließen, daß das Gedicht aus dem Anfang des 13teu Jahrh. stammt.
kcourä, ik'r. or. II, 510, wo übrigens manche wunderliche Deutung vor-
kommt.