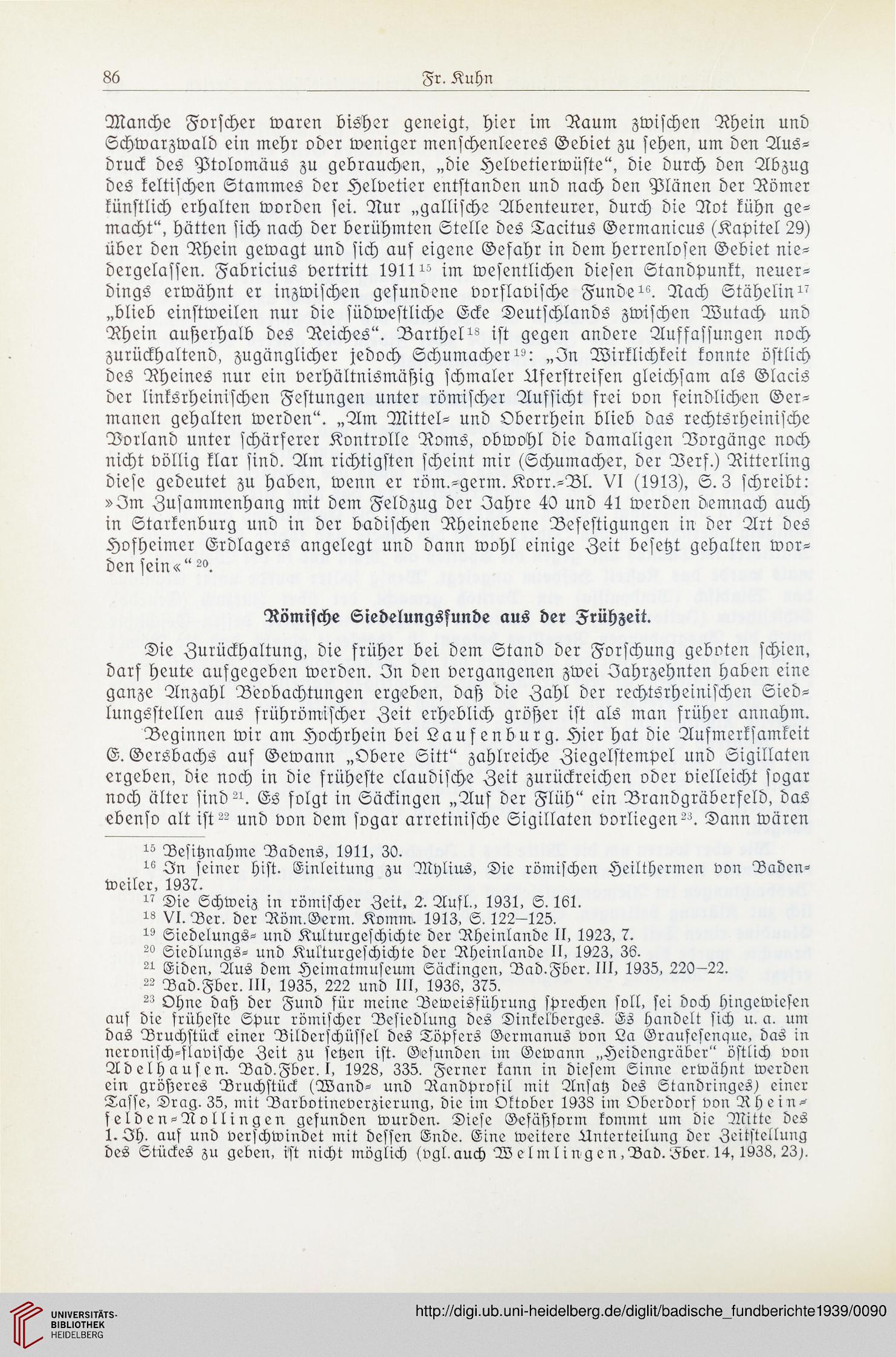86
Fr. Kuhn
Manche Forscher waren bisher geneigt, hier im Raum zwischen Rhein und
Schwarzwald ein mehr oder weniger menschenleeres Gebiet zu sehen, um den Aus-
druck des Ptolomäus zu gebrauchen, „die Helvetierwüste", die durch den Abzug
des keltischen Stammes der Helvetier entstanden und nach den Plänen der Römer
künstlich erhalten worden sei. Rur „gallische Abenteurer, durch die Rot kühn ge-
macht", hätten sich nach der berühmten Stelle des Tacitus Germanicus (Kapitel 29)
über den Rhein gewagt und sich auf eigene Gefahr in dem herrenlosen Gebiet nie-
dergelassen. Fabricius vertritt 1911" im wesentlichen diesen Standpunkt, neuer-
dings erwähnt er inzwischen gefundene vorflavische Funde". Aach Stähelin"
„blieb einstweilen nur die südwestliche Ecke Deutschlands zwischen Wutach und
Rhein außerhalb des Reiches". Barthel" ist gegen andere Auffassungen noch
zurückhaltend, zugänglicher jedoch Schumacher": „In Wirklichkeit konnte östlich
des Rheines nur ein verhältnismäßig schmaler Aferstreifen gleichsam als Glacis
der linksrheinischen Festungen unter römischer Aufsicht frei von feindlichen Ger-
manen gehalten werden". „Am Mittel- und Oberrhein blieb das rechtsrheinische
Vorland unter schärferer Kontrolle Roms, obwohl die damaligen Vorgänge noch
nicht völlig klar sind. Am richtigsten scheint mir (Schumacher, der Verf.) Ritterling
diese gedeutet zu haben, wenn er röm.-germ. Korr.-Bl. VI (1913), S. 3 schreibt:
»Im Zusammenhang mit dem Feldzug der Fahre 42 und 41 werden demnach auch
in Starkenburg und in der badischen Rheinebene Befestigungen in der Art des
Hosheimer Erdlagers angelegt und dann wohl einige Zeit beseht gehalten wor-
den sein«" 2°.
Römische Siedelungsfunde aus der Frühzeit.
Die Zurückhaltung, die früher bei dem Stand der Forschung geboten schien,
darf heute aufgegeben werden. In den vergangenen zwei Iahrzehnten haben eine
ganze Anzahl Beobachtungen ergeben, daß die Zahl der rechtsrheinischen Sied-
lungsstellen aus frührömischer Zeit erheblich größer ist als man früher annahm.
Beginnen wir am Hochrhein bei Laufenburg. Hier hat die Aufmerksamkeit
E. Gersbachs auf Gewann „Obere Sitt" zahlreiche Ziegelstempel und Sigillaten
ergeben, die noch in die früheste claudische Zeit zurückreichen oder vielleicht sogar
noch älter sind 21. Cs folgt in Säckingen „Auf der Flüh" ein Brandgräberfeld, das
ebenso alt ist 22 und von dem sogar arretinische Sigillaten vorliegend Dann wären
" Besitznahme Badens, 1911, 30.
" In seiner hist. Einleitung zu Mylius, Die römischen Heilthermen von Baden-
weiler, 1937.
" Die Schweiz, in römischer Zeit, 2. Aufl., 1931, S. 161.
" Vl. Ber. der Röm.Germ. Komm. 1913, S. 122-125.
" Siedelungs- und Kulturgeschichte der Rheinlands II, 1923, 7.
20 Siedlungs- und Kulturgeschichte der Rheinlande ll, 1923, 36.
21 Eiden, Aus dem Heimatmuseum Säckingen, Baö.Fber. lll, 1935, 220—22.
22 Dad.Fber. III, 1935, 222 und III, 1936, 375.
22 Ohne daß der Fund für meine Beweisführung sprechen soll, sei doch hingewiesen
auf die früheste Spur römischer Besiedlung des Dinkelberges. Es handelt sich u. a. um
das Bruchstück einer Bilderschüssel des Töpfers Germanus von La Graufesenque, das in
neronisch-flavische Zeit zu fetzen ist. Gesunden im Gewann „Heidengräber" östlich von
Adelhausen. Bad.Fber. I, 1928, 335. Ferner kann in diesem Sinne erwähnt werden
ein größeres Bruchstück (Wand- und Randprofil mit Ansatz des Stanöringes) einer
Tasse, Drag. 35, mit Barbotineverzierung, die im Oktober 1938 im Oberdorf von Rhein-
felden-Rollingen gefunden wurden. Diese Gefäßform kommt um die Mitte des
1.2h. auf und verschwindet mit dessen Ende. Eine weitere Unterteilung der Zeitstellung
des Stückes zu geben, ist nicht möglich (vgl. auch W e l m l i n g e n, Bad. Eber. 14,1938, 23).
Fr. Kuhn
Manche Forscher waren bisher geneigt, hier im Raum zwischen Rhein und
Schwarzwald ein mehr oder weniger menschenleeres Gebiet zu sehen, um den Aus-
druck des Ptolomäus zu gebrauchen, „die Helvetierwüste", die durch den Abzug
des keltischen Stammes der Helvetier entstanden und nach den Plänen der Römer
künstlich erhalten worden sei. Rur „gallische Abenteurer, durch die Rot kühn ge-
macht", hätten sich nach der berühmten Stelle des Tacitus Germanicus (Kapitel 29)
über den Rhein gewagt und sich auf eigene Gefahr in dem herrenlosen Gebiet nie-
dergelassen. Fabricius vertritt 1911" im wesentlichen diesen Standpunkt, neuer-
dings erwähnt er inzwischen gefundene vorflavische Funde". Aach Stähelin"
„blieb einstweilen nur die südwestliche Ecke Deutschlands zwischen Wutach und
Rhein außerhalb des Reiches". Barthel" ist gegen andere Auffassungen noch
zurückhaltend, zugänglicher jedoch Schumacher": „In Wirklichkeit konnte östlich
des Rheines nur ein verhältnismäßig schmaler Aferstreifen gleichsam als Glacis
der linksrheinischen Festungen unter römischer Aufsicht frei von feindlichen Ger-
manen gehalten werden". „Am Mittel- und Oberrhein blieb das rechtsrheinische
Vorland unter schärferer Kontrolle Roms, obwohl die damaligen Vorgänge noch
nicht völlig klar sind. Am richtigsten scheint mir (Schumacher, der Verf.) Ritterling
diese gedeutet zu haben, wenn er röm.-germ. Korr.-Bl. VI (1913), S. 3 schreibt:
»Im Zusammenhang mit dem Feldzug der Fahre 42 und 41 werden demnach auch
in Starkenburg und in der badischen Rheinebene Befestigungen in der Art des
Hosheimer Erdlagers angelegt und dann wohl einige Zeit beseht gehalten wor-
den sein«" 2°.
Römische Siedelungsfunde aus der Frühzeit.
Die Zurückhaltung, die früher bei dem Stand der Forschung geboten schien,
darf heute aufgegeben werden. In den vergangenen zwei Iahrzehnten haben eine
ganze Anzahl Beobachtungen ergeben, daß die Zahl der rechtsrheinischen Sied-
lungsstellen aus frührömischer Zeit erheblich größer ist als man früher annahm.
Beginnen wir am Hochrhein bei Laufenburg. Hier hat die Aufmerksamkeit
E. Gersbachs auf Gewann „Obere Sitt" zahlreiche Ziegelstempel und Sigillaten
ergeben, die noch in die früheste claudische Zeit zurückreichen oder vielleicht sogar
noch älter sind 21. Cs folgt in Säckingen „Auf der Flüh" ein Brandgräberfeld, das
ebenso alt ist 22 und von dem sogar arretinische Sigillaten vorliegend Dann wären
" Besitznahme Badens, 1911, 30.
" In seiner hist. Einleitung zu Mylius, Die römischen Heilthermen von Baden-
weiler, 1937.
" Die Schweiz, in römischer Zeit, 2. Aufl., 1931, S. 161.
" Vl. Ber. der Röm.Germ. Komm. 1913, S. 122-125.
" Siedelungs- und Kulturgeschichte der Rheinlands II, 1923, 7.
20 Siedlungs- und Kulturgeschichte der Rheinlande ll, 1923, 36.
21 Eiden, Aus dem Heimatmuseum Säckingen, Baö.Fber. lll, 1935, 220—22.
22 Dad.Fber. III, 1935, 222 und III, 1936, 375.
22 Ohne daß der Fund für meine Beweisführung sprechen soll, sei doch hingewiesen
auf die früheste Spur römischer Besiedlung des Dinkelberges. Es handelt sich u. a. um
das Bruchstück einer Bilderschüssel des Töpfers Germanus von La Graufesenque, das in
neronisch-flavische Zeit zu fetzen ist. Gesunden im Gewann „Heidengräber" östlich von
Adelhausen. Bad.Fber. I, 1928, 335. Ferner kann in diesem Sinne erwähnt werden
ein größeres Bruchstück (Wand- und Randprofil mit Ansatz des Stanöringes) einer
Tasse, Drag. 35, mit Barbotineverzierung, die im Oktober 1938 im Oberdorf von Rhein-
felden-Rollingen gefunden wurden. Diese Gefäßform kommt um die Mitte des
1.2h. auf und verschwindet mit dessen Ende. Eine weitere Unterteilung der Zeitstellung
des Stückes zu geben, ist nicht möglich (vgl. auch W e l m l i n g e n, Bad. Eber. 14,1938, 23).